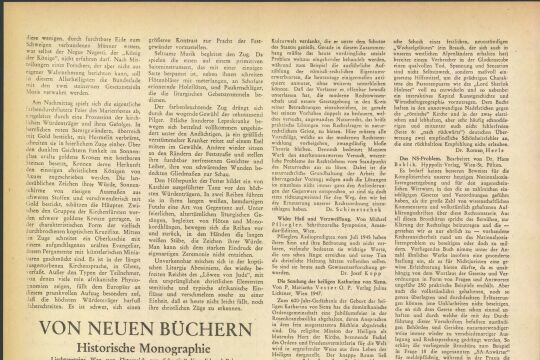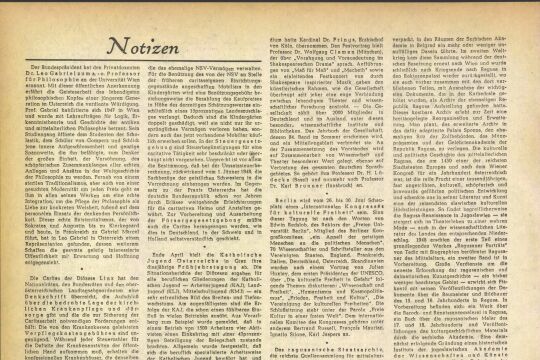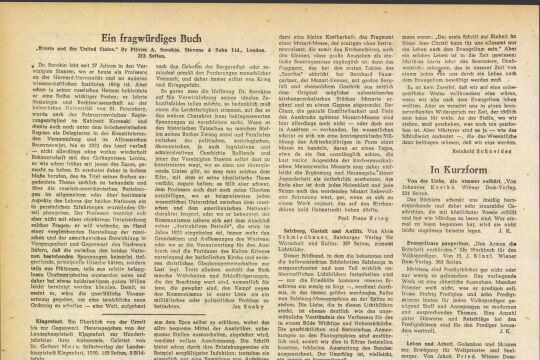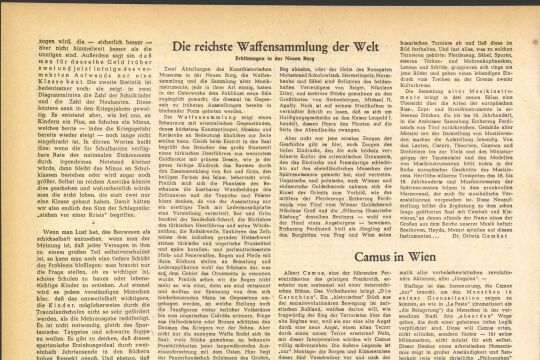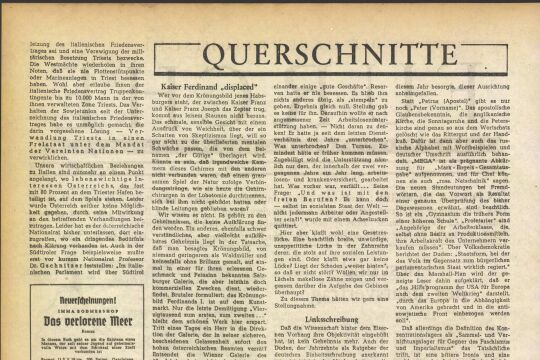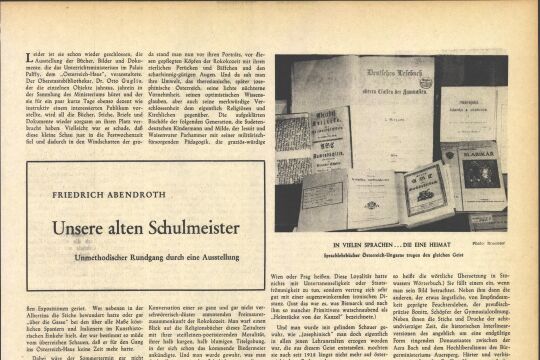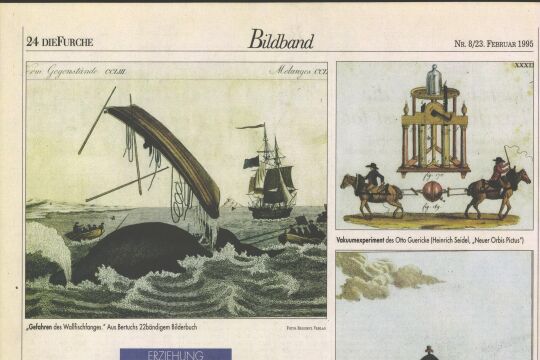„NOTFALLS MIT DEM HUT IN DER HAND.” Das ist, metaphorisch umschrieben, die uneigennützige Ultima Ratio von Dr. Max Wladimir Allmayer-Beck in seiner Eigenschaft als Präsident des Vereins der Museumsfreunde. Wenn es darauf ankommt, einmal etwas „ganz Großes” zu erwerben, ein besonders wertvolles Objekt, das auf dem Kunstmarkt hoch notiert, dann stattet der vitale Jurist aus der Wiener Innenstadt Großbanken und Konzernen höfliche Besuche ab, und — unberufen! — bis jetzt mußte er noch keine Enttäuschung erleben.
Ansonsten handeln die Museumsfreunde ganz selbständig. Wer fünfzig Schilling im Jahr erübrigt, kann schon, sozusagen zu kleinen Preisen, ein willkommener Mitmäzen werden, denn die Mäzene haben die positiven Seiten kollektiver Aktionen erkannt, organisierten sich, setzten Statuten fest und meldeten sich ordnungsgemäß bei der Behörde als Verein an. Beim „Sparverein” der Museumsfreunde kommt das akkumulierte Kleingeld in der weiteren Folge ideell allen Österreichern zugute. Und den ausländischen Sightseeing-Gästen obendrein.
ADOLF LOOS, politisch eher ein Fortschrittlicher nach den Begriffen der zehner und zwanziger Jahre, schrieb in einem seiner Aufsätze, daß die österreichische Aristokratie nicht nur ihre besonderen Vorrechte, sondern auch ihre besonderen Verpflichtungen gekannt habe, nämlich die Förderung der Künste. Auf dieser geistigen und kulturellen Tradition, im weiteren Sinn aufgefaßt, baut der Verein der Museumsfreunde auf und setzte sich zum Ziel, gemeinschaftlich die Mittel zum Ankauf von Kunstwerken aufzubringen, für die das Budget der staatlichen, Landes- und städtischen Museen nicht genügt.
In den Tagen des Grafen Hans Wilczek war die Vorgängerorganisation, nämlich der „Österreichische Galerieverein”, seiner gesellschaftlichen Struktur nach fast so feudal wie der Jockei-Club. Adelige, Industriebarone und großbürgerliche Sammler wie Albert Figdors gaben ihm das Gepräge. Der Galerieverein war vor allem darauf bedacht, Kunstwerke des 19. Jahrhunderts zu erwerben, und erfüllte damit eine bedeutsame Mission, denn für die Kaiserlichen Sammlungen im Kunsthistorischen Museum galt die Epoche Franz’ I. als Limit nach oben.
Von privater Seite erfuhren die Bestrebungen, museal den Anschluß an die weitere Entwicklung der Malerei und der Plastik zu finden, wesentliche, tatkräftige Unterstützung. So gelang die Erwerbung von Renoirs „Badender”, und wer heute etwa Peter Fendis, des Wiener Biedermeiermalers, gar nicht idyllisches, sondern bitter sozialkritisches Gemälde „Die arme Witwe” betrachtet, sei bescheiden darauf hingewiesen, daß auch der Ankauf dieses Bildes dem Galerieverein zu danken ist.
Finanzkräftige geistige Privatinitiative verhinderte damals, daß wertvolle Werke der künstlerischen Hochblüte des Vormärz in den internationalen Kunsthandel und damit auf Nimmerwiedersehen verschwanden.
DIE „ÄRA MOLL”, nach 1918, als der bekannte Landschaftsmaler und einstige Mitbegründer der Secession, Carl Moll, dem Verein präsidierte, fiel in die Zeit eines neu erwachten psychologisch motivierten „Österreich-Bewußtseins”. In dem verarmten kleinen Reststaat, im Wien der Nachkriegsjahre entwickelte sich damals eine beachtliche Verlagsproduktion von Künstlermonographien, kunsttopographischen und landeskundlichen Werken. Es war, als sollte der äußeren Bedrängnis tröstlich das Bild des unverlierbaren inneren und künstlerischen Reichtums, den Österreich bewahrt hat, entgegengehalten werden. Während Neureiche aus Gründen der Repräsentation ihr Geld in alten Möbeln und Bildern anlegten und sich mit Theresianischen Hausbars, chinesischem Porzellan und Biedermeierfauteuils die Pseudotradition zu geben suchten, lebten noch immer begüterte Privatpersonen mit „Vorkriegscharakter”, die aus der Kulturförderung eine Passion machten. Die Annalen des Vereins nennen rühmend Felix von Oppenheimer, einen der letzten Kunstförderer, auf die der alte Ausdruck „hochherzige Gönner” zutraf.
In den dreißiger Jahren, als das Österreich-Bewußtsein vom Politischen her schon sehr an Ansehen verlor, organisierten die Museumsfreunde große Ausstellungen. Ihr Bekenntnis zu diesem Land und seinem kulturellen Erbe dokumentierte sich in einer Schau österreichischer Malerei, „Von Füger bis Klimt”, und in den Ausstellungen „Kaiser Franz Joseph”, „Maria Theresia” und „Prinz Eugen”.
Die Zeit nach 1945 brachte eine Demokratisierung des Vereins; in allen Schichten und Berufsgruppen konnten Mitglieder geworben werden. Freilich, die Kassen blieben zunächst leer, und die Museumsfreunde mußten zwangsläufig in ein stilleres Fahrwasser einschwenken. Unter der Präsidentschaft des nimmermüden Kulturapostels Hofrat Dr. Karl Kobald stand die erzieherische Aufgabe im Vordergrund. Die Museumsfreunde waren ein kleiner Kader geistiger Partisanen, die mit Vorträgen, Ausstellungsführungen und Kunstfahrten das Interesse weiter Kreise zu aktivieren trachteten.
Diese Gepflogenheit wurde beibehalten: Zweimal im Monat folgen Fachleute der Einladung des Vereins und halten kunst- und kulturhistorische Referate in einem Vortragssaal, den das Naturhistorische Museum zur Verfügung stellt, und das Programm der Kunstfahrten sieht jährlich etwa fünf Exkursionen nach Niederösterreich, Oberösterreich und dem Burgenland vor, wobei sich immer wieder interessante neue Kontakte ergeben.
Der derzeitige Mitgliederstand macht dem rührigen Präsidenten einige Sorgen: er beläuft sich auf rund achthundert Personen. Vor 1938 gab es fast doppelt so viele Museumsfreunde. Zum Vergleich: Eine Schwesterorganisation in Paris, die „Amis du Louvre”, umfaßtt mehrere tausend Mitglieder.
DENNOCH WURDE VIEL GELEISTET. Seit nunmehr elf Jahren kann der Verein der Museumsfreunde wieder seine wichtigste Funktion erfüllen, nämlich Werke anzukaufen. Der „Amtsweg” ist weitgehendst direkt angelegt, ohne Kompetenzhürden und organisatorische Zwischenstationen. Wenn ein Museumsdirektor oder Kustos im Kunst- und Antiquitätenhandel auf ein Werk stößt, das eine Bereicherung seiner Sammlung darstellen würde, aber als außertourliche Anschaffung finanziell für ihn nicht tragbar ist, wendet er sich an den Verein. In der Praxis verhält es sich so, daß die meisten Museen einen Vertreter als Fachbeirat in den Vorstand der Museumsfreunde entsenden. Die „Ankaufskommission” — ein recht anspruchsvoller Titel für das rasch arbeitende Team — entscheidet dann nach sachlichen und nicht zuletzt nach finanzpolitischen Gegebenheiten über die Erwerbung. Der Verein selbst bringt aus eigenen Mitteln jeweils bis zu 40.000 Schilling auf; übersteigt der Kaufpreis diese Summe, dann unternimmt Dr. Allmayer-Beck, wie schon erwähnt, seine Pumptour durch die Generaldirektorenbüros der Privatwirtschaft und der Geldinstitute.
Die Liste der Objekte, die seit 1952 erworben wurden, reicht von einem campanischen Trinkgefäß aus dem 4. Jahrhundert v. Chr., das nun in der Antikensammlung des Kunsthistorischen Museums zu sehen ist, bis zu einem Gemälde von Frans Masereel für das Museum des 20. Jahrhunderts. Das Museum für Österreichische Volkskunde kam durch den Verein zu einigen interessanten Tiroler Votiv- tafeln; Dr. Victor Luithlen, Leiter der Sammlung alter Musikinstrumente in der Neuen Hofburg, fand ein Piano aus dem Besitz der Familie Köchert, auf dem Hugo Wolf einen großen Teil der „Italienischen Reise” und der „Goethe-Lieder” komponiert hatte. Dr. Allmayer-Beck und seine Getreuen griffen zu — heute steht das Instrument in der Sammlung, auf seinem würdigsten Platz. Die Reihe der Erwerbungen ließe sich fortsetzen, kann man doch die „Schätze” der Museumsfreunde im Historischen Museum der Stadt Wien, im Barockmuseum, in der Weltlichen Schatzkammer, in der Albertina und im Österreichischen Museum für angewandte Kunst bewundern. Jedes Objekt ist eine „Haben”- Buchung für Österreichs Kulturkonto.
Der besondere Stolz der Museumsfreunde aber ist jenes kleine byzantinische Emailtäfelchen mit der Darstellung des heiligen Johannes, das auf dem Kunstmarkt sehr hoch notierte und nach einer diplomatisch durchgeführten Sammelaktion für das Kunsthistorische Museum angekauft werden konnte.
Nicht selten verhindert der Verein durch sein Eingreifen, daß wertvoller
Kunstbesitz aus Nachlässen seinen Weg ins Ausland nimmt. Als 1956 eine Privatsammlung von Renaissancebronzen aufgelöst wurde, waren sieben Kleinplastiken zu haben. Fünf erwarb das Kunsthistorische Museum aus eigenem und wandte sich gleichzeitig mit der Bitte an den Verein, die beiden anderen, nicht minder bedeutenden Stücke zu sichern. Fazit: alle sieben Bronzen blieben in Wien.
AUCH „HINTER DEN KULISSEN” ist der Verein tätig, mit Leistungen, die nicht ins Auge fallen, die für die praktische museologische Arbeit aber wichtig sind. So regte Dr. Luithlen an, Musik auf alten Instrumenten als musikwissenschaftliche Dokumentation auf Band aufzunehmen, doch die Sammlung besaß kein Gerät und konnte sich budgetär keines leisten.
Dr. Allmayer-Beck sagte nicht nein und zweigte die erforderliche Summe für die Anschaffung eines Magnetophons ab. Ein andermal stehen Subventionen für den Druck von Ausstellungskatalogen zur Debatte oder Zuschüsse für erforderliche Restaurierungsarbeiten in Spezialwerkstätten.
Entscheidende Bedeutung aber erlangte das Wirken dieser Gemeinschaft von Idealisten in einer, man sollte meinen untergeordneten, sekundären Frage.
1958, bei den Vorbereitungen zu der großen Ausstellung „Vom Altertum zum Mittelalter” im Kunsthistorischen Museum. Kritischen Blickes musterten die Kustoden die vorhandenen alten Vitrinen, in denen die frühmittelalterlichen Ausgrabungsfunde, namentlich der berühmte Goldschatz von Nagy-Szent Miklos, ihren Platz finden sollten, und sie fällten einmütig das Urteil: für eine nach modernen Gesichtspunkten gestaltete Schau nicht mehr verwendbar. Der Voranschlag für die etwaige Neuanschaffung wies 120.000 Schilling aus, eine bedenkliche Hürde bei der kühn vorangetragenen Planung. Auf der Haben-Seite des Museums stand dem präsumtiven Soll eindeutige Kassenebbe gegenüber. Die Alternative der Experten lautete: entweder neue Vitrinen oder keine Ausstellung. Als sich der Verein der Museumsfreunde bereiterklärte, einen Teil der erforderlichen Summe, nämlich 60.000 Schilling, auf den Tisch zu legen, stand auch das Unterrichtsministerium nicht zurück und steuerte 45.000 Schilling bei. Den noch fehlenden Betrag stiftete ein Privatmann — anonym. Die neuen Vitrinen wurden bestellt.
Die Ausstellung, die fast an den teuren Glaswänden gescheitert wäre, wurde ein kulturelles Ereignis und fand im In- und Ausland großes Echo.
ALS LEIHGABEN DES VEREINS an die Museen sind die erworbenen Werke deklariert — de jure. De facto sind es aber Schenkungen, und in den Statuten der Mäzenaten ist auch für alle Fälle vorgesorgt. Der abschließende Paragraph, der sich mit der möglichen Auflösung der Körperschaft befaßt, enthält die eindeutige Bestimmung, daß im Falle der Liquidation alle „Leihgaben” in das Eigentum der betreffenden Sammlungen übergehen.
Die Kulturpartisanen bleiben im Hintergrund, achthundert Menschen, die sich den unzeitgemäßen Luxus leisten, Idealisten zu sein. Ein winziger Bruchteil der Gesamtbevölkerung Österreichs. Doch auf den Waagschalen unseres kulturellen Lebens wiegen sie oft schwerer als die massive Wucht des sogenannten „breiten Publikums”.