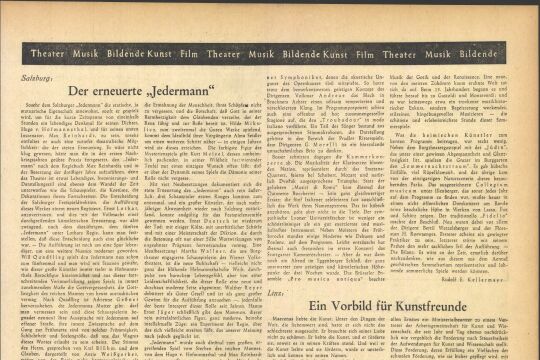Im Jahr 2003 hat sich die österreichische Museenlandschaft grundlegend verändert: In Wien wurde die Albertina wiedereröffnet, die Europäische Kulturhauptstadt Graz hat ihr Kunsthaus bekommen, im Mai wurde das Lentos Kunstmuseum Linz in Betrieb genommen und das Innsbrucker Landesmuseum Ferdinandeum wieder allgemein zugänglich. 2004 folgen in Wien das Liechtenstein Museum und in Salzburg das Museum auf dem Mönchsberg, 2005 das Museum des 20. Jahrhunderts. Wohin steuern Österreichs Museen? Redaktion: Cornelius Hell Wiener Ausstellungen erzielen Besucherrekorde, die Kunstmuseen werden zu Universalmuseen und kämpfen ums Überleben. Ein Konzept wird immer dringlicher. von maria rennhofer
Wien, die Stadt der Musik? Die Stadt des Theaters? Oder doch die Stadt der Museen? Die kulturellen Schwerpunkte scheinen sich allmählich zu verschieben. Zumindest zahlenmäßig hat die nahezu unüberschaubare Fülle von Sammlungen, Gedenkstätten, Ausstellungsinstitutionen (und was es sonst noch auf diesem Gebiet gibt) längst die Oberhand gewonnen. Und das Interesse ist nach wie vor enorm: Bei der vierten Langen Nacht der Museen wurden in 58 Wiener Museen 135.000 Besucher gezählt.
Die Nischen spezieller Interessen und Vorlieben sind inzwischen weitgehend besetzt. Vom Schnaps- bis zum Bestattungsmuseum gibt es kaum etwas, was es nicht gibt. Doch diese mitunter recht bizarren Etablissements sollen uns hier nicht weiter beschäftigen, sie finden ihr Publikum, werden nicht selten von Idealisten betreut und fristen mit Minibudgets - mit Schenkungen, Spenden und viel freiwilliger Leistung aufgebessert - ihr Dasein. Hier geht es um die großen Sammlungen, vor allem um jene, die sich mit Kunst beschäftigen.
Vollrechtsfähigkeit
Da ist in den letzten Jahren einiges in Bewegung gekommen. Ausgelöst einerseits durch die Entlassung der Bundesmuseen in die Vollrechtsfähigkeit, andererseits durch die Eröffnung oder Wiedereröffnung neuer Häuser ist eine heftige Diskussion um die Wiener Museumslandschaft entbrannt: Gibt es inzwischen viel zu viel Ausstellungsflächen in Wien? Wie kann man sich gegen einander abgrenzen und die Identität der einzelnen Sammlungen nach außen vermitteln? Ist der Konkurrenzdruck noch zu verkraften? Und vor allem: Geht der Zwang zum GeldVerdienen, also zu publikumswirksamen Ausstellungen, zu Lasten der seriösen Sammlungspflege?
Neueröffnungen
Ins Rollen gebracht hat die Diskussion die Eröffnung des lange umkämpften, verhinderten, von Querschüssen gefährdeten Museumsquartiers, speziell seiner beiden großen Häuser: Museum Leopold und Museum moderner Kunst. In diesem Jahr folgte die Neueröffnung der Graphischen Sammlung Albertina mit ihrem prunkvollen, wenn auch der einstigen Individualität weitgehend beraubten Ambiente für jene Kunst, die manchmal abschätzig als "Flachware" bezeichnet wird.
Im März 2004 folgt das Museum Liechtenstein, ein, so viel lässt sich jetzt schon prophezeien, besonders funkelndes Juwel in der Wiener Museumslandschaft. Das Gebäude wurde seit dem Auszug des Museums moderner Kunst restauriert, und Direktor Hans Kräftner ist dabei, die erlesene fürstliche Sammlung durch gezielte Ankäufe zu ergänzen (siehe Interview Seite 23). Wie groß bereits jetzt die diesbezügliche Neugierde ist, auch das zeigte sich in der besagten Langen Nacht, als 14.000 Besucher die Chance nützten, einen ersten Blick in die barocke Pracht des fürstlichen Palais zu werfen. Und ab 2005 soll das Museum des 20. Jahrhunderts als Dependance der Österreichischen Galerie Kunst nach 1918 in permanenter Präsentation zugänglich machen. Adaptierung und Umbau des von Karl Schwanzer 1958 als Weltausstellungspavillon geplanten Gebäudes für Museumszwecke rufen bereits jetzt die Gegner auf den Plan.
Etablierte Ausstellungsorte
Dazu kommen die etablierten Häuser mit langer Tradition: das Kunsthistorische Museum natürlich mit seinen diversen, aus habsburgischem Bestand hervorgegangenen Sammlungen, oder die Österreichische Galerie Belvedere, die in diesem Herbst ihr 100-Jahr Jubiläum begangen hat. Das Museum für angewandte Kunst, um dessen Sammlung es bedauerlich still geworden ist, das Wien Museum (vormals Historisches Museum der Stadt Wien) oder das Jüdische Museum, die immer wieder mit kunsthistorischen Ausstellungen Aufmerksamkeit erregen. Weiters Ausstellungsorte wie das Kunstforum, die Kunsthalle Wien, die Secession oder (zumindest bis vor kurzem) das Künstlerhaus. Und man möge mir alle verzeihen, die in dieser Aufzählung ausgelassen wurden.
Sie alle "machen in Kunst" und müssen/sollen/wollen mit Kunst Geld verdienen. Denn der Staat hat sie in die Freiheit entlassen. Doch diese Freiheit hat, wie alles, zwei Seiten. Früher ist ein Museum - im Extremfall - am besten über die Runden gekommen, wenn es möglichst wenig Aktivitäten unternommen hat: das Budget war gesichert, zusätzliche Einnahmen, etwa durch Ausstellungen, mussten ans Ministerium abgeliefert werden. Erinnert man sich etwa 20 Jahre zurück, so bildeten Sonderausstellungen die Ausnahme, besucht wurde ein Museum primär wegen seiner Sammlungen, und das nur von jenen Unerschrockenen, die alle Schwellenängste gegenüber der weihevollen Atmosphäre souverän zu überwinden vermochten. Heute hat sich die Situation umgekehrt: Mit Ausstellungen macht man Besucherrekorde und dementsprechend Kohle. Die Sammlungen sind höchstens etwas für Touristen.
Staat zieht sich zurück
Eine nicht ungefährliche Tendenz, wissen inzwischen nicht nur österreichische Museumsexperten und -direktoren wie Gerbert Frodl von der Österreichischen Galerie Belvedere, der beim Symposion zum Jubiläum seines Hauses vor übertriebener Ausstellungshysterie warnte und betonte, dass das Herz eines Museums die Sammlung sei. Bei derselben Gelegenheit warnte auch der Präsident des internationalen Museumsrates Jacques Perot vor der Gefahr, dass Museen sich nur auf Besucherzahlen und Einnahmen konzentrieren und dabei vergessen, dass sie eine Sammlung haben, die gepflegt und bearbeitet werden muss.
Individuelles Profil gefordert
Besonders verwirrend wird es, wenn das Ausstellungsprogramm nicht wirklich mit der Sammlung und deren Inhalten korreliert. Edvard Munch - auch seine Malerei - in der Graphiksammlung Albertina? Die phantastischen Architekturmodelle Santiago Calatravas im Kunsthistorischen Museum? Otto Mühl im MAK? Die Frage nach einem individuellen Profil, nach einer klar definierten Position der einzelnen Häuser wird immer dringlicher. Und führt so weit, dass sich manch einer die Ordnungsfunktion des Staates zurückwünscht. Denn die Wiener Kunstmuseen entwickeln sich durchwegs zu Universalmuseen.
Ein Bespiel: Wo soll man heute hingehen, wenn man Schiele sehen will: In die Österreichische Galerie? Ins Museum Leopold? Ins Wien Museum oder doch in die Albertina? Aus der Tradition seiner Sammlung hat jedes der genannten Häuser Anspruch auf seinen Bestand. Eine großzügige Reform könne nur bei einer Sammlungsbereinigung ansetzen, meinte Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder anlässlich einer vom Wiener Depot veranstalteten Podiumsdiskussion. Ähnliches wurde in Paris realisiert, wo der Louvre, das Musée d'Orsay oder das Centre Pompidou Werke ausgetauscht haben. In Wien hat man ähnliches bei der Auflösung der Stallburg-Galerie unternommen, deren Bestände an verschiedene Sammlungen verteilt wurden. Dennoch: Wäre es sinnvoll, gewachsene Strukturen aufzulösen und thematische Gliederungen vorzunehmen? Ein erster Schritt in die richtige Richtung wäre die Akzeptanz territorialer Grenzen im Ausstellungsbetrieb.
Generell sollten Museen also nicht mit Ausstellungshäusern und Kunsthallen in Konkurrenz treten. So erfrischend sich der vor allem durch Sonderausstellungen erzielte Publikumszuwachs auf die Belebung der Häuser ausgewirkt hat: Besucherzahlen dürfen nicht als einziges Kriterium für die Qualität eines Museums zählen. Ganz abgesehen davon, dass der internationale Leihgaben-Wanderzirkus längst an seine Grenzen gestoßen ist. Blockbuster-Shows, die immer wieder dieselben Publikumsmagneten zum Inhalt haben, führen sich in Zeiten des internationalen Kulturtourismus ohnedies irgendwann ad absurdum. Und vielleicht gibt es ja doch ein Publikum, das auch an Neuentdeckungen und nicht nur an der affirmativen Wiederholung von Bekanntem interessiert ist. Letztlich sind es vielleicht doch die traditionellen musealen Tugenden Sammeln, Bewahren, Erforschen, die à la longue das Renommee garantieren.
Kein Museumskonzept
Doch der Gegenwind wird schärfer, und woher sollen die benötigten Mittel kommen, wenn der Bund die Basisfinanzierungen mehr oder weniger eingefroren hat? Ein Teil der gesetzlichen Aufgaben könne auf diese Weise nicht mehr erfüllt werden, grollte Generaldirektor Wilfried Seipel vom Kunsthistorischen Museum und zog die Konsequenz: Das Palais Harrach, Schauplatz regelmäßiger Sonderausstellungen des KHM, wird 2004 aufgegeben. Museumsdirektoren - längst sind ihre wirtschaftlichen Fähigkeiten mehr gefordert denn ihre wissenschaftlichen - müssen ständig neue Geldquellen erschließen. Doch unkonventionelle Ideen wie der Verkauf von weniger wichtigen oder mehrfach vorhandenen Sammlungsbeständen sind verpönt.
Bleibt das Match um Publikum und Sponsoren, deren Treue täglich neu zu erkämpfen ist: mit Vermietung repräsentativer Räumlichkeiten, Events aller Art, Quotenbringern im Windschatten des Mainstream. Eigenständiges Profil hin oder her: Überleben ist alles. Kooperationen - eventuell mit Institutionen zukünftiger EU-Partnerländer - könnten weiter helfen. Und unverwechselbare Programmideen, Projekte, die Authentizität versprechen, statt austauschbarer Massenware. Die Infrastruktur einer differenzierten Museumslandschaft steht zur Verfügung. Auch wenn ein sinnvolles Museumskonzept weiter auf sich warten lässt.
Die Autorin ist Kulturredakteurin des ORF.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!