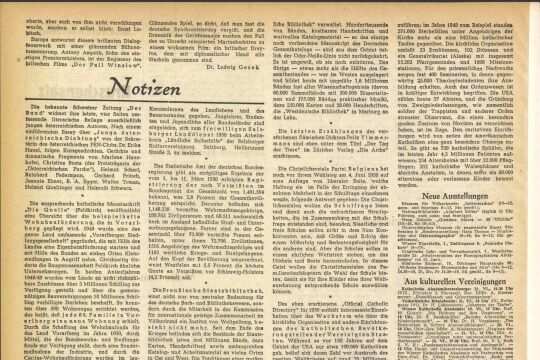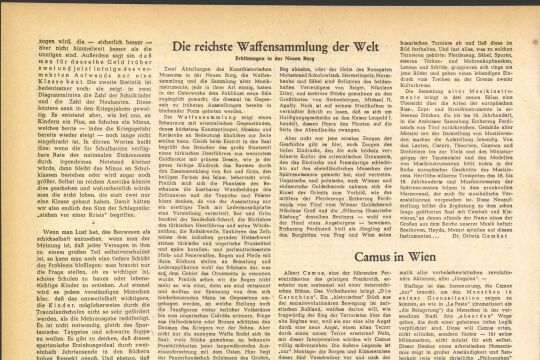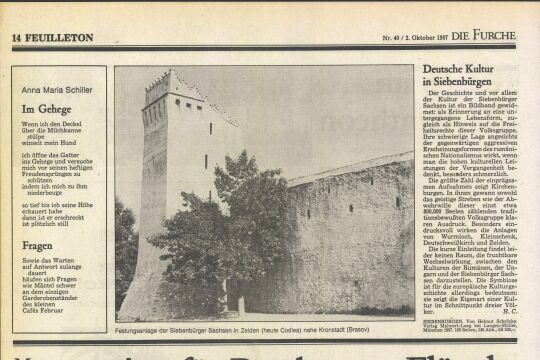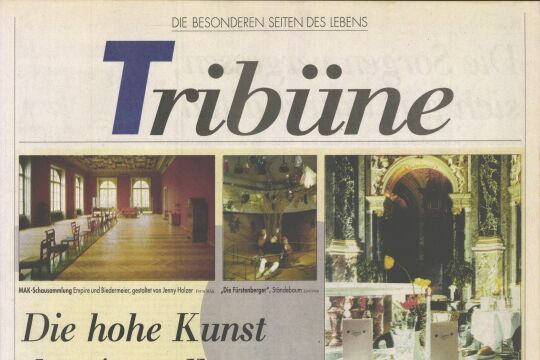Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Warum nicht autonom?
Mehr als zwei Millionen Besucher jährlich stellen ein Museum vor neue Aufgaben. Sind die alten Verwaltungsmethoden noch ausreichend, um dieser explosiven Entwicklung gerecht zu werden?
Mehr als zwei Millionen Besucher jährlich stellen ein Museum vor neue Aufgaben. Sind die alten Verwaltungsmethoden noch ausreichend, um dieser explosiven Entwicklung gerecht zu werden?
Das Interesse für Museen hat sprunghaft zugenommen. Jahr für Jahr weisen nicht nur Sonderund Landesausstellungen zunehmende Besucherzahlen auf. Auch die sechzehn Bundesmuseen (beziehungsweise 24, zählt man die Einzelabteilungen der großen Museen getrennt) erfreuen sich eines Besucherbooms wie nie zuvor. Besonders großen Zulauf hat das Hauptgebäude des Kunsthistorischen Museums in Wien.
Zählte man 1968 zum ersten Mal mehr als eine Million Menschen, die sich für den Besuch der in den Besitz der Republik übergegangenen Kunstsammlungen des Museums eine Eintrittskarte gekauft hatten, kommt man seit 1980 auf jährlich etwa zwei Millionen.
„Die Besucherzahlen”, vermerkt man dazu mit Genugtuung im Wissenschaftsministerium, dem mit Ausnahme des Heeresgeschichtlichen Museums alle Bundesmuseen „nachgeordnet” sind, „liegen demnach fast doppelt so hoch wie in den vier Bundestheatern. Im Museum des 20. Jahrhunderts waren sie während der Ausstellung der Gruppe ,Haus Ruk-ker' sogar so hoch, daß man die Leute wegen Uberfüllung der Schauräume nur in Schüben einlassen konnte.”
Trotzdem ist die wirtschaftliche Situation der Museen alles andere als befriedigend. Der Bauzustand des Naturhistorischen Museums mit seinen sechs Abteilungen ist sogar als katastrophal zu bezeichnen. 1984 stürzte von der Fassade dieses Ringstraßenprunkbaues eine Karyatide auf das Pflaster. Verletzt wurde niemand. Wenn nicht bald etwas geschieht, werden jedoch die Fensterverzierungen des Hoftraktes herabfallen.
Dafür ist zwar das Wissenschaftsministerium nicht zur Verantwortung zu ziehen, sondern das Bautenministerium. Aber, „was soll man tun” meint man bedauernd, „die budgetären Ansprüche der Zeit sind für uns um einige Nummern zu groß”.
Zu groß sind dem Ministerium im Regierungsgebäude allein die Kosten für die Installationen aller Art: beispielsweise für die Einleitung von elektrischem Strom. Nach wie vor verfügen deshalb weder die Prähistorische Abteilung mit dem wertvollsten Stück des Naturhistorischen Museums— der „Venus von Willendorf”, einer Kalksteinstatuette aus der Altsteinzeit —, noch die Anthropologische Abteilung über elektrische Stromzuleitungen. Das gleiche gilt für die großen Säle der Ägyptisch-Orientalischen Sammlung des Kunsthistorischen Museums. Die Folge: alle diese Abteilungen müssen an trüben Nachmittagen ihre Pforten schließen. Tatsächlich kann man die Exponate ohne künstliches Licht nicht gründlich betrachten.
Dafür experimentiert man im Canaletto-Saal des Kunsthistorischen Museums mit diversen Beleuchtungsmethoden, die stromsparend sind und zugleich optimales Licht geben sollen. Das heißt, die neuen Lichtträger haben das natürliche Tageslicht ein-zubeziehen, dürfen keine Schatten werfen und müssen Spiegelungen ausschließen.
Ähnliches soll auch in der Schatzkammer durchgeführt werden, in der die Insignien und Kleinodien des Heiligen Römischen Reiches allen modernen
Museumsansprüchen entsprechend dargeboten werden sollen, wenn diese Sammlung in drei Jahren neu ausgestellt sein wird.
Der Grund für das ungleiche Verhältnis zwischen Glanz und Elend liegt im System, im Organisationsschema, in der gesetzlichen Gebundenheit, in dem Begriff „nachgeordnete Dienststelle” mit all den daraus resultierenden Konsequenzen: der nicht autonomen Verwaltung des Budgets.
Dieses Budget zerfällt in zwei Teile: eines für den Personalaufwand und eines für Anlagen (darunter versteht man sogenannte im Museum bleibende Güter zum Unterschied von den laufenden Kosten). So beträgt der Personalaufwand für alle 24 Museen für das laufende Jahr 187 Millionen Schilling und für die Anlagen noch einmal 68 Millionen Schilling. Davon entfallen, um nur einige Beispiele zu nennen, auf das Kunst- und Naturhistorische Museum je 4,250.000 Schilling, auf das Museum für Völkerkunde 1,300.000 Schilling, auf die Moderne Galerie 5,500.000 Schilling und auf die Albertina, die vom Schwiegersohn der Kaiserin Maria Theresia, dem Herzog Albert von Sachsen-Teschen 1776 gegründete graphische Sammlung mit derart weltberühmten Werken wie Dürers „Feldhase”, „Das große Rasenstück” und „Die Mutter des Künstlers”, bloß 1,300.000 Schilling. Dazu kommen pro Museum noch einmal 7 Millionen Schilling (Kunsthistorisches Museum), 7 Millionen Schilling (Naturhistorisches Museum), 8 Millionen Schilling (Moderne Galerie) und 2 Millionen Schilling (Albertina) für die Verbrauchsmittel. Dazu gehören die Rechnungen für Beheizung, Telefon und Beleuchtung, das Schreibpapier, die Schreibmaschinen und die Sessel für das Sekretariat, technische Einrichtungen für Labors und Studiensäle, Scheinwerfer, Kassetten, Sicherheitseinrichtungen, Ausstellungen, Kataloge, Werbematerial und die Ankäufe.
Sämtliche Einnahmen fließen allerdings nicht der Dienststelle, sondern dem Staat zu.
Ein weiterer Nachteil besteht in der Verpflichtung, daß für jeden Neuerwerb in der Höhe von mehr als 15.000 Schilling auf dem Amtsweg die Zustimmung der vorgesetzten Behörde einzuholen ist. Verfügt die zuständige Abteilung im Ministerium über das entsprechende Bargeld, wird diese Zustimmung zwar so gut wie nie verweigert, doch es vergeht unter • Umständen zu viel Zeit. Zeit, in der autonom verwaltete, finanziell kräftigere ausländische Museen längst den Kauf abgeschlossen haben.
Im Naturhistorischen Museum und teilweise auch im Museum für Völkerkunde, wo die Sammlungen kaum durch Kauf, sondern primär im Zusammenhang mit eigenen Forschungstätigkeiten vermehrt werden, müssen für jede Expedition mit größeren Spesen ebenfalls erst Anträge gestellt werden.
Verschlimmert wird die Situation, die von einigen Abteilungschefs ^ls Misere, von anderen — zumindest nach außen hin — als alles in allem immerhin weit besser als in der Ersten Republik bezeichnet wird, durch die explosionsartige Entwicklung der Preise für Beleuchtung und Beheizung.
Auch ein zu guter Verkauf eines Katalogs bringt dem Museum nur Schaden und keinen Nutzen. Schließlich ist für die Herstellung eines Katalogs zwischen 350.000 und 400.000 Schilling, somit ein wesentlicher Teil der Budgetmittel eines durchschnittlich besoldeten Museums, zu bezahlen. Ist die Erstauflage vergriffen und läßt die „nachgeordnete Dienststelle” deshalb nachdrucken, ist sogar der Großteil des Budgets weg, ohne daß der Auftraggeber daraus für sein Museum einen finanziellen Nutzen haben könnte. Alle Einnahmen fließen ja — siehe oben - dem Staat Österreich zu.
Als weiteren Nachteil empfinden die teils freimütig weg von der Leber Redenden, teils sich zurückhaltend gebenden Direktoren das Faktum, daß sie ihre Geldmittel — sollen sie nicht verfallen — im jeweiligen Kalenderjahr aufzubrauchen haben. Diese aufgezwungene Geschäftsgebarung, die auch die zuständige Sektion im Wissenschaftsministerium bedauert, macht jedes Sparen auf ein bestimmtes, etwas teureres Werk unmöglich. Es wirkt sich auch auf die Teilnahme an Kunstauktionen großen Stils lähmend aus.
Aus all diesen Gründen blicken die Abteilungsleiter der Bundesmuseen neidvoll auf ihre amerikanischen Kollegen, die als echte Manager von Privatunternehmen zwar jedes Risiko — auch das einer schlecht besuchten Ausstellung oder eines im Wert fallenden Kunstwerkes — zu tragen haben, dafür aber im Rahmen ihrer Einnahmen und Ausgaben schalten und walten können, wie sie wollen. Die ihrem Museum nicht nur aus den verkauften Eintrittskarten — bei uns beträgt der Preis für eine Karte je nach Sammlung zwischen zwanzig und dreißig Schilling -, sondern auch aus Führungen, dem Verkauf von Katalogen, Kunstdrucken und Repliken finanzielle Mittel zuführen und zudem über genügend Personal verfügen.
Bei uns hingegen muß jeder Dienstposten vom Restaurator bis zum Portier, vom Abteilungschef bis hin zum Wächter bewilligt werden. Viel zu oft bleibt ein Ressort deshalb unterbesetzt — ob aus wirklicher Sparsamkeit oder weil die Bevölkerung gegen die Vermehrung beamteter Dienstposten ist, wird als Staatsgeheimnis gehütet. In der Praxis aber sieht es so aus, daß etwa das Kunsthistorische Museum sobald Not am Mann ist, einen Restaurator aus der Akademie am Schillerplatz beschäftigt. Auch wenn er teurer kommt als ein fix Angestellter. Oder: daß in der Albertina von den neun Museumswächtern fünf auch am Samstag und am Sonntag Dienst tun müssen. Und das bedeutet für die Betroffenen, daß sie in der Urlaubszeit und bei Ausfällen durch Krankheit sechs Wochen lang keinen freien Tag haben.
In Wien gibt es ein einziges Museum größeren Formats, das nach einem freieren Modell, etwa nach amerikanischem Muster, geführt wird: das österreichische Museum für Volkskunde. Es gehört dem Verein für Volkskunde. Das Personal wird vom Bund bezahlt, alles andere liegt in der Verantwortlichkeit des Vereins. Und obgleich dieses so vorzüglich bestückte Institut nicht mit Besucherströmen auftrumpfen kann, dürfen sich seine Neuerwerbungen sehen lassen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!