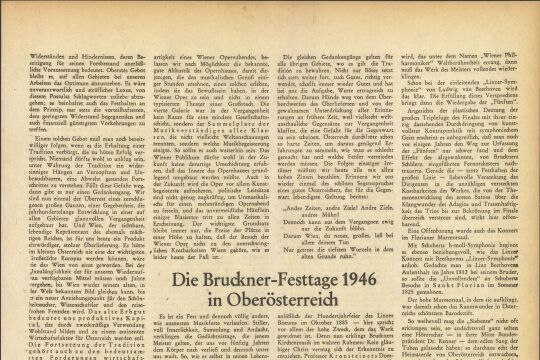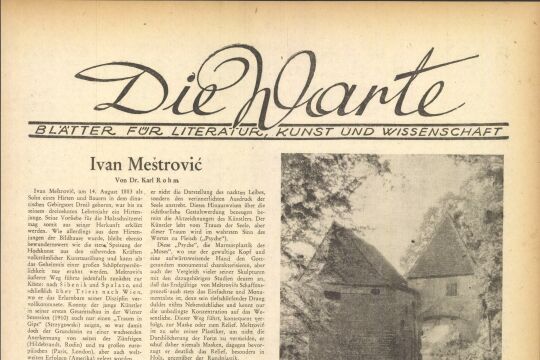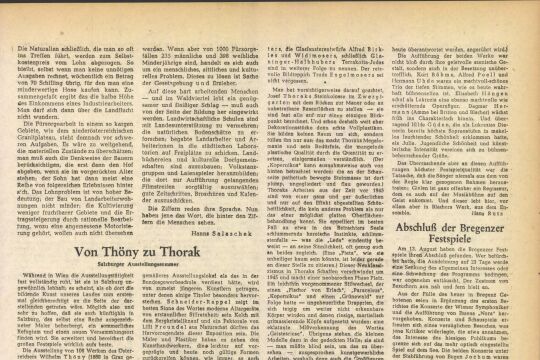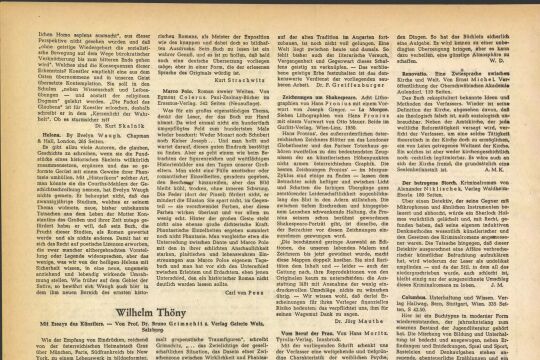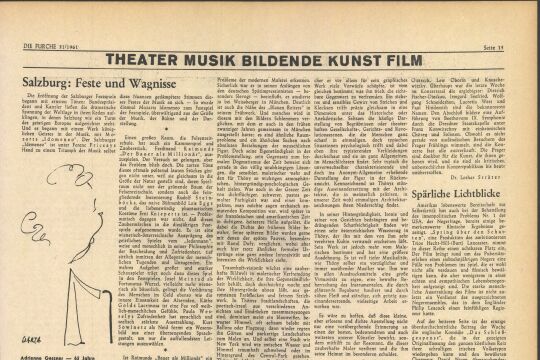Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Kunst der Mitte
h aus der Fülle der graphischen Produktionen vielleicht deutlicher ablesen als aus seinen Gemälden.
h aus der Fülle der graphischen Produktionen vielleicht deutlicher ablesen als aus seinen Gemälden.
Hans Fromus ist — vor allem eben auch im Hinblick auf sein graphisches Werk — einer der eigenständigsten Künstler unserer Zeit. In jedem seiner Blätter ist er „er selbst“. Er, der schon im den spätem zwanziger Jahren „seinen Kafka" entdeckte, zu einer Zeit, da hier noch keineswegs ein verlegerdsches Geschäft vorauszusehen war — und de facto mußten ja diese Kafka-Blätter dann auch jahrelang ln der Schublade verborgen bleiben —, hat sich niemals den ephemeren Tagesmoden assoziiert. Der biederen Kunstwelt des ausgehenden 19. Jahrhunderts, die die Dinge, wie sie sind, als durchaus „in Ordnung“ befand, oder sich das zumindest einredete, setzte er die „unheimliche" Welt Kafkas und Trakls entgegen, der heutigen Avantgarde, die die aus dem Recht der Kunst auf Protest gewonnene Freiheit für ihre Perversionen, den Kult des Nur-Ekelhaften etwa, mißbraucht, eine bei aller Aggressivität beinahe stille Vornehmheit, die trotz ihrer schonungslosen Unbestechlichkeit auch noch die Würde des „Gerichteten“ respektiert und seine allerletzten Blößen milde überdeckt.
Den völlig rat-und sinnlosen formalen Konstruktionen der Gegenstandslosen oder Abstrakten — deren Anliegen sich freilich aus dem gänzlichen Verlust des formalen Gewissens im 19. Jahrhundert erklären läßt und somit eine historisch bedeutsame Funktion erfüllt — stellt er seine durchaus konkreten Landschaften und Porträts gegenüber, zu denen im Grunde ja auch die „Ima- ' ginären Porträts", Bildnisse bedeutender historischer Persönlichkeiten von der Antike bis in die jüngste Vergangenheit, zu rechnen sind, die — trotz der sie oft beherrschenden Mehrdeutigkeit und trotz des sie umlagernden Dunkels — ebenfalls immer ganz konkrete, in ihrer Individualität oft sogar übersteigerte Züge tragen sowie die „Porträts“ der einsamen Hügel, Gehölze und Wasserläufe seiner ehemaligen steirischen Waldheimat beziehungsweise der verlassenen Donauauen um Wien, die dem Künstler seit seiner Übersiedlung nach Perch- toldsdorf als vorzügliche Studienobjekte dienen; den grotesken Panoramen bunt zusammengewürfelter, mit photographischer Treue wiedergegebener Gegenstände der Surrealisten und ihrer Nachfolger eine in sich geschlossene und durchaus einheitliche Bildkonzeption.
Die Kunst Hans Fronius’, so unverwechselbar persönlich und eigenwillig sie sich gibt, ist also eine „Kunst der Mitte". Es geht ihm weder um die bloße Form — denn erst durch das gleichsam „Erzählende“ des Inhalts, das ja vielleicht tatsächlich in einer gewissen Nachbarschaft zum „Literarischen' in der weitesten Be deutung dieses Begriffes lebt (protestiert man dagegen, dann müßte man auch gegen Rembrandt protestieren!), wird das Anliegen der Form in ein allgemein menschliches Anliegen übersetzbar —, noch geht es ihm um die bloße Faktizität des Inhalts, der ja seinerseits erst wieder in der Form jene eigentümlich schwebende — paradoxerweise „verinnerlichte“ — Freiheit erlangt, die die eigentliche Wirksamkeit eines Kunstwerkes ausmacht; es geht ihm immer um das konkrete Ganze aus Inhalt und Form. Ein Auseimander- halten von „Form“ und . „Inhalt“, oder auch nur von „Sinn“ und „Technik“ wird daher auch schlechthin unmöglich. Man könnte ebensogut die nachtwandlerische Sicherheit in der Beherrschung der technischen Mittel für die reizvolle, oft zugleich aber geradezu „besessene“ Flüchtigkeit seines Striches verantwortlich machen wie das Drängen der „Vision“.
Denn um „Visionen“, das heißt um unmittelbare Erlebnisse der inneren Anschauung, handelt es sich hier ja immer. Ihr eigentlicher Inhalt ist im letzten die Tragödie des Daseins auf der Bühne des Lebens selbst (nicht umsonst hat Hans Fronius 150 Theaterprogramme und rund 50 literarische Werke „illustriert“) mit allen seinen makabren, grotesken, aber auch der Schwermut hilfloser Schönheit entstammenden Zügen. Die Ausgeliefertheit der menschlichen Existenz, die Ausgesetztheit des Seelischen, Wahnsinn, Verwirrung, Schicksal, Schuld — Schuld, die aufgehoben scheint, zugleich aber bestehen bleiben muß — begegnen uns hier auf Schritt und Tritt, die Zeitlichkeit alles Seins überhaupt, das gleichwohl in einem einzigen über zeitlichen Augenblick, im Augenblick des „Gerichts“, sein innerstes'Wesen enthüllt. Von daher nehmen auch manche Landschaften des Künstlers jenes eigentümliche, selbst in der Dämmerung noch klare, apokalyptische Licht.
Was nun für die Graphik von Hans Fronius gilt, hat im wesentlichen auch für seine Ölbilder Geltung, die übrigens sogar motivlidi in engem Kontakt zu den Zeichnungen stehen. Auch unter den Ölbildern nehmen die einsamen Aulandschaften einen relativ breiten Raum ein. Der größeren Gewichtigkeit? des Materials entsprechend, wendet sich Hans Fronius hier allerdings auch dem „Städteporträt“ zu. Eines der ersten Städtebilder ist das schöne, aber wenig bekannte Gemälde „Blick auf die Spitalskirche in Mödling“, das bereits aus den frühen sechziger Jahren stammt. „Das zerstörte Hamburg", „Pirano“, „Prag“, „Frankfurt am Main“, „Cordoba" folgen in den nächsten Jahren. Die „Imaginären Porträts“ treten innerhalb der Ölbilder zunächst hinter den „echten“ Porträts (in diesem Ausdrude soll natürlich keine Abwertung der „Imaginären Porträts“
anklingen!) zurück: „Werner Kraus“, „Dr. Fritz Novotny“, „Nanna“, „Meine Mutter“, „Die Geschwister“, „Friedrich Welz“, „Wolfgang Gurlit“ und das großartige, erst in jüngster Zeit entstandene Porträt eines Freundes, im entfernten, wie übrigens manche seiner Porträts und vor allem auch seine früheren Städtebilder an Oskar Kokoschka erinnernd, wenn auch „flüssiger“ und ohne dessen kalte Farben und harte Kontraste. Eine Sonderstellung nehmen wohl die beiden Fassungen des bekannten Gemäldes „Das große
Schiff“ ein, mit seinen gedämpften, harmonischen, aber unerhört lebendigen Farben und seinem wirklichkeitsnahen, aber dennoch zeitlosen Thema dais klassische Ölbild schlechthin — „Kunst der Mitte“ im eigentlichsten Sinn des Wortes.
Was nun im besonderen die aller- jüngste malerische Produktion anlangt, so sind es vor allem zwei rein äußerlich vollständig voneinander unabhängige Themen, die Hans Fromus immer wieder beschäftigten: das Porträt der Stadt Toledo (während des Jahres 1968 und zu Anfang 1969 sind etwa ein halbes Dutzend Toledo-Bilder entstanden) und das „Imaginäre Porträt“ (wenn man so sagen darf, obgleich diese Bezeichnung hier nicht ganz zutrifft) des Dulders Hiob.
Die meisten der heuer entstandenen Toledo-Bilder zeigen (auf die Perspektive der herrlichen Radierung von 1967 zurückgreifend) die Stadt vom jenseitigen Ufer des Flusses: aus verworrenen Tiefen emporwachsend, schickt Toledo seine dunklen, bizarren Türme zum Himmel, ein Sinnbild des himmlischen Jerusalems, das der Mensch immer aufs neue erträumt und verfehlt, in der Schwermut des Verfehlen aber noch von der Schönheit des Geträumten berührt. In farblicher Hinsicht macht sich gerade bei den jüngsten Toledo-Bildern ein gänzliches Verschwinden jenes eigenartigen Gr autonies bemerkbar, der vor allem für die Ölbilder der letzten Jahre charakteristisch wair, nun aber wieder einer kühneren Farblichkeit Platz macht — obwohl die einheitliche tonige Gebundenheit des Ganzen keineswegs aufgegeben wird. Die pastos und reichlich aufgetragene Farbe leuchtet jetzt in dunkler Glut, ohne freilich der schwärzlichen Trockenheit mancher Ölbilder Fmfl Noldes auf der einen Seite, noch der gif tilgen Glätte mancher moderner Lasuren auf der anderen Seite auch nur in die Nähe zu kommen.
Ist nun Toledo, jene henlliche, aber immer noch aus tausend Wunden blutende Stadt — die Ereignisse während des langen Bürgerkrieges haben ja auch hier kaum wiedergutzumachende Schäden angerichtet —, die Stadt als solche, so ist Hiob der Mensch schlechthin. Ein gewisser Zug zur Verallgemeinerung (innerhalb des allein mit den Mitteln der Farbe eine unerhörte räumliche Suggestion vermittelnden Ölbildes wohl durchaus erlaubt, und durch die bis zum Anachronismus individuelle Gestaltung der Nebenfiguren in gewisser Weise auch wieder aufgehoben) macht sich daher bei den diversen Fassungen des Hiob- Problems — die ebenfalls alle aus dem Jahre 1968 und den ersten Monaten des heurigen Jahres stam-
men — bemerkbar imd verlernt aer Gestalt des „Hiob“ eine besondere Bedeutung. Denn im Grunde zeigt sich ja gerade in der Gestalt des Leidenden nicht nur der Abgrund des menschlichen Daseins, sondern auch seine Glorie. Ist das Dunkel, das viele der „Imaginären Porträts“ umgibt, auch nicht jenes faktische Dunkel, das mit dem Licht schlechthin nichts mehr zu tun hatte, sondern — gerade in seiner Absolutheit dem Licht verbunden — „Nicht- Licht“, wie Reinhold Schneider sagt, so wird das eigentliche Wesen des Lichtes wohl erst hier sichtbar; erst von hier fällt das Licht in jene unfaßbar vielfältige und verstrickte Welt aller jener Könige und Kaiser, Dichter und Wahnsinnigen, die dem Hiob in der Phantasie des Künstlers zur Seite stehen und vorausgegangen sind, und macht auch die Herkunft des Lichtes im Nicht-Licht deutlich.
Denn im letzten verweist die Gestalt Hiobs auf die Gestalt des „Ecce homo“, der sich Hans Fronius freilich nur in wenigen Blättern in unmittelbarer Weise nähert — in der Zeichnung „Religiöse Kunstausstellung“ etwa begnügt er sich mit einer [ gleichsam indirekten Gestaltung, wie er sie in ähnlicher Weise übrigens auch in einem seiner jüngsten öl- bilder, einer Kreuzigungsgruppe, in ä der er nicht die Gestalt des Gekreuzigten, sondern nur dessen Füße darzustellen wagt, zur Anwendung bringt. Einzig und allein in christlichem Sinne also läßt sich jene Botschaft, daß die Apothese des Leidens, dessen Herrlichkeit schon beginnt, noch ehe es aufgehört hat, Leiden zu sein, die Apothese des menschlichen Daseins selbst ist.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!