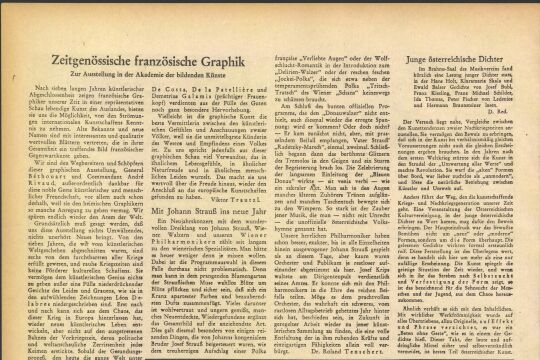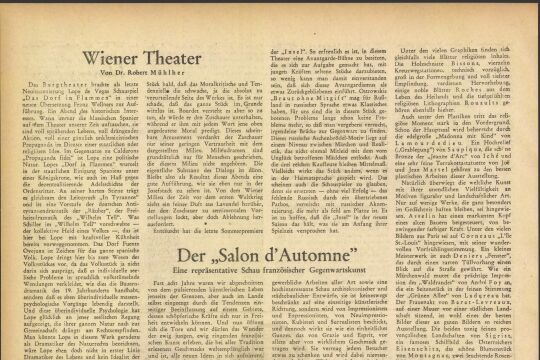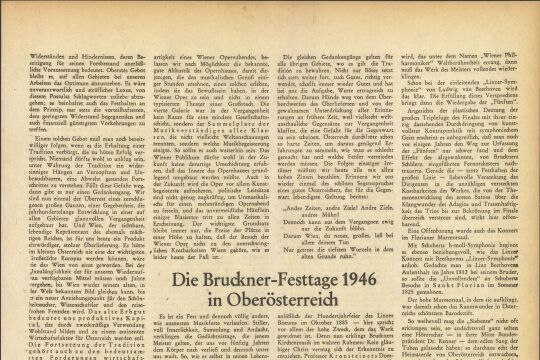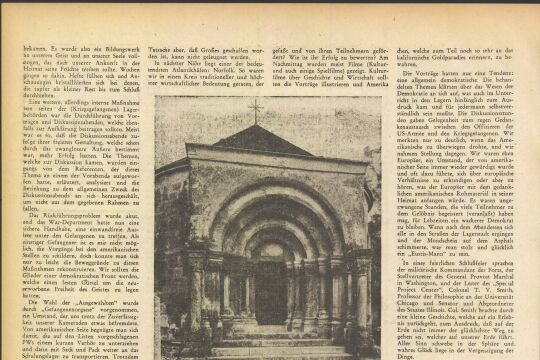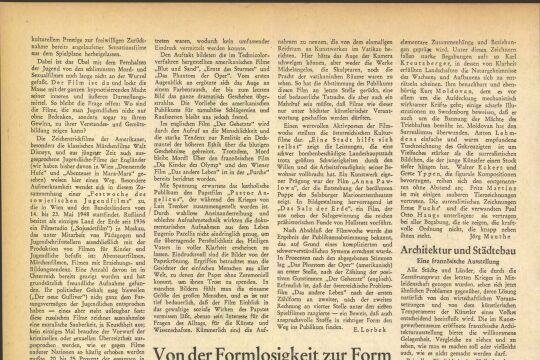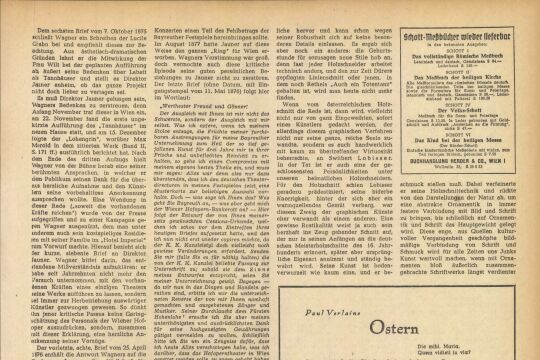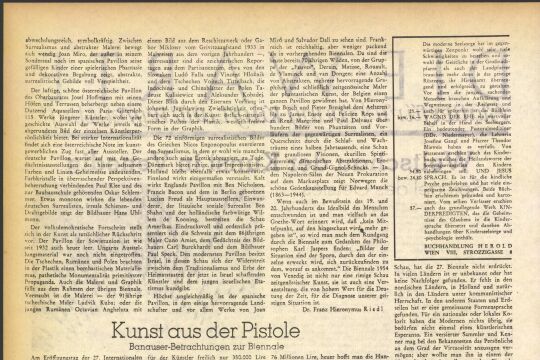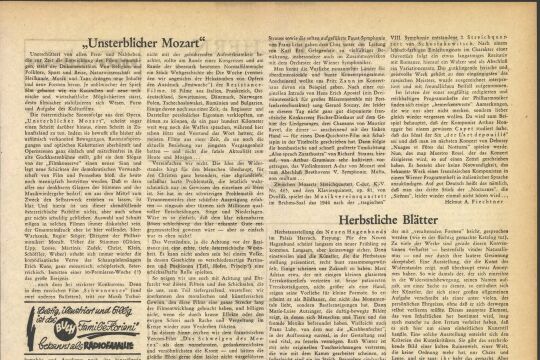Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Rückblick auf die „Moderne
Mehr als zwanzig Nationen — jene hinter dem Eisernen Vorhang sind nicht dabei — haben heuer die XXV. venezianische Biennale mit den ausgesuchten Werken ihrer Künstler beschickt. Die Zahl der ausgestellten Bilder und Plastiken ist kaum abzuschätzen; hingegen ist bekannt, daß in den ersten vier Wochen seit der Eröffnung etwa 50.000 Menschen, unter ihnen viele Österreicher, die Sperrgitter passierten. Mit einem Wort: diese Biennale — ergänzt durch eine Reihe von Parallelausstellungen an anderen Orten — ist eine Monsterexposition.
Natürlich gehört auch heuer das Ausstellungsgelände an der langen Riva den Modernen. (Ausnahmen bilden der spanische Pavillon, dessen Inhalt dem eines mittelmäßigen Salons der achtziger Jahre gleicht, der jugoslawische, der hauptsächlich heroisch die Fäuste ballende Arbeiterfiguren in öl und Bronze zeigt, und wohl auch der Schweizer Pavillon, der allerdings durch die schönen, an Maillol erinnernden Plastiken Ernst S u t e r s eine gewisse Bedeutung erhält.) Alles andere, gleichgültig, ob es aus Kolumbien, Frankreich, Ägypten, Deutschland oder Israel kommt, ist ausschließlich modern. Modern in allen Variationen, auf jede erdenkliche Art und Weise. Ein kurzer Rundblick: Belgien zeigt eine vielbestaunte Gedächtnisschau für Paul Ensor, den fürchterlichen und vielleicht auch bösartigen Entschleierer, in dessen seltsam hellen und wunderschön gemalten Bildern sich die Welt als Hölle entpuppt, WP Menschen und Teufel — oder sind beides nur hohle Larven? — die gleichen Masken tragen. Im französischen Pavillon: kalte Landschaften Utrillos, in denen über Sackgassen, Straßenecken und Gartengittern ein steter fahler November zu herrschen scheint. Daneben B o n n a r d: aus der Realität wird die Form eliminiert, sie löst sich in Farb-protoplasmen auf, in korallenhafte Unterwasservegetationen von unwahrscheinlicher Pracht. Einige Schritte weiter und man steht vor den eisigen, farblosen Kristallisationen des längst schon entschwundenen Kubismus, wie ihn Braque und Picasso als Junge pflegten, den anarchischen Durcheinanderkompositionen der italienischen Futuristen, den erschütternden Ausbrüchen des deutschen Expressionismus, wie sie sich in den Werken des „Blauen Reiters“ spiegeln. Die kargen und doch starken Figuren Barlachs, die schizophrenen, schmerzhaften Halluzinationen zweier Schweden um die Jahrhundertwende: Joseph-s o n und Hill, die großen Hieroglyphen von Matisse — die Aufzählung nähme kein Ende. Diese unermüdlichen, immer wieder verzweifelt aufgegebenen und immer wieder aufgenommenen Anstrengungen, die Welt zu entschleiern, zu enträtseln, zu verwandeln, neue Welten zu schaffen und auch diese wieder in Farbe aufzulösen oder sie in Kuben zu erdrücken — wahrhaftig, sie bilden ein Schauspiel sondergleichen! Man könnte auch sagen: Ein babylonisches Sängerfest, bei dem herrlich gesungen wird, aber ein Sänger die Worte des andern nicht versteht. Was in der Theorie so schön als Ergebnis bestimmter Entwicklungstendenzen erscheint — bei der Betrachtung erweist es sich als unvereinbar, isoliert und fremdartig: die Kunst von Matisse und die Bilder E n s o r s sind voneinander und von den Figurationen Picassos und Klees weltenweit entfernt; und zwischen ihnen und Kandinsky im polnischen Pavillon fließt nicht ein kleiner venezianischer Kanal, sondern befindet sich ein Abgrund. Wahrhaftig, wenn sich Bewohner
DIE WARTE
SEITE 2 / NUMMER 31 29- JULI 1950 weit voneinander entfernter Himmelskörper zu einer interplanetarischen Kunstausstellung zusammentäten — sie könnte nicht viel anders aussehen als diese Biennale.
Die Perspektiven einer solchen Mammutschau wirken verzerrend. Vielleicht ist es ihnen zuzuschreiben, wenn der Besucher zu der Erkenntnis kommt — möge sie falsch sein! —, daß diese ganze Moderne im Grunde mit dem Lebenswerk einiger weniger großer Meister steht und fällt. Daß sie nur aus Spezialfällen besteht. Die Leistung Matisses, Picassos, Klees — jede von ihnen ein Spezialfall, eine ausgeschöpfte Möglichkeit, un-wiederholbar, nicht fortsetzbar. (Und man kann rings um sich schauen — es gibt keine Fortsetzer, vielleicht einige Begabte, die sich ihrerseits zu kunsthistorischen Spezialfällen zu entwickeln trachten. Aber was ist damit schon getan?) Niemand weiß, was nach den großen Meistern kommen soll, die jetzt allmählich aussterben — Bonnard ist tot, Klee ist tot, und die anderen sind siebzig und achtzig Jahre alt. Manche von ihnen haben vorzeitig ihre Kraft verlören, nachdem sie ihre Möglichkeiten erschöpft haben: de Chirico, der surrealistische Revolutionär, veranstaltet eine Protestausstellung gegen die Biennale mit Bildern, die wie parodistische und schlechte Kopien von Gemälden aus dem 17. Jahrhundert wirken, Carlo C a r r ä, der heroische Nihilist von dazumals, tritt mehr und mehr in den Schatten, und Seve-rini, dieser flammende Anarchist, hat sich ratlos den vielen jungen Italienern angeschlossen, die sich in sterilen formalistischen Abstraktionen verlieren. Das Fazit: eine Kunstepoche, der die „Neuheit“ eines Stils, einer künstlerischen Arbeit als wichtigstes Wertkriterium gilt, hat nichts Neues mehr zu bieten, nur das Neue von gestern noch einmal zu zeigen, das ja freilich in -vielen Fällen auch morgen noch seinen Reiz nicht verloren haben wird. Und so ist diese Biennale, nimmt man alles in allem, eine von Grund auf retrospektive Ausstellung: sie blickt auf die große Epoche der Moderne — zurück. (Im mexikanischen Pavillon, der die Sensation der XXV. Biennale bildet, kann man etwas studieren, was man gleichsam als das Krebsstadium der modernen Kunst bezeichnen könnte: die phantastischen Wucherungen und Blähungen der Formen in den riesigen Bildern O r o z c o s und S i q u e i-r o s. Daneben freilich auch die kraftvollen und in ihrer Art monumentalen Kompositionen T a m a y o s.)
Unter diesen Verhältnissen hätte die österreichische Kunst gewisse Chancen, unvermutet eine über die eigenen Landesgrenzen hinausgehende Bedeutung zu erlangen. Denn sie hat, soweit man das überhaupt feststellen kann, noch nicht den Boden unter den Füßen und die Zusammenhänge mit der Realität verloren. Sie verfügt zwar leider nicht über Selbstvertrauen, wohl aber über eine Unzahl von Begabungen, die keineswegs gewillt sind, sich in Trauer und Abstraktionsformalismus zu verlieren; und ihre gesunde Skepsis der Spielerei gegenüber — der im Augenblick sicherlich größten Gefahr für den Künstler — gewährt ihr gegenüber den Produktionen mancher anderer Nationen einen großen Vorsprung.
Das alles muß man aber wissen, ehe man nach Venedig kommt, denn dem österreichischen Pavillon ist das nicht zu entnehmen. Die Auswahl und das Arrangement der Bilder und Zeichnungen, die in ihm hängen, sind, gelinde gesagt, verfehlt. Die Bilder Herbert Boeckls in den beiden Haupträumen auszustellen — gewiß, das war von vornherein ohne weiteres zu begrüßen. Aber warum ließ man ihn nur seine alten, teilweise sogar schwächeren Bilder einerseits, und seine ganz neuen, fast abstrakten Werke andererseits zeigen? Beispiele seiner kraftvollen mittleren Periode fehlen ganz. Der Eindruck: unvermittelte Diskrepanz. Noch dazu hängen die Bilder zu dicht, zu hoch und in einem Licht, das sie fast grau erscheinen läßt. Kein Ausländer wird sich von der Kapazität dieses Malers auch nur eine schwache Vorstellung machen können. — In den kleineren Nebenräumen hängen viel zu viele Graphiken viel zu vieler Autoren in Reihen zu vier untereinander — und die meisten von ihnen noch dazu in Doppelpassepartouts! Man muß sich auf die Zehen stellen, um die obersten, und sich tief bücken, um die untersten zu sehen — und kann es kaum, denn im dichten Neben- und übereinander schlägt ein Blatt das andere tot. Außerdem hat man unbegreiflicherweise zusammengehörige Blätter voneinander getrennt: die Holzschnitte Margret Bilgers, die Zeichnungen Eckerts und Kreutzbergers muß man sich in allen vier Ecken zusammensuchen, die prächtigen Tierstücke Johannes B e h 1 e r s teilen das gleiche Schicksal. Ebenso unverständlich ist, daß man eher mittelmäßige und unbedeutende als charakteristische Arbeiten aus dem Oeuvre der einzelnen Künstler zusammengetragen hat: von Dobrowsky und Laske sind Aquarelle zu sehen, von denen man nicht glauben möchte, daß sie von diesen ausgezeichneten Malern stammten, stünde es nicht im Katalog; von je vier Moldovan- und F r o n i u s - Zeichnungen sind je zwei eher nebensächlich. Die Holzschnitte Werner Bergs wurden durch zu kleine Passepartouts jämmerlich verunstaltet und nicht einmal die Federzeichnungen K u b i n s entgingen dem bitteren Los, in häßliche TJoppelpasse-partouts gezwängt zu werden. (Einzig Wickenburg hat das Glück, seine meditativen Aquarelle nebeneinander und an einem günstigen Platz zu sehen.) Genug davon! Jeder einzelne der hier versammelten Künstler hätte mit einer ausgesuchten Kollektion selbst in dieser bedrückenden internationalen Konkurrenz in Ehren bestanden. Sie alle zusammen, in dieser Auswahl und Anordnung, bewirken nichts. Es ist, als ob man sie nicht gesehen hätte. — Bleiben noch die Arbeiten der Bildhauer, unter denen wir jene von Alexander Wahl bevorzugen: sie haben im kleinen Innenhof des Pavillons als einzige eine ihnen entsprechende Aufstellung gefunden. Bezeichnend, daß ihnen die italienische Fachwelt genau jene Anerkennung aussprach, die von Rechts wegen auch den Bildern und Graphiken unserer Künstler gegolten hätte...
So bleibt im Grunde der einzige Österreicher, der auf der Biennale einen unzweifelhaften Erfolg errungen hat, Professor H o f m a n n. Der Pavillon, den er schon vor vielen Jahren erbaut hat — ein kleines Meisterwerk moderner Architektur — ist nicht nur der schönste, sondern dank seiner klugen Innengestaltung auch der einzige Pavillon auf der ganzen Biennale, in dem angenehme — Kühle herrscht.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!