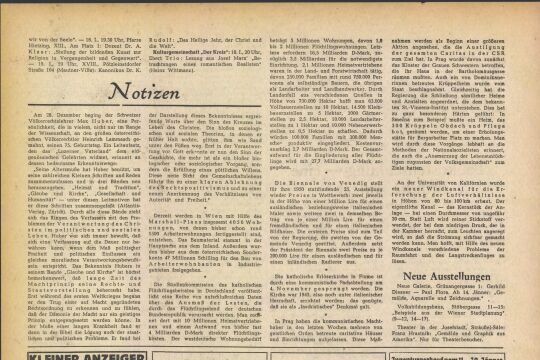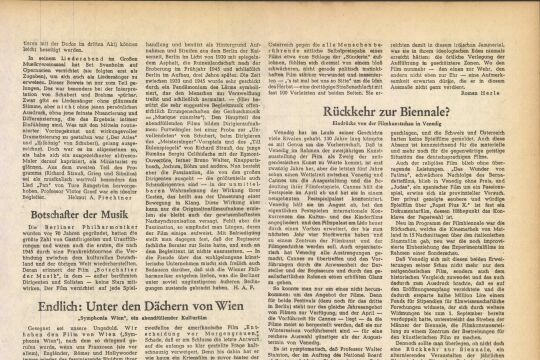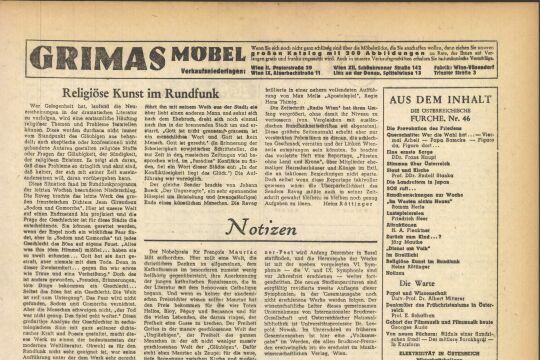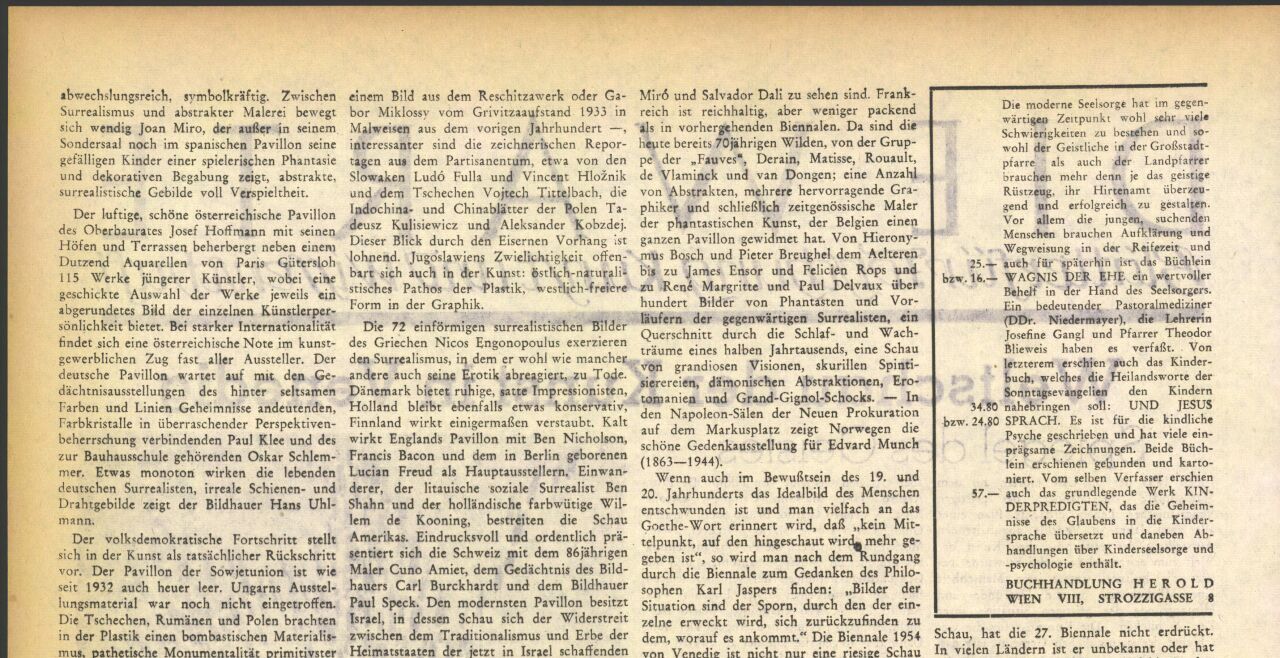
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Kunsi aus der Pistole
Am Eröffnungstag der 27. Internationalen Kunstausstellung in Venedig, der Welt größte moderne Kunstschau, geschah es einem Journalisten, daß er nach langer Wanderung durch die Säle und oberflächlicher Besichtigung einiger tausend Bilder und Plastiken (der Katalog spricht von 4000, aber eine gewissenhafte Zählung ergibt nur 3591) in den spanischen Pavillon geriet, wo ihm die leeren weißen Wände entgegenblickten. Die Spanier langen traditionsgemäß immer zu spät auf der Ausstellung ein, aber statt über dieses Versäumnis ungehalten zu sein, empfand der Journalist die ruhigen, weißen Flächen als wohltuend, und er erinnerte sich an den Ausspruch, den er einmal von dem italienischen Staatsmann Carlo Sforza gehört hatte: „Als Zwanzigjähriger gefielen mir sehr die üppigen Gemälde Tizians, als Fünfziger schätzte ich die Abstrakten; heute, da ich ein alter Mann bin, kann ich nur mehr die leeren Wände ertragen.“
Die Stille des Raumes war geeignet, einige Ordnung in die verwirrten Ideen zu bringen und lud dazu ein, die Füllt der Eindrücke zu überschauen. Es sprang die Erinnerung an den Saal entgegen, wo der Spazialkünstler Lucio Fontana mit nicht weniger als zwanzig Werken vertreten war, was die Annahme ausschloß, daß der Mailänder Maler nur in einem Anfall guter Laune der Kommission akzeptiert worden war. In dem offiziellen Katalog widmete ihm Giampiero Giani einige bewundernde Seiten, wo es unter anderem heißt: „Ein Loch, in einer gespannten Oberfläche, ist das letzte Ziel seiner Reise. Wie wohl versteht man die Bedeutung dieser Einsamkeit, dieser seiner Freiheit! Sie ist jene des alten Wortes: propter vjtam vivendi perdere causa — um zu leben, muß man die Gründe des LeTtens selbst verlieren.“ Die Spazialkon- zeptionen Fontanas gleichen dem Ergebnis von Schießübungen eines Pistolenschützen: eine glatte Leinwandfläche, in die mit einem spitzen Gegenstand in vielleicht sinnvoller Weise Löcher gebohrt wurden.
Von der Vorhalle des Hauptpavillons führt eine Nebentür mit der unauffälligen Aufschrift „Ufficio Vendita“ in einen kleinen Raum, der als Verkaufsbüro dient. Der nicht unwichtige kommerzielle Aspekt der Biennale und ihr Einfluß auf den Kunstmarkt wird von den ersten Besuchern zunächst nicht beachtet. Der Verkaufsbeamte ist daher auch rein theoretischem Interesse zugänglich, und so erfährt man, daß Lucio Fontanas Spazial- konzeptionen wohl verkäuflich sind, aber nur für die runde Ziffer von einer Million Lire. Das gleiche gilt für Virgilio Guidis „Meer- landschaft“, eine weiße Fläche mit einem waagrecht durchgehenden blauen Strich, wo für der Künstler freilich nur 350.000 Lire verlangt, während er die Farbflecken seines „Antiken Himmels“ mit 1,5 Millionen Lire bewertet. Ein Tiefrelief des Bildhauers Pericle Fazzini notiert mit 12 Millionen Lire, sein „Roßknecht“ wäre aber bereits um 3,5 Millionen Lire zu haben. Weit bescheidener als die Italiener notieren die Deutschen und Oesterreicher. Der auf der Biennale so erfolgreiche Wolfgang Hutter verlangt für sein bestes Bild nur 220.000 Lire.
Die Maler und Bildhauer haben dem Ver- kaufsbürö ihre Forderungen bekanntgegeben, das ..sie, ohne zu , diskutieren, in die Listen eingetragen hat. Die Bewertung ist also zunächst eine sehr subjektive Angelegenheit der Autoren selbst. Es drängt sieh die Frage auf, ob Fontana einen genug Kunstverständigen zu finden hofft, der ihm eine seiner Spazial- konzeptionen zum gewünschten Preis abkauft. Der Beamte glaubt auf Grund seiner jahrelangen Erfahrungen diese Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit nicht ausschließen zu dürfen. Vor einer Stunde war ein Geraune durch die anwesenden Kritiker. Journalisten und Künstler gegangen, das beträchtliche Aufregung verursacht hatte: Peggy Guggenheim, die reiche amerikanische Kunstsammlerin, hat soeben die Biennale betreten. Sie begab sich zu dem im amerikanischen Pavillon gebotenen Eröffnungscocktail, wo die alte, beleibte Dam von jungen Leuten mit prächtiger Haar- und Bartfülle und blassen Gesichtern umringt wurde.
Der Verkaufserlös der Biennale bat im Jahre 1950 61 Millionen Lire betragen, 1952
76 Millionen Lire, heuer hofft man die Hun- dertmüiionengrenze zu erreichen, denn das Grundthema der 27. Biennale, der Surrealismus, bietet eine gesunde kommerzielle Grundlage. Denn es schmeichelt dem Bourgeois — aber dies ist nur eine kaufmännische Erwägung —, nach langer Zeit wieder etwas auf den Bildern erkennen zu können. Ueber- raschenderweise erfährt man im Verkaufsbüro, daß die bekannten, großen Maler der älteren Generation, denen auch heuer ein Ehrenplatz im italienischen Pavillon Vorbehalten war, samt und sonders mit verkäuflichen Werken vertreten sind. Ihre Forderungen sind verhältnismäßig bescheiden: eine wundervoll bewegte Küstenlandschaft von De Pisis kostet 1,5 Millionen Lire, das beste von Carra 2,5 Millionen Lire, der schöne „Graue Morgen“ des guten alten Arturo Tost gar nur 600.000 Lire.
Der Journalist in dem leeren spanischen Pavillon hat eine Polsterbank gefunden und streckt die von der Wanderung und vom Scirocco müden Beine lang aus. In seinen Versuchen, Ordnung in die Eindrücke zu bringen, lächelt er zum zweitenmal bei der Erinnerung an Lucio Fontana, weil ihm vor dessen Spazialkonzeptionen ein Nestroy-Zitat in den Sinn gekommen war: „Kunst ist das, was man nicht kann; denn wenn man’s kann, ist es keine Kunst mehr.“ In der tiefinnersten Ueberzeugung, die Schießübungen Fontanas ohne besondere Schwierigkeiten nachahmen zu können, kommt er zu dem Schluß, daß der Maler ein witziger Bursche sein müsse.
Der Surrealismus, obwohl Leitmotiv der
Schau, hat die 27. Biennale nicht erdrückt. In vielen Ländern ist er unbekannt oder bat keine Nachfolger gefunden. Er fehlt in den nordischen Ländern, in Holland und natürlich in den Ländern unter kommunistischer Herrschaft. In den anderen Staaten und Erdteilen hat er eine gemeinsame Formensprache gefunden. Für ein nationales oder lokales Kolorit haben die Modernen nichts übrig, sie bedürfen nicht einmal eines künstlerischen Esperanto. Ein versierter Sammler und Kenner mag bei den Bekanntesten das Persönliche an dem Grad der Virtuosität anzusagen vermögen; aber wollte man ihn in einem der 32 nationalen Ausstellungen der Biennale plötzlich von der Augenbinde befreien, er wüßte nicht zu antworten, wo er sich befindet. Originell und aufschlußreich ist der belgische Pavillon, vor dessen Eingang die hohen Bronzefigureen zweier flandrischer Bäuerinnen in gesegneten Umständen stehen. Belgien hat versucht, den Surrealismus seines tüchtigen Magritte als nationale Tendenz darzustellen und in einer, wenn chon nicht lückenlosen, so doch genug vollständigen Reihe von Hieronymus Bosch über Peter Breughel, David Teniers, James Ensor und anderen abzuleiten. Aber gerade hier wird der Unterschied sofort klar. Der „Surrealismus“ des Bosch und Breughel hat seine Wurzeln in einem völlig wesensverschiedenen Weltbild, das Grausige ist hier nicht Zweck.
Die Versuchung des hl. Antonius, die bei den Belgiern dreimal dargestellt ist, bleibt das einzige Beispiel eines religiösen Themas unter den 3591 Werken der 27. Biennale. Der Katalog verzeichnet gewiß bei Israel ein Aufopferung Jakobs von Aharon Kahane, irgendwo eine hl. Cäcilie, aber cs handelt sich um "Werke ohne religiöse Absicht und mit einem beziehungslosen Titel, der ebenso K 2 sein könnte. Hingegen ist die politische Malerei recht zahlreich vertreten, und nicht einmal so sehr bei den polnischen, ungarischen, rumänischen und tschechoslowakischen Künstlern. Im italienischen Pavillon gibt es geradezu eine kommunistische Abteilung mit Purificato, Pizzinato und Guttuso als Oberpriestern. Wesensverwandt ist auch Carlo Levi mit seiner reichbeschickten Sonderschau „Christus hielt in Eboli“, polemisch, kalt und nicht einmal technisch einwandfrei. Von den tschechoslowakischen Malern stammt keiner aus diesem Jahrhundert, das gleiche gilt für Polens Graphiker Kulisiewicz und für die Rumänen — mögen ihre Geburtsdaten noch so kurz zurückliegen.
Die beiden retrospektiven Ausstellungen der Biennale, die von J. D. Gustave Courbet und Edvard Munch, wirken wie Offenbarungen wahren Künstlertums. Besonders die fast hundert Werke umfassende Sammlung Munch, zumeist aus staatlichen norwegischen Galerien stammend, hat in Venedig Sensation hervorgerufen, da Italien niemals Gelegenheit hatte, eine so reiche Schau des Malers beisammenzusehen. Der norwegische Kommissar der Abteilung, Leif Ostby, war einer der wenigen seinesgleichen, der sich die Mühe gab, die Besucher in das Werk einzuführen. Von ihm erfuhr man, daß einig Bilder der Galerie in Mannheim, die während de Hitler-Regimes als „entartete Kunst“ nach Norwegen abverkauft wurden, jetzt für den zehnfachen Preis nach Deutschland zu- rücfeverkauft werden konnten.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!