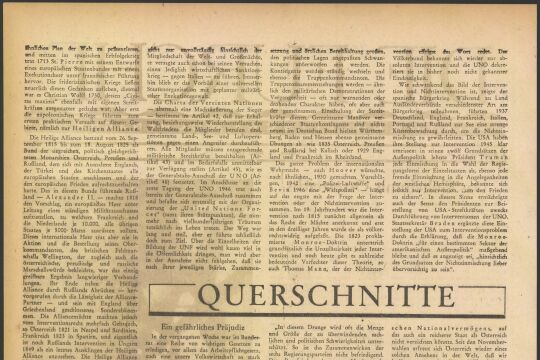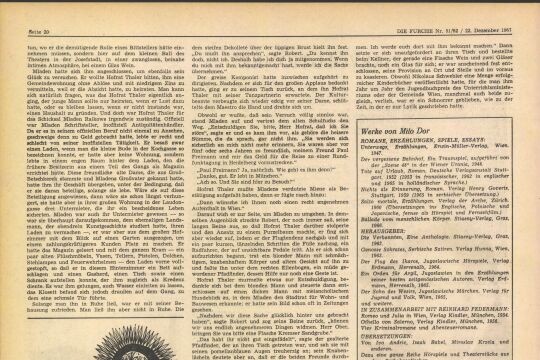Wie hinter einer Nebelwand
Vor 30 Jahren ist Joseph Roth in einem Armen-spital in Paris gestorben. Als der noch nicht Fünfundvierzigjährige auf dem Friedhof von Thoais beerdigt wurde, fanden sich an seinem Grab die verschiedenartigsten Menschen zusammen: Emigranten vor allem natürlich, Juden und Christen, Monarchisten und Linkssozialisten, Konservative und junge Revolutionäre. Sie alle liebten und verehrten Joseph Roth, den stets hilfreichen und freundlichen, der selbst oft in Geldnöten war, der aber immer noch versuchte, Ärmeren unter die Arme zu greifen, — und wenn er nicht mehr tun konnte, dann begleitete er neuangekommene Flüchtlinge auf die französischen Ämter und saß stundenlang geduldig mit den Ungeduldigen und Verzweifelten, bis sich irgendwo eine Tür auftat.
Vor 30 Jahren ist Joseph Roth in einem Armen-spital in Paris gestorben. Als der noch nicht Fünfundvierzigjährige auf dem Friedhof von Thoais beerdigt wurde, fanden sich an seinem Grab die verschiedenartigsten Menschen zusammen: Emigranten vor allem natürlich, Juden und Christen, Monarchisten und Linkssozialisten, Konservative und junge Revolutionäre. Sie alle liebten und verehrten Joseph Roth, den stets hilfreichen und freundlichen, der selbst oft in Geldnöten war, der aber immer noch versuchte, Ärmeren unter die Arme zu greifen, — und wenn er nicht mehr tun konnte, dann begleitete er neuangekommene Flüchtlinge auf die französischen Ämter und saß stundenlang geduldig mit den Ungeduldigen und Verzweifelten, bis sich irgendwo eine Tür auftat.
Er selbst war ein Unbehauster. Das Hotel war seine Heimat, seit Jahrzehnten. Dort, wo er schrieb, war er zu Hause. Und er schrieb und schrieb — unermüdlich, mit seiner winzigen, wie kalligraphierten, akkuraten Schrift. Vom Umfang seines dichterischen und schriftstellerischen Werkes gibt erst die 1956 — nicht etwa in seiner Heimat Österreich, sondern in einem deutschen Verlag, bei Kiepenheuer und Witsch in Köln — erschienene dreibändige Ausgabe eine Vorstellung. Sie umfaßt mehr als 2500 Seiten — und auch das Ist noch längst nicht alles, wenn auch das Wesentlichste. — Man kennt den „Radetzkymarsch“, „Die Kapuzinergruft“, den „Hiob“, vielleicht noch und dies oder jenes Feuilleton. Das Gesamtwerk Joseph Roths gilt es noch zu entdecken. Die Literaturprofessoren haben kaum Notiz von ihm genommen. Soll man Namen nennen? Wir wollen es nicht tun, sondern nur feststellen, daß in vielen Kompendien, ja sogar in Spe-zialwerken über die neuere deutsche und österreichische Literatur nicht einmal sein Name zu finden ist.
Dabei war Joseph Roth' ein echter, durchaus origineller Dichter, derwrfe wie der Herausgeber des ersten Joseph-Roth-Gedächtnisbuches sagt, „ein wundervolles Deutsch mit Silberstift und Flammenschwert“ schrieb. Joseph Roth war ein glanzvoller und hintergründiger Schriftsteller, dessen Prosa ebenso präzise wie magisch und melodisch ist, ein Dichter, der „aus östlich-dunkler Melancholie die herrlichsten Bilder aufblühen läßt“.
Denn der Osten, nicht der „ferne“, sondern der nahe, europäische, die östlichen Kronländer der Monarchie und das weite Rußland und Polen, sind immer als Hintergrund In seinen Büchern gegenwärtig. Auch als Schriftsteller hat er, außer von Stendhal und Flaubert, mehr vom Osten, speziell von Tolstoi und Gogol, empfangen, als von Deutschland und Österreich. Josep Roth ist, zumindest im deutschsprachigen Schrifttum, der Dichter und der Entdecker eines neuen Kontinents, des europäischen Ostens, wo Polen, Russen, Ukrainer, Juden, Deutsche und Türken bei- und nebeneinander wohnen. Diese Welt: diese Landschaft mit ihren Menschen und ihrer ganz besonderen Athmosphäre, ist nicht nur Stoff seiner Werke, sondern Roths Dichtertum kommt aus ihr, hier wurzelt er, als Mensch und als Schriftsteller.
Dies etwa ist eine Rothsche „Landschaft“ — wie er sie in der Studie „Juden auf Wanderschaft“ beschrieben hat:
„Die kleine Stadt liegt mitten im Flachland, von keinem Berg, von keinem Wald, keinem Fluß begrenzt. Sie läuft in die Ebene aus. Sie fängt mit kleinen Hütten an und hört mit ihnen auf. Die Häuser lösen die Hütten ab. Da beginnen die Straßen. Eine läuft von Süden nach Norden, die andere von Osten nach Westen. Im Kreuzvunkt liegt der Marktplatz. Am äußersten Ende der Nordsüdstraße liegt der Bahnhof. Einmal am Tag kommt ein Personenzug. Einmal im Tag fährt ein Personenzug ab. Dennoch haben viele Leute den ganzen Taa am Bahnhof zu tun. Denn sie sind Händler. Sie interessieren sich auch für Güterzüge. Außerdem tragen sie gern eilige Briefe zur Bahn, weil die Postkasten in der Stadt nur einmal täglich geleert werden. Den Weg zur Bahn legt man in 15 Minuten zurück. Wenn es regnet, muß man einen Wagen nehmen, weil die Straße schlecht geschottert ist und im Wasser steht. Die armen Leute tun sich zusammen und nehmen gemeinsam einen Wagen, in dem sechs Personen zwar nicht sitzen können, aber immerhin Platz finden. Der reiche Mann sitzt allein in einem Wagen und bezahlt für die Fahrt mehr, als sechs Arme. Es gibt acht Droschken, die dem Verkehr dienen. Sechs sind Einspänner. Die zwei Zweispänner sind für vornehme Gäste, die manchmol durch Zufall in diese Stadt geraten. Die acht Droschkenkutscher sind Juden, die ihre Barte nicht schneiden lassen, aber keine allzu langen Röcke tragen, wie ihre Glaubensgenossen. Ihren Beruf können sie in kurzen Joppen besser ausüben. Am Sabbat fahren sie nicht. Am Sabbat hat niemand etwas am Bahnhof zu suchen... Die Stadt hat zwei Kirchen, eine Synagoge und etwa 40 kleinere Bethäuser. Die Juden beten täglich dreimal... Die Händler und die andern im Leben stehenden Juden beten sehr schnell und haben noch hie und da Zeit, Neuigkeiten zu besprechen — und die Politik der großen Welt und die Politik der kleinen. Sie rauchen Zigaretten und schlechten Pfeifentabak im Bethaus. Sie benehmen sich wie in einem Kasino. Sie sind bei Gott nicht seltene Gäste, sondern zu Hause. Sie statten ihm nicht einen Staatsbesuch ab, sondern versammeln sich täglich dreimal an seinen reichen, armen, heiligen Tischen...“ •
Aus dieser Welt stammt Joseph Roth. Er wurde am 2. September 1894 in Schwabendorf bei Brody in Wohlhynien geboren. Er besuchte das humanistische Gymnasium in Brody und studierte, mit Unterstützung von Verwandten, zuerst in Lemberg, dann in Wien Germanistik. Von 1916 bis 1918 war er an der Front. Roth wäre als Offizier beim Heer geblieben, aber er war kein Freund der Revolution und auch kein begeisterter Republikaner. So wählte er den freiesten Beruf — und wurde Journalist, zunächst in Wien, dann in Berlin. Hier schrieb er von 1921 bis 1924 für den „Börsen-Courier“, das „8-Uhr-Abendblatt“ und den „Vorwärts“. Von 1923 bis 1932 war Joseph Roth ständiger Mitarbeiter der „Frankfurter-Zeitung“ und schrieb nebenher noch für eine ganze Reihe anderer angesehener deutscher Blätter. In diesen Jahren ging es ihm materiell am besten. — Nachdem er seine ersten Schriften in kleineren Verlagen publiziert hatte, kam er 1929 zu Gustav Kiepenheuer. Hier veröffentlichte er als erstes Buch „Links und Rechts“, 1930 den Roman „Hiob“ und zwei Jahre später sein erstes Erfolgswerk „Radetzkymarsch“. — Aber schon am 30. Jänner 1933 ging Joseph Roth in die Emigration. Diese Veränderung war für ihn nicht so einschneidend, wie für viele andere Dichter und Schriftsteller. Denn Roth hatte bereits in dem vergangenen Jahrzehnt ein Nomadenleben geführt. Als Auslandskorrespondent und Reisefeuilletonist der „Frankfurter Zeitung“ lebte er kaum länger als einige Wochen in derselben Stadt. Er war in Wien und Salzburg, Marseille und Nizza, Amsterdam, Ostende und Brüssel, in Lemberg und Warschau — und immer wieder in Paris, das ihm zur zweiten Heimat wurde. Hier wohnte er im Hotel Foyot — das übrigens auch Rilke beherbergt hat und wo der hochbegabte junge französische Dichter Raymund Radiguet gestorben ist. Als das alte Hotel Foyot abgerissen wurde, zog Roth in das gegegenüberliegende Hotel Tournon, das auch während der Emigrationsjahre sein Stammquartier war.
In jenen Jahren, von 1933 bis zu seinem plötzlichen Tod, veröffentlichte Joseph Roth in den Verlagen Allent de Lange und Querido in Amsterdam und schrieb Feuilletons, Reiseberichte und Artikel für die Blätter „Der Christliche Ständestaat“ in Wien, das „Neue Tagebuch“ in Paris, ferner für das in deutscher Sprache erscheinende „Pariser Tagblatt“ und das Zentralorgan der österreichischen Legitimisten „österreichische Post“. Denn Joseph Roth war in seinen letzten Jahren überzeugter Monarchist. Er, der in seinen ersten Büchern, deren eines den bezeichnenden Titel „Rebellion“ führt, die Auflösung und Unordnung unserer Welt, die verlorene kleine Existenz geschildert hatte, wurde in späteren Jahren zum laudator tem-poris acti, zum Sänger vergangener Zeit und ihrer Größe. Zwar, das Thema seines Hauptwerkes hatte er selbst gewählt, aber erst sein Verleger riet ihm, den Kaiser persönlich auftreten zu lassen. „Schreibend wurde er Monarchist, abhängig, so — nach dem Wort Goethes — von den Figuren, die er schuf. Schreibend wurde Roth auch fromm. Da er glauben wollte, wurde er — vielleicht — gläubig.“
Ein Schleier von Trauer und Melancholie liegt auch über Roths beiden Hauptwerken, dem „Radetzky-marsch“ und der „Kapuzinergruft“. Der passive Held des ersten Romans ist der Enkel eines wirklichen Helden, jenes Trotta von Sipolje, der nach der Schlacht von Solferino dem Kaiser das Leben gerettet hat. Seither ruht auf dem mit dem Adelsprädikat ausgezeichneten slowenischen Bauerngeschlecht die kaiserliche Huld. Aber über dem Leben des letzten Trotta, des Leutnants Carl Joseph, steht ein Unstern: er fühlt sich als Werkzeug in der Hand des Unglücks, da er „teils anderen den Untergang bereitete, teils mitgezogen ward von denen, die untergingen“. Sein Tod an der Front während der ersten Kriessjahre fällt mit dem seines Vaters, des Bezirkshauptmannes, und dem des Kaisers fast zusammen. Diese letzten Szenen des Buches, die gleichsam von einem herbstlichen Regen verschleiert werden, und das 18. Kapitel, das den Besuch des Vaters beim Kaiser in Schönbrunn schildert — sind Glanzstücke, nicht nur in diesem Roman, sondern überhautit im Werk Roths. Mit dem Tod des Leutnants Carl Joseoh von Trotta erlischt die direkte Linie, an deren Anfang der Held von Solferino stand. — „Die Kapzinergruft“ setzt den „Radetzky-marsch“ nicht nur zeitlich fort, sondern stellt in den Mittelpunkt auch einen entfernten Vetter von Carl Joseph. Die Handlung umsmnnt die Jahre 1914 bis 1939. „Der Tod kreuzt schon seine knochigen Hände über den Kelchen, aus denen wir tranken“: dieser Satz könnte als Leitmotiv über der Schilderung jener letzten Monate vor dem Krieg stehen. Die Sympathie dieses zweiten Trotta — mit dem sich der Autor weitgehend identifiziert — gehört den östlichen Kronländern der Monarchie, in denen auch der Hauptteil der Handlung spielt. Von dieser Welt hebt sich scharf die Schilderung des hektischen Nachkriegs-Wien ab mit seinen abenteuerlichen und makabren Typen, mit denen das Schicksal des jungen Trotta durch seine lebenshungrige Frau verknüpft ist. Die ganze Handlung und die Personen des Buches sind vom Ende her gesehen, das er in einer gespenstischen Szene schildert: es ist die Nacht nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in Wien.
Doch zurück zu der Welt, aus der Joseph Roth kam:
Meine traurigsten Erlebnisse verdanke ich meinen Wanderungen durch die Moldowanka, das Judenviertel von Odessa. Da geht ein schwerer Nebel herum, wie ein Schicksal, da ist der Abend ein Unheil, der aufsteigende Mond ein Hohn. Die Bettler sind hier nicht nur die übliche Fassade der Straße, hier sind sie dreifache Bettler, denn hier sind sie zu Hause. Jedes Haus hat fünf sechs, sieben winzige Läden. Jeder Laden ist eine Wohnung. Vor dem Fenster, das zugleich die Tür ist, steht die Werkstatt, hinter ihr das Bett, über dem Bett hängen die Kinder in Körben — und das Unglück wiegt sie hin und her. Große vierschrötige Männer kehren heim: es sind die jüdischen Lastträger vom Hafen. Inmitten ihrer kleinen, schwachen, hysterischen Stammesgenossen sehen sie fremd aus, wie eine wilde barbarische Rasse, unter alte Semiten verirrt. Alle Handwerker arbeiten bis in die späten Nachtstunden. Aus allen Fenstern weint ein trübes gelbes Licht. Das sind merkwürdige Lichter, die keine Helligkeit verbreiten, sondern eine Art Finsternis mit hellem Kern. Sie sind nicht verwandt mit d<em seoens-reichen Fever. Sie sind nur Seelen von Dunkelheiten...“