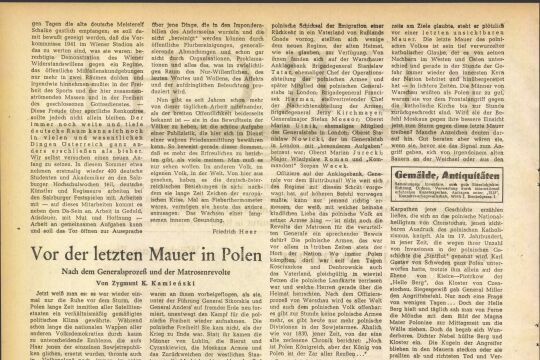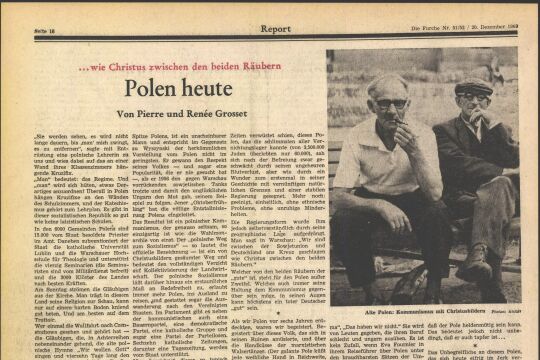Still ziehen die Wasser von Weichsel und Bug. Wer im Westen vernimmt noch ihre Botschaft. Kaum einer hört ihren Ruf. Und dabei sind beide genau so europäische Schicksalsflüsse wie der ferne Rhein und die einst heißumstrittene Marne. Vergessen, Unwissenheit und Indolenz haben ihren Vorhang vor den Ländern und Menschen des Ostens gesenkt, einen Vorhang, der vielleicht noch dichter ist als jener „Eiserne”, den die Weltpolitik zog.
Darum ist es gut, daß einige deutsche Verlage uns auch dieses Jahr wieder Botschaft geben, daß an Weichsel und Bug nicht die Welt zu Ende ist.
Allen voran muß der Verlag Kiepenheuer & Witsch in Köln genannt werden. Ihm verdankt schon so mancher polnische Autor den Zugang zum deutschsprechenden Leserpublikum. Auch diesmal eröffnet er den Reigen. Sergiusz Piaseckis Ballade vom wilden, gesetzlosen Leben der Schmuggler in den weiten Wäldern diesseits und Jenseits der polnisch-russischen Grenze vor 1939 ist uns noch in Erinnerung (vgl. „Die Furche”, 3. August 1957). „Der Geliebte der großen Bärin” muß sein Publikum gefunden haben, sonst würde der Verlag kaum die Übersetzung eines zweiten Buches desselben Autors, der heute im Westen, schon etwas in den Jahren, von einem Abenteurerleben ausruht, vorlegen. In der „STRASSENBALLADE” (Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln, 344 Seiten. 16.80 DM) erweist sich Piasecki erst richtig als der polnische Sprecher der „verlorenen Generation” der zwanziger Jahre unseres Jahrhunderts. Wilna ist der Ort der Handlung. Während die polnische Inflationsmark immer höher klettert, Spekulanten die Restaurants und Vergnügungsstätten dieser eben für Polen gewonnenen (heute wieder verlorenen) Stadt bevölkern und ein träges Kleinstadtbürgertum sein von der Weltgeschichte unterbrochenes Alltagsleben aufnimmt, sitzt ein junger, abgerüsteter Freiwilliger, dessen Heimat jenseits der russischen Grenze blieb, auf dem Pflaster. Hungrig, ohne Arbeit und ohne Unterstand. Das zwielichtige Milieu der Billardkneipen und Kleinstadtspelunken nimmt den jungen Menschen, dessen hohe Ideale von Vaterland, Freiheit und Kameradschaft .in acht Tagen des Elends und der Verlassenheit in Scherben gingen, auf. Er wird einer jener „edlen Räuber”, deren hohes Lied die Literatur zu allen Zeiten gesungen hat. Er schröpft durch gefälschte Wechsel bedenkenlos die Reichen, ist gut zu den Armen, erweist sich dankbar den Frauen, ist überdies das, was man einen „ganzen Kerl” nennt.
Der Roman — er trägt ohne Zweifel autobiographische Züge — wäre als polnischer Beitrag zum „antibürgerlichen Protest” der Kriegsgeneration von 1918 heute wahrscheinlich Makulatur, wehte nicht aus jeder Zeile zeitlos der heiße Atem des schrecklich-schönen Lebens, spräche nicht ein Erzähler zu uns, der über die Jahrzehnte hinweg sein Publikum durch die Kunst. Menschen aus Fleisch und Blut vorzustellen, anzusprechen vermag. „Ob es wohl einen Sinn hat, euch mit meiner Erzählung aufzustören aus einem satten, behaglichen Leben — mit einer Erzählung von jenen Entwaffneten”, so fragt der Autor , selbst am Schluß sein zeitgenössisches Publikum. Die Frage gilt um so mehr auch uns. Ja, es hat einen Sinn, und sei es auch nur den Piasecki erzählen zu hören. Erzählen und nur erzählen. Auch durch die Straßen und über die Plätze der Stadt Wilna weht der Wind den Geruch der weiten, unübersehbaren Wälder. Der Anruf der großen Freiheit. Wäre es nicht ein wenig abgeschmackt, könnte man den bei uns wenig bekannten Piasecki einen Hemingway des Ostens nennen. Auch für ihn ist die Deckung zwischen Leben und geschriebenem Wort oberstes Gesetz.
Achthundertfünfzehn Seiten eines Romans zu bewältigen, sind für einen zeitgenössischen Leser keine Kleinigkeit. Dazu noch ein Personenverzeichnis, das die Zahl Hundert beinahe erreicht — die Nebenfiguren ausgenommen. An Zeit sind die Jahre zwischen 1918 und 1939 zu durchmessen. Weit zurück und tief in östliches Land führt der Autor. Odessa ist die Szene, da der Vorhang sich hebt. Man schreibt das
Jahr 1918. Von den damals an Zahl gar nicht so geringen polnischen Bewohnern dieser Stadt machen sich Freiwillige auf, um zu den Legionen des Generals Haller zu stoßen. Polonia restituta. Es soll wieder einen unabhängigen polnischen Staat geben. Das ist der Ruf, dem sie folgen. Wenn der Vorhang für den Leser nach einer Lektüre von beinahe tausend Seiten sinkt, stoßen die deutschen Panzerkeile tief in polnisches Land hinein vor. Man schreibt 1939. Finis Poloniae. Wieder einmal. Jaroslaw Iwaszkiewicz hat es sich zum Ziel gesetzt, in „RUHM UND EHRE” (Albert-Langen-Georg-Müller-Verlag, München, 815 Seiten, 17.80 DM) den Roman des Zwischenkriegspolen und der Auflösung seiner spätfeudalen Gesellschaft zu schreiben. Intime Kenner der Situation werden hinter diesem oder jenem Namen
— etwa hinter dem des Hauslehrers Kazimiera Spychala, der als Geliebter der Fürstin Bilinska zum leitenden Beamten des Warschauer Außenministeriums aufsteigt — einstige Akteure erkennen, ohne daß das vorliegende Buch den Charakter eines Schlüsselromans hat. Iwaszkiewicz geht es um die Beschwörung einer Gesellschaft, deren Träger jederzeit den Mut zum Sterben aufbringen, aber nicht die Kraft, den polnischen Staat durch eine neue politische und gesellschaftliche Struktur Dauer zu geben. Iwaszkiewicz ist nicht Kommunist. Der heutige Präsident des polnischen Schriftstellerverbandes steht aber bei «einen Landsleuten in dem Ruf, ein „guter Schwimmer” zu sein. Darunter versteht man in Volkspolen einen Mann, der durch alle Fährnisse geschickt durchzumanövrieren versteht und die Gabe des Überdauerns besitzt. Geht darauf das „Weihrauchopfer” zurück, das der Autor, nachdem er sein Buch weithin von jeder plakathaften Tendenz freizuhalten verstand, auf den letzten zwanzig Seiten den in seiner Heimat herrschenden Zeitgeist streut? Mitten im Chaos des polnischen Zusammenbruches 1939 greifen allein einige beherzte Kommunisten zum Gewehr. Diese „Handlung” ist mindestens um zwei Jahre vprverlegt. Im Zeichen des Molotow-Ribbentrop-Abkommens standen 1939 auch die polnischen Kommunisten Gewehr bei Fuß. Ganz zu schweigen von der Tatsache, daß sich ja zur gleichen Zeit damals vom Osten eine andere Armee in Richtung Bug und San über die niedergewalzten weißroten. Grenzpfähle hinweg in Marsch setzte … Was bleibt: Die Beschwörung einer Welt, über die längst die Schatten gefallen sind und
— dies erscheint uns vor allem für den deutschen wie für alle deutschsprachige Leser am bedeutungsvollsten: die Erinnerung daran, daß es auch für viele Polen, darunter den Autor, eine verlorene Heimat im Osten gibt. Eine verlorene Heimat, in die zurückzukehren, sich allerdings keiner mehr Hoffnung macht und niemand, sei es in der Emigration, sei es zu Hause, Illusionen nährt.
Wo Iwaszkiewicz endet, nimmt J. Klein- Harparash den Faden der Erzählung in seinem Roman „… DER VOR DEM LÖWEN FLIEHT” (S.-Fischer-Verlag, Frankfurt, 879 Seiten, 26 DM) auf. Allein diese Bestimmung ist rein zeitlich. Der heute in Israel lebende Bukowiner spinnt ein ganz anderes Garn als der Pole. Dort der Versuch, ein großes nationales Epos zu schaffen, hier die frischfröhliche Kavalkade. Polen hat kapituliert und ist zum viertenmal geteilt. Diesmal zwischen Hitler- Deutschland und der Sowjetunion. In dieser Situation entschließt sich der Chef des rumänischen Geheimdienstes, einen Mann besonderen Vertrauens in die russisch besetzten Gebiete Ostpolens zu entsenden, um über die nächsten Pläne der Sowjets rechtzeitig informiert zu sein. Das ist keine Aufgabe für einen gewöhnlichen Agenten. Sein Auge fällt daher auf Lutz Aida, einen Gutsbesitzer aus der Bukowina, den wir als wahren Tausendsassa kennenlernen. Im Sattel ebenso gerecht wie im Umgang mit schönen Frauen, jeder gefährlichen Situation gewachsen, listenreich wie weiland Odysseus. Und ein Helfer der Bedrängten ist er obendrein. Daß er nebenbei auch das Haupt einer weitreichenden ,Schmuggler- kette ist, kann nur Menschen mit allzu großen menschlichen Vorurteilen stören. Dem Ablauf der — zugegeben äußerst spannenden — Handlung erweist sich dies nur als förderlich. Unnütz eigentlich, zu sagen, daß Aida die Mission annimmt…
Überflüssig, zu betonen, daß unser Held diese Aufgabe bravourös meistert.
Für den Titel des Buches wurde der Prophet Arnos bemüht. In seinem 5. Buch beschwört dieser düsteres Geschick:
„Wie wenn einer vor dem Löwen flieht,
Und ein Bär begegnet ihm, und er kommt ins Haus
Und stützt die Hand an die Wand,
Und es beißt ihn eine Schlange.”
Das Wort des Propheten soll die Un- entrinnbarkeit des Schicksals, mag sich ihm der Mensch auch entziehen wollen, anschaulich machen. So erlebten und erlitten auch die Menschen im östlichen „Zwischeneuropa” in den letzten Jahrzehnten ihr Schicksal. Klein-Harparash hat es zwar nicht verdichtet — daran ändert auch die Tatsache nichts, daß sein Buch ein Bestseller würde — aber er rst einer, der Kunde gibt von jener einst so farbenfrohen Welt und ihren Menschen. In dem Kontrast: hier Rumänien und seine Gesellschaft vor dem Zusammenbruch, dort Ostpolen nach der Sintflut, liegt die besondere Note dieses Buches. Raschelt auch vor allen Dingen in den in Rumänien spielenden Kapiteln mitunter bedenklich das Papier (Aldas Gegenspieler, der Generalsekretär im Innenministerium, Orest Danghu, ist ein echter Theaterbösewicht, an dem die Pradler ihre wahre Freude hätten), so erreichen die Erzählungen vom neukommunistischen Alltag im nunmehr Westukraine gewordenen Ostpolen den Rang einer Soschtschenko-Satire. Ferne Signale, die da und dort gleichsam aus der Trompete eines k. u. k. Ulanenstabs- frompeters aufsteigen, geben davon Kunde, wie lange die Erinnerung an Österreich gerade an den Randgebieten des alten Reiches nachzitterte. Diese Kunde sollte der Binnenösterreicher nicht überhören.
Kein die Weltliteratur bereicherndes Meisterwerk liegt vor, aber ein spannender Unterhaltungsroman. Eine Schnellzugsfahrt Wien—Innsbruck kann durch seine Lektüre zum wahren Vergnügen werden.
Im Zeichen der Kiepe stand der Beginn unseres literarischen Ausflugs in östliches Gelände. Im Zeichen der Kiepe sei er auch geschlosssen. Czeslaw Milosz ist es, der uns „WEST- UND ÖSTLICHES GELÄNDE” (Kiepenheuer & Wietsch. 340 Seiten, DM 18.50) von erhöhter Warte überblicken hilft.
Der heute in Frankreich im Exil lebende Literat und ehemalige Kulturattache Volkspolens in einigen westlichen Hauptstädten hat sich durch einen Zeitroman („Das Gesicht der Zeit”) und eine feinsinnige Natur- und Kindheitsgeschichte („Tal der Issa”) auch westlichen Lesern gegenüber als ein wacher Geist ausgewiesen. Seine literarischen Arbeiten haben stets philosophischen Tiefgang. Wie sollte es auch anders sein: Milosz’ Denken und Schaffen kreisen stets um die Erlebnisse seiner Generation, um die Auseinandersetzung der im westlichen Denken erzogenen polnischen Jugend mit den heutigen politischen Realitäten Osteuropas. Dabei bleibt Milosz nie an der Oberfläche der Ereignisse haften, er versucht vielmehr gewissenhaft, zum Grund der Dinge möglichst viele Stufen hinabzusteigen. Doppelte Heimatlosigkeit — nationale und ideologische — ist dabei ein schweres Gepäck. Der Aufarbeitung dieser „Mitgift” ist das vorliegende Buch gewidmet. Das eigene Leben wird zum Anlaß der Auseinandersetzung mit Fr«‘ Jen im Westen und „Freunden” im Osten. Die Ahnungslosigkeit der ersteren, mit der sie’ dem „Ankömmling aus mitternächtlichen Breiten, von denen kaum jemand mehr weiß, als daß es dort kalt ist”, oft begegnen. schmerzt genau so wie der Druck der Machthaber in der Heimat auf die Geister.
Milosz stammt aus Wilna, jener heißumstrittenen Stadt, die in der Vergangenheit eine Wiege polnischer Intelligenz war. In seinem engeren Freundeskreis befindet sich auch im Gymnasium der heutige Führer der ZNAK-Gruppe polnischer Katholiken und Sejm-Abgeordnete Stanislaw Stomma. Die weitere Entwicklung führt Milosz in jene linksdemokratische Richtung, die für so viele Intellektuelle östlicher Länder in jenen Jahren charakteristisch ist. Ihre Tragödie findet in dem Schicksal des Dichter-Philosophen Bole- slaw Micinski, den Milosz mit allen seinen Freunden Tygrys (Tiger) nennt und an dessen Leitstern sich der junge Intellektuelle orientiert, beredten Ausdruck.
Wer bei Milosz dramatische Ereignisse, „Enthüllungen” eines ehemaligen volksdemokratischen Diplomaten etwa, sucht, braucht das vorliegende Buch gar nicht aufzuschlagen. Wer sich aber das Denken, Fühlen und Wollen der auch im Osten nachrückenden Generation, die sich heute vom Westen in gleicher Weise angezogen wie abgestoßen fühlt, vertraut machen wall, der greife beherzt darnach. Er darf aber von den Schlußfolgerungen des Emigranten, der dieses Schicksal nur Menschen mit Pferdegesundheit, Alligatorenvitalität und Nilpferdnerven” empfiehlt, nicht erschrecken:
„Wenn ich uns aber mit den Bewohnern ruhiger und geordneter Staaten vergleiche, neige ich fast dazu, uns, trotz aller unserer Mißgeschicke und Leiden, in einer bestimmten Hinsicht für glücklicher zu halten. Weder aus neuen Automodellen, Reisen oder Liebesabenteuern kann man ein Jugendelixier gewinnen. Wenn wir der Zeit unseren Anteil an Vergnügungen und Wonnen entreißen, wird sie Rache an uns nehmen, indem sie unseren Sinnenhunger abstumpft. Wir aber haben entdeckt, daß das Jugendelixier keine Wahnidee ist, und zwar, weil wir in die Tiefe der Hölle unseres Jahrhunderts geschaut haben . Das wunderbare Elixier ist die Gewißheit, daß unser Wissen von allem Menschlichen unerschöpflich ist und daß es sich nicht gehört, sich deswegen aufzublasen, denn jedes Erreichte wird ein Gestern, wir bleiben also immer Schüler der untersten Klasse. Ich habe sogar den Verdacht, daß dort, wo der einzelne vor einem unveränderlichen Hintergrund seine Reise von der Kindheit bis ins Greisenalter zurücklegt … der Mensch in die Melancholie der abgestandenen, undurchsichtigen Dinge verfällt. Zwanzigjährige sprechen danus mit müdem, verzehrtefn Gesicht den falschen Aphorismus aus: Das alles war schon einmal da!” (Seite 339.)
Vielleicht sollte man sich doch viel mehr, viel öfter mit den Menschen des europäischen Ostens der Gegenwart, mit ihren Sorgen, aber auch Visionen auseinandersetzen, als dies heute, vor allem hierzulande, geschieht. Weichsel und Bug und die anderen Flüsse des europäischen Ostens tragen auch heute noch viele, allerdings oft versiegelte und chiffrierte, Botschaf rn hinab — dem großen Meer der Zukunft zu.