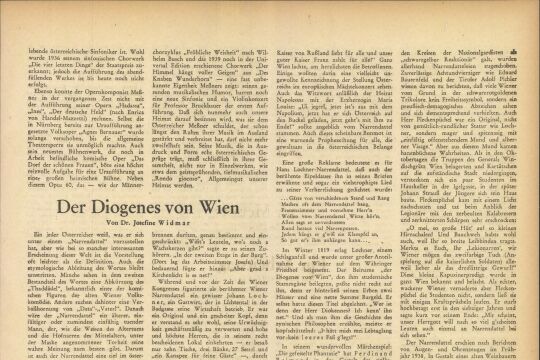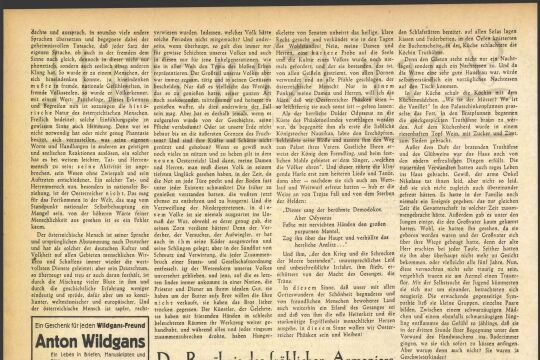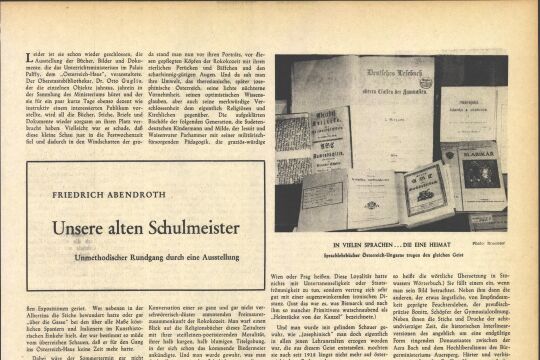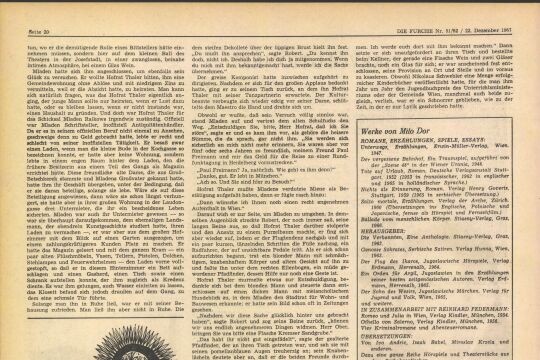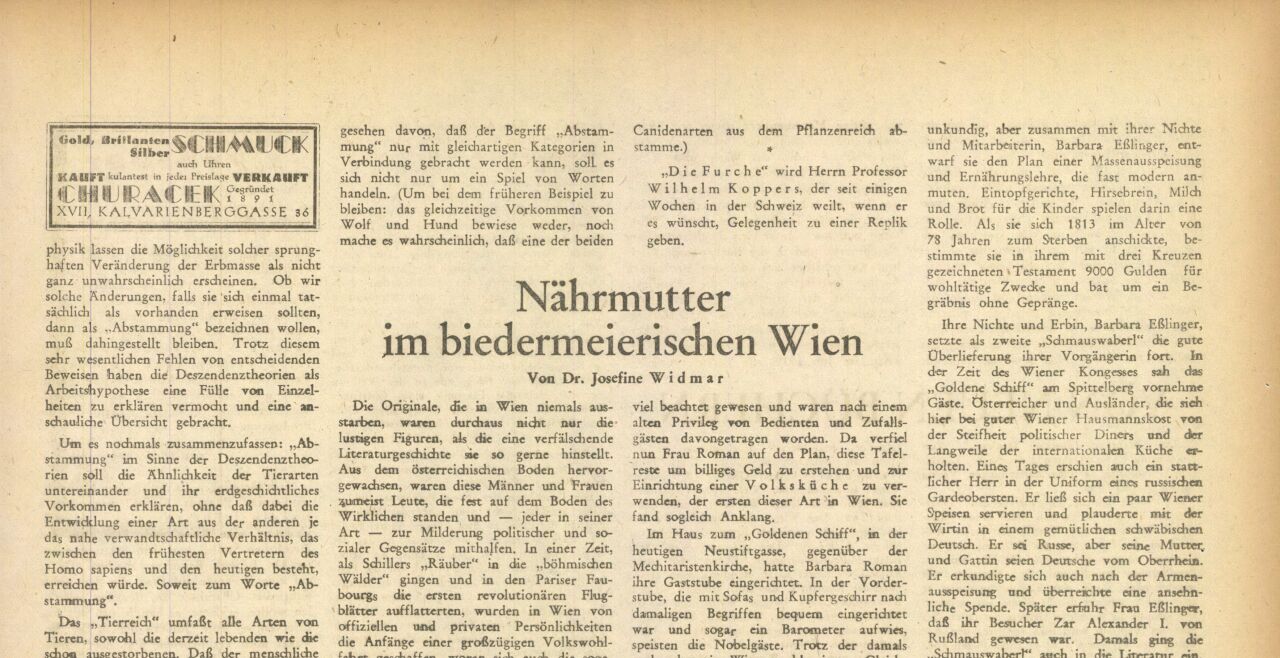
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Nährmutter im biedermeierischen Wien
Die Originale, die in Wien niemals ausstarben, waren durchaus nicht nur die lustigen Figuren, als che eine verfälschende Literaturgeschichte sie so gerne hinstellt. Aus dem österreichischen Boden hervorgewachsen, waren diese Männer und Frauen zumeist Leute, die fest auf dem Boden des Wirklichen standen und — jeder in seiner Art — zur Milderung politischer und sozialer Gegensätze mithalfen. In einer Zeit, als Schillers „Räuber“ in die ..böhmischen Wälder“ gingen und in den Pariser Fau-bourgs die ersten revolutionären Flugblätter aufflatterten, wurden in Wien von offiziellen und privaten Persönlichkeiten die Anfänge einer großzügigen Volks Wohlfahrt geschaffen, woran sich auch die sogenannten kleinen Leute mit Eifer beteiligten. Wiener Humor, praktischer Sinn und Nächstenliebe ersparten den gewöhnlich recht kostspieligen Bau von Barrikaden.
Die Zeit vor und nach dem Wiener Kongreß war keineswegs che rosenumkränzte Backhendelzeit, als die sie später zu Unrecht gepriesen wurde. Die kriegerischen Ereignisse und militärischen Besetzungen zwischen den Jahren 1805 und 1809 hatten Österreich schwer betroffen und mannigfaltige Krisen nach sich gezogen. Geldentwertung und die Mißernte des Jahres 1810 hatten die städtische und ländliche Bevölkerung Niederösterreichs gleichermaßen verelendet. Der österreichische Adel saß verarmt in den ausverkauften Schlössern, während fahrende Trödler und zugereiste Händler die zusammengekauften Familienstücke und Kostbarkeiten auf dem Tandelmarkt verschacherten. Trotz prunkvoller diplomatischer Tafeln und gelegentlidier Massenfeste darbte das Volk in den Wiener Vorstädten, wo sich, entgegen dem berühmten Distichon, schon längst kein leckerer Braten mehr am Spieß drehte. Wir wissen aus der Jugendgeschichte Franz Schuberts, wie knapp, ja schon hungermäßig es in seinem elterlichen Lehrerhaushalt zuging, und eine Freundin der Erzherzogin Maria Luise, die junge Gräfin Viki Crenneville, schildert in ihren Briefen recht naiv und ansprechend, daß die Damen geadelter Beamtenfamilien ihren Schmuck in das von Kaiser Joseph erneuerte Dorotheum trugen, um für den Erlös einen Sack Mehl und ein halbes Faß Fett zu erstehen.
Der Wiener Volksschriftsteller, Franz G r ä f f e r, beriditet in seinem „Wiener Volksplutarch“, daß in der Zeit der Schlachten von Aspern und Wagrawi unter der unbemittelten Wiener Bevölkerung große Dürftigkeit herrschte. Viele Wiener aus den Vorstädten schickten ihre Kinder in die Stadt, um ein Stück Brot zu erbitten. Die Klöster kamen trotz alles guten Willens mit der Ausspeisung alter und kranker Leute nicht mehr nach. Die Geistlichkeit eiferte von den Kanzeln gegen die schwelgerischen Gelage der neuen Reidien. der durch Getreidewucher und Papiergeld zu schwindelhaften Vermögen Gelangten, die in die Paläste des verarmten reichsständisdien Adels nachgerückt waren. Ein Tiroler Kapuziner, Pater Kolumban Haider, forderte in vielbesuchten Predigten unentgeltliche Mahlzeiten für Waisenkinder und Kriegsinvalide.
In diesen spannungsvollen Zeitläuften erschien nun als hilfreiche Fee eine Wienerin, die freilich nach Herkunft und Erscheinung nichts von den romantischen Märchengestalten Ferdinand Raimunds an sich hatte. Sie hieß Barbara Roman, geborene Wissmayer, und stammte noch aus der theresianischen Zeit„ aus der sie auch ihre tüchtigen Anlagen mitbrachte. Sie war in ihrer Jugend Hofbedienstete und Herrschaftsköchin gewesen und ging noch immer diesem nahrhaften Berufe nach. Die offenen Hoftafeln waren freilich längst der sparsamen Zeit zum Opfer gefallen, aber es gab nodi immer genug offizielle und private Veranstaltungen. Diese Festmahlzeiten ließen zuweilen recht ansehnliche Mengen Lebensmittel unverbraucht; sie waren bisher nicht
viel beachtet gewesen und waren nach einem alten Privileg von Bedienten und Zufallsgästen davongetragen worden. Da verfiel nun Frau Roman auf den Plan, diese Tafel-reste um billiges Geld zu erstehen und zur Einrichtung einer Volksküche zu verwenden, der ersten dieser Art in Wien. Sie fand sogleich Anklang.
Im Haus zum „Goldenen Schiff“, in der heutigen Neustiftgasse, gegenüber der Mediitaristenkirche, hatte Barbara Roman ihre Gaststube eingerichtet- In der Vorderstube, die mit Sofas und Kupfergeschirr nach damaligen Begriffen bequem eingerichtet war und sogar ein Barometer aufwies, speisten die Nobelgäste. Trotz der damals auch schon in Wien proklamierten Gleichheit aller Menschen, gab es doch genug einfältige Leute, die Wert darauf legten, sozusagen von der Hoftafel oder dem Tische des Fürsten Auersperg oder Pallavicini zu speisen und sich diesen Genuß auch etwas kosten ließen. Mit diesen Einnahmen stellte Frau Roman ohne viel Aufhebens einen sozialen Ausgleich her und bewirtete in der Hinterstube und in der geräumigen Küche um billiges Geld oder auch unentgeltlich die minderbemittelten Gäste. Zu ihren bevorzugten Besuchern gehörten, wie der ..Wiener
Plutarch“ berichtet, auch zwei Kriegsblinde, die den damals umständlichen Weg von der Inneren Stadt bis zum „Platzl“, geführt von ihren Hunden, nidit scheuten. Auch arme Mütter mit Kindern und alte Leute erhielten für 2 bis 10 Kreuzer warmes Essen, oft auch Milch und Wein dazu. „Ich setzte meinen Stolz dahin“, erklärte Barbara Roman, „für die Ärmsten mit nicht geringerer Sorgfalt das Mahl zu bereiten als für die reichen Gäste!“ Zu Weihnachten 1810 verteilte sie an fast hundert Kinder Weißbrot. Der Ruhm der trefflichen Frau und Wohltäterin verbreitete sich bald weithin; er trug ihr die Ehrennamen „Schmauswaberl“ und „Nährmutter von Wien“ ein. „Bey ihr kriegt man immer gute Bissen und immer noch um einen billigen Preis“, lobte sie der Volksdichter Josef Richter. Die Zeitgenossen schildern sie, „die Wittib nach einem alten Husarenunceroffizier“, als eine martialische Person mit einem schwarzen Schnurrbärtchen auf der Oberlippe, einem derben Scherz nicht abgeneigt, aber voll echter Frömmigkeit und Güte. Mit ihrer vornehmen Kundschaft wußte sie ebensogut auszukommen, wie mit ihren armen Pfleglingen, Exzesse duldete sie nicht, zwei randalierende Hausherrensöhne vom Spittelberg setzte sie eigenhändig vor die Tür. Sie war des Lesens und Schreibens
unkundig, aber zusammen mit ihrer Nichte und Mitarbeiterin, Barbara Eßlinger, entwarf sie den Plan einer Massenausspeisung und Ernährungslehre, die fast modern anmuten. Eintopfgerichte, Hirsebrein, Milch und Brot für die Kinder spielen darin eine Rolle. Als sie sich 1813 im Alter von 78 Jahren zum Sterben ansdiiekte, bestimmte sie in ihrem mit drei Kreuzen gezeichneten • Testament 9000 Gulden für wohltätige Zwecke und bat um ein Begräbnis ohne Gepränge.
Ihre Nichte und Erbin, Barbara Eßlinger, setzte als zweite „Sdimauswaberl“ die gute Uberlieferung ihrer Vorgängerin fort. In der Zeit des Wiener Kongesses sah das „Goldene Schiff“ am Spittelbcrg vornehme Gäste. Österreicher und Ausländer, die sieh hier bei guter Wiener Hausmannskost von der Steifheit politischer Diners und der Langweile der internationalen Küche erholten. Eines Tages erschien auch ein stattlicher Herr in der Uniform eines russischen Gardeobersten. Er ließ sich ein paar Wiener Speisen servieren und plauderte mit der Wirtin in einem gemütlichen schwäbischen Deutsch. Er sei Russe, aber seine Mutter, und Gattin seien Deutsche vom Oberrhein. Er erkundigte sich auch nach der Armen-ausspeisung und überreichte eine ansehnliche Spende. Später erfuhr Frau Eßlinger, daß ihr Besucher Zar Alexander I. von Rußland gewesen wr. Damals ging die „Sdimauswaberl“ auch in die Literatur ein. Adolf B ä u e r 1 e, der Herausgeber der „Wiener Theaterzeitung“, widmet; ihr eine dreiaktige Lokalposse mit Musik, die vom Juh' 1816 bis Juli 1817 ctfmal aufgeführt wurde und sogar den Beifall Raimunds fand.
In der Hinterstube des „Goldenen Schiffes“ sammelte sich am Abend, wenn die armen Pfleglinge gesättigt waren, ein Kreis von jungen Literaten und Künstlern, die, stets bei schmalem Beutel, auf die Güte der Nährmutter von Wien angewiesen waren
und oft bei ihr tief in der Kreide saßen. Das alte Volksspiel vom reichen Prasser und vom armen Lazarus fand hier eine zeitgemäße Abwandlung und in die luxuriösen Vorderstüben hinein klang, im Chor gesungen, herausfordernd und mahnend, die Variationsstrophe aus Raimunds Aschenlied:
Was nutz's den reiejien Narren
Venn sie mit Vieren fahren,
Stecs große Tafeln gehen
Und aJbm lustig leben?
Glaubt's mir auf meine Ehr'.
Kommt irgendein Malheur,
So ist der reichste Herr
Und auch der Millionär
Gleich ms ein armer Narr
Hier in diesen Räumen ertönte im Rundgesang Perinets Lied vom „Schneider Kakadu“ mit seiner Spitze gegen die „Modejakobiner“. Hier schrieb Karl M e i s 1 seine „komischen Gedichte aus der Wiener Vorstadt“, in der die Wiener „Protzen, Liberalen und Relieionsstürmer“ ihren Teil abbekamen, hier arbeitete derselbe Autor und Vorläufer Raimunds an dem Text zu Beethovens klassischem Ton-
Der Kronleuchter
des Josef städter Theaters
Sonst schrillt die Glocke, wird der Gong geschlagen. Eh' sich der Vorhang hebt. Du einz'ge Stadt, Du einz'ges Haus, das solch ein Zeichen hat. Aus Laim und Tag den Sinn emporzutragen!
Da gleitet glitzerndhell ein Märchenwagen Kristallklar, leise klirrend, klingelnd, glatt Zur Decke aul, lischt mählich aus, wird matt. Als wollt' entschwindend jede Kerze sagen:
Nun tilgt den Tag in euch und grelles Licht, Wie ich verglüh' mein Regenbogenfunkeln, Und öffnet willig eure Sinne alle
Dem Trug und Traum des Spiels; laßt das Gesicht Ganz Spiegel sein, wie tiefe Brunnen dunkeln Dem Reigentanz der schwebenden Kristalle.
, Hansmartin Decker-Hauff
aus Grauer Marmor'
stück „Die Weihe des Hauses“, das bei der Eröffnung des Theaters in der Josefstadt die Zuhörer begeisterte.
Im Jahre 1822 kam auf den Spuren Seumes, des „Spaziergängers nach Syrakus“, ein vornehmer Reisender, Adolf von Schaden, auf seinem „Spaziergang von Prag nach Passau“ in das Gasthaus am Spittelberg. Er sah die Wirtin, die er frei nach Werther eine „ältliche Lotte“ nannte, unter einer Schar ärmlich gekleideter, aber rotbäckiger Kinder stehen und ihnen der Reihe nach ihre Suppe zuteilen, während ihre Helferinnen in unerschöpflichen Körben Brot herbeibrachten und er prägt das bedeutsame Wort: „Hier in dieser Stadt gilt
das gütige Menschenherz soviel wie anderwärts eine gemeinnützige Institution', wohl das schönste Lob, das Wien und seinen Bewohnern in langer Zeit gespendet wurde.
Mit dem Tode der Frau Barbara Eßlinger, der letzten echten „Schmauswaberl“, sank auch die alte Tradition ins Grab. Wohl taten sich noch unter den Tuchlauben, am Naschmarkt und in der Bäckerstraße Gast-und Kaffeehäuser auf, die den berühmten Namen benutzten, aber die handfeste Humanität der „heiligen Elisabeth vom Spittelberg“ war dahin. Das letzte Kaffeehaus „Zur Schmauswaber!“ in der Bäckerstraße kam gleich nach dem ersten Weltkrieg, im Juli 1919, zur Versteigerung.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!