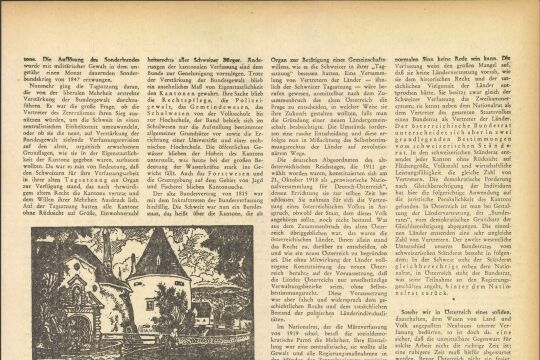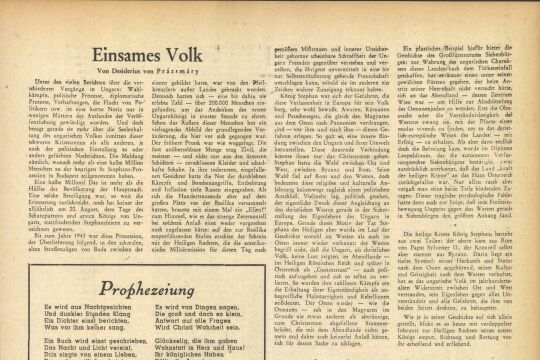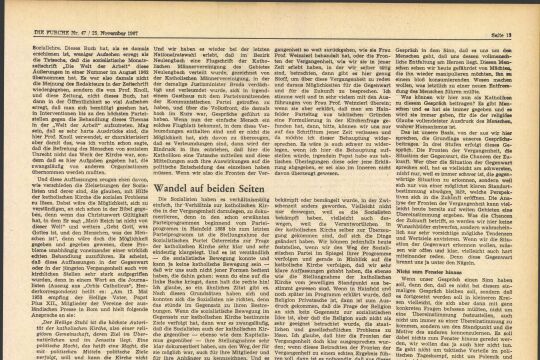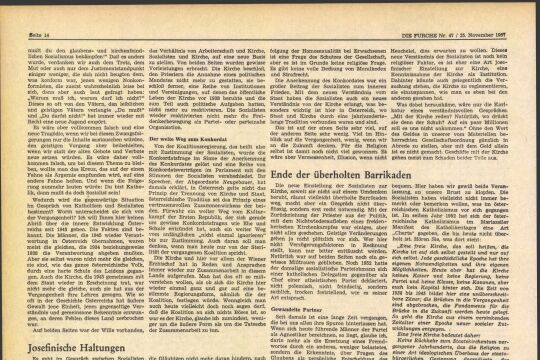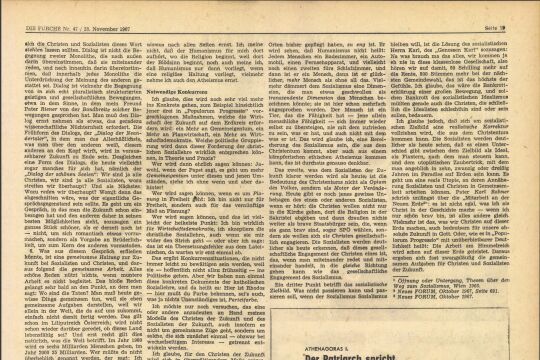Noch vor Jahresfrist wäre eine Begegnung wie das Gespräch über die „Sozialisten und die katholische Kirche“ undenkbar gewesen. Nach den ersten öffentlichen Diskussionen in Wr. Neustadt und Bruck a. d. Mur hatte erstmals eine Landesparteiorganisation der SPÖ offiziell Katholiken — Historiker, Journalisten, Theologen, Vertreter von Laienorganisationen, der Katholischen Aktion und ihrer Gliederungen — zu einer gemeinsamen Diskussion eingeladen.
Die Basis für solche Gespräche hatte die SPÖ theoretisch zwar schon in ihrem Parteiprogramm von 1958 gelegt; zu einem Gespräch jenseits theoretischer Formulierungen und juristischer Abmachungen war es aber seither nicht gekommen. Die führenden Politiker der Sozialisti-*chen Partei zogen es vor, die Partei nicht nur nach innen, sondern auch nach außen vor Diskussion und Auseinandersetzung abzuschirmen und die Fiktion der monolithischen, geschlossenen „Kampfgemeinschaft“, deren erstes und unumstößliches Prinzip Einheit und Geschlossenheit war, beizubehalten.
Im selben Zeitraum war innerhalb des österreichischen Katholizismus vieles in Bewegung gekommen. Thesen, die bereits der Katholikentag 1952 formuliert hatte — die absolute Absage der Kirche an staatliche Gewalt zur Durchsetzung ihrer Forderungen, die Bereitschaft der Katholiken, mit allen politischen Gruppen zusammenzuarbeiten —, wurden vom Konzil bestätigt.
Der neue Parteivorsitzende erkannte hier von Anfang an die Chancen seiner Partei zu einem Gespräch mit den Katholiken. Da, wie Kreisky in St. Pölten erneut betonte, weder der Kommunismus als Partner noch liberale Kräfte akzeptabel seien, kämen nur die Vertreter der katholischen Soziallehre für ein Bündnis in Frage. „Öffnung“ und „Dialog“, die Devise der früheren Außenseiter, wurden zur Devise der sozialistischen Parteipolitik. Das Gespräch ist parteioffiziell geworden. Kreisky betonte zwar zu Anfang der ganztägigen Konfrontation von katholischen und sozialistischen Standpunkten, daß er nicht im Namen des Parteivorstandes rede, er betonte aber ebenso, daß es sich bei der Veranstaltung „nicht um eine Separataktion der SP Niederösterreichs“ handle, sondern um seine eigene persönliche Initiative.
Die Dinge beim Namen nennen
„Wir wollen uns nicht scheuen, die Dinge beim Namen zu nennen. Wir wollen ein hartes Gespräch, ein Gespräch, das sich nicht vor der Tatsache verschließt, wie stark das Erlebnis der dreißiger Jahre in unserer Generation noch lebendig ist.“
Der leidvollen Geschichte der Beziehungen zwischen der Sozialistischen Partei und der katholischen Kirche, einer Geschichte von Mißverständnissen, Versagen und Fehlern, war denn auch der erste Teil des Gesprächs, die „Fronten der Vergangenheit“, gewidmet. Mit Zitaten von Marx über die Religion, mit Zitaten der Päpste über den Sozialismus — von der expliziten Verurteilung als „Pestseuche“ im „Syllabus errorum
modernorum“ über die Inkompatibi-litätserklärung in „Quadragesimo anno“ bis zur Vermeidung des Terminus „Sozialismus“ in den letzten Enzykliken — eröffnete Prof. Erika Weinzierl die Debatte. Das Scheitern der Arbeiterseelsorge zu Beginn der Industrialisierung, die Verkennung der sozialen Not als Ursache moralischen Versagens, die auf Handwerk, Kleinbürgertum und Bauern konzentrierte Christlich-Soziale Partei führten, wie die Historikerin, die das Institut für kirchliche Zeitge-
schichte in Salzburg leitet, bemerkte dazu, daß „die Arbeiterschaft in ihrer überwältigenden Mehrheit ihre Interessenvertreter bei den marxistischen Sozialisten fand. Sie übernahm auch die religions- und kiirchen-feindlichen Tendenzen ihrer vom liberalen Bürgertum herkommenden Führer.“
„Die Kirche ist nie Vorkämpferin der Gerechtigkeit gewesen, sondern immer nur Trösterin bei Niederlagen. Sie gab uns Almosen statt Gerechtigkeit“ — der Hauptvorwurf, den die Arbeiter immer wieder gegen die Kirche richteten, klang auch aus den Worten des sozialistischen Diskussionspartners, des Abgeordneten Franz Pichler. Die Vertröstung auf das Jenseits, statt sich in dieser Gesellschaft für den Kampf gegen Not, Elend, Ungerechtigkeit einzusetzen, sei der tiefste Grund für die ablehnende Haltung nicht weniger Arbeiter — auch heute noch. Unter Berufung auf August M. Knoll bezeichnete Pichler die Religion als „nicht geeignet, gesellschaftliche und politische Probleme zu lösen“.
Alte Klischeevorstellungen — neue Positionen
Man ist zu sehr in alten Klischeevorstellungen befangen, um Entwicklungen zu sehen und daraus Folgerangen zu ziehen, replizierte der Chefredakteur der Kathpress, Dr. Richard Barta. Zur „Situation der Gegenwart“ stellte er einen Katalog gegenseitiger Forderungen auf.
• die SPÖ könne von der Kirche erwarten, daß sie nicht in die Tagespolitik eingreife;
• daß sie die Katholiken nicht mehr
unter Berufung auf die Religion in einer Partei vergattere.
• Sie kann von der Kirche, die heute mit Marxisten, Atheisten, Nihilisten spricht, auch das Gespräch mit der ihr näherstehenden Sozialdemokratie verlangen —
• und das in einer Sprache, die sie versteht.
• Die Katholiken ihrerseits erwarten von der SPÖ „kein Glaubensbekenntnis und kein christliches Getue“, sondern „Achtung vor der Überzeugung des anderen.
• Freiheit für jeder, nach seinem Gewissen zu leben.“
• „Wenn Sie nicht wollen, daß das politische Handeln der Christen nur in einer Partei erfolgt, und viele von uns wollen das auch nicht, dann müssen Sie den Christen in ihrer Partei mehr Raum geben. Mit dem Schlagwort von der Religion als Privatsache aliein kommt man nicht aus.“
Kreisky: Ubereinstimmung mit Withalm
Allen Vermutungen, die SPÖ könnte das Gespräch mit der Kirche aus wahltaktischen Überlegungen suchen, um neue Wählerschichten zu erschließen — Hauptargument aller Gegner des „Dialogs“ —, nahm Doktor Kreisky in seinem Referat die Spitze, indem er solche Vermutungen als „vollkommen richtig“ bezeichnete. „Natürlich bedrückt es viele in der SPÖ, daß Menschen sie nicht wählen, weil sie sie für Feinde ihres Glaubens halten.“ Ebensowenig könne man aber übersehen, daß es in Christentum und Sozialismus eine Ubereinstimmung in den Grundideen gebe — in Gleichheit und Brüderlichkeit. Eine Übereinstimmung, nicht aber eine neue Monopolstellung. „Ich befinde mich in der Frage der Beziehung zwischen Kirche und politischen Parteien in voller Übereinstimmung mit dem Generalsekretär der ÖVP, Dr. Withalm, und seinen Thesen in der .Wiener Kirchenzedtung'.“
Chancen der Zukunft
Von dieser Ausgangsposition her, der klaren und eindeutigen Ablehnung irgendwelcher neuer Monopole und damit neuer Kampfstellungen (eine Frage, in der sich die führenden Köpfe beider Parteien inzwischen zur gleichen Position durchgerungen haben, ging man an die Analyse der „Chancen der Zukunft“.
„Die Kirche hat heute in der Frage Sozialismus offenbar auf grün
geschaltet“, eröffnete der Leiter der Sozialakademie, Pater Dr. Walter Rie-ner SJ., die Debatte. „An den Sozialisten liegt es daher, die Chancen der Zukunft wahrzunehmen.“ Diese Chancen liegen darin, daß der Sozialismus im Gegensatz zum statischen Denken der traditionellen kirchlichen Naturrechtsdehre früher und besser die Entwicklung der modernen Gesellschaft, die Tendenz
zur wirtschaftlichen und politischen Gleichberechtigung der Arbeiterschaft erfaßt habe. Seine Gefahren für den Christen liegen immer noch im „geschlossenen Humanismus“, den die Enzyklika „Populorum Progres-sio“ ausdrücklich verurteilt.
Wege in die Zukunft
„Wie wird der Christ der Zukunft aussehen, wie wird der Sozialist der Zukunft aussehen, wie werden beide zueinander stehen?“ Diese Fragen stellte DDr. Günther Nenning und fixierte seine Zukunftsperspektive auf „mindestens 1971, also nicht nur bis zu den nächsten Wahlen“. Die Christen, meinte Nenning, werden immer stärker den Menschen als gesellschaftliches Wesen, die soziale und politische Dimension der Caritas sehen. Die Sozialisten dagegen sollten die transzendentale Dimension des Menschen entdecken und dabei erkennen, daß ihr jetziger Humanismus zu eng gefaßt ist. Die traditionellen Vorstellungen von Religion dürften langsam der Erkenntnis Platz machen, daß das Christentum eine gewaltige Kraft zur Veränderung der Gesellschaft darstellt. Wenn der Sozialismus auch nicht auf Utopien verzichtet, so wird er sich doch „realistische Korrekturen dieser Zukunftsvision“ gefallen lassen müssen — vor allem von seiten der Christen. Den gerade gegen seine sozialistische Zukunftsvision oft erhobenen Vorwurf des „linken Integralismus“ versuchte Günther Nenning dadurch zu entkräften, daß er zwar nicht von einem „Exklusivbündnis“ zwischen Christentum und Sozialismus sprach, wohl aber von einer „Meistbegünstigungsklausel“ für die politische Bewegung, die den christlichen Vorstellungen von der menschlichen Gesellschaft am meisten entspricht.
Das Mißtrauen ist noch lebendig
Nach solchen Zukunftsvisionen prallten in der allgemeinen Diskussion um so härter Gegensätze der Vergangenheit und der Gegenwart aufeinander. Sozialisten zitierten die zur Genüge bekannten Beispiele für Rückfälle in eine vergangene Ära, das „Gebet für den Hl. Klaus“ bei den letzten Nationalratswahlen, Aufrufe von Katholiken für die ÖVP; Katholiken erwähnten Hetzartikel gegen die Kirche, Spötteleien über katholische Arbeiter in Betrieben usw., usw. Kleine Vorfälle am Rand der großen Entwicklungsprozesse, Vorfälle, die dennoch beweisen, wie lebendig in diesem Land noch die Vergangenheit spukt, wie schwer es ist, das tief eingewurzelte Mißtrauen auf beiden Seiten auszurotten. In intellektuellen Kreisen mag das Gespräch vielleicht schon zur Selbstverständlichkeit, der „Dialog“ zum Modewort geworden sein; in den breiten Schichten der Wählerschaft stellen solche Diskussionen erste Schritte auf einem langen Weg dar. Sie können und sollen zunächst nicht mehr als ein neues Klima schaffen — ein neues Klima für die Kirche unter den Sozialisten, ein neues Klima für den Sozialismus unter den Katholiken.
Sicherlich ist damit nicht alles getan. Im Gegenteil, das neue Klima ist erst die Bedingung für die echte sachliche Auseinandersetzung; dessen wair man sich auch in Sankt Pölten bewußt. „Wir müssen vermeiden“, sagte Kreisky in seinem
Schlußwort, „daß das Gespräch in den Anfängen steckenbleibt, weil wir 'keinen Mut haben, über wesentliche Dinge zu reden, aus Angst, die Idylle zu zerstören.“
Was also ist das Fazit dieses ersten Gesprächs?
Wie schon bei vorangegangenen Diskussionen ähnlicher Art machte sich auch in St. Pölten der Mangel an wechselseitiger Information bemerkbar: zur Kenntnis der Kirche gehört dabei nioht nur die von Sozialisten häufiger als von Katholiken zitierte Enzyklika „Populorum Progressio“, sondern auch wichtige Dokumente des österreichischen Katholizismus seit 1945, wie etwa das „Mariazeller Manifest“.
Neben der Diskussion über grundlegende Fragen muß es immer mehr zu Diskussionen über konkret Themen kommen, — z. B. über Strafrechtsreform, Struikturrefor-men, Mitbestimmung.
Wie die Katholiken heute langsam zur Kenntnis nehmen, daß es nioht mehr den einheitlich-geschlossenen Katholizismus gibt, muß sich auch im Sozialismus der zwar theoretisch fundierte, aber bis jetzt nicht praktizierte Pluralismus durchsetzen. Die Möglichkeit der Christen, in mehreren Parteien aktiv zu werden, wird dazu beitragen, echte Konkurrenzverhältnisse zwischen den Parteien und damit eine Grundvoraussetzung für eine funktionierende Demokratie — auch in Österreich — zu schaffen.