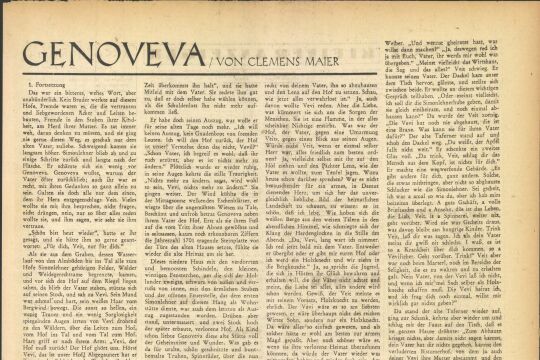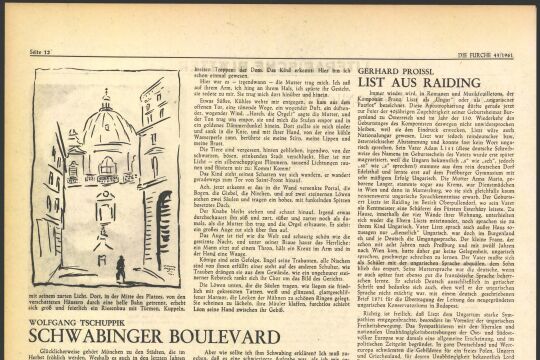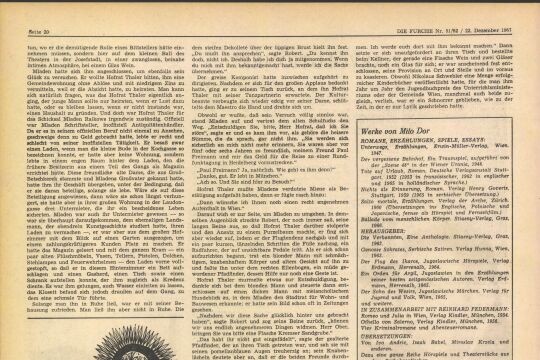In dem kleinen Schwarzwaldstädtchen läuteten die Mittagsglocken. Aus dem auf dem Dorfplatz gelegenen Schulhause stürmte wie jeden Samstag die fröhlich lärmende Kinderschar hinaus in den Frühlingssonnenschein. Bald würde das kleine Städtchen wieder halb verlassen sein, da alle Eltern mit ihren Kindern zum Wochenende hinaus ins Freie fuhren.
Die Kleinen riefen einander stets die diversen Wochenendziele zu, bevor sie sich zerstreuen. Und immer wieder war da ein kleiner Prahlhans dabei, der laut erklärte:
„Heute fahren wir in den Taunus.”
An unserem Samstag aber wurde er von der kleinen Sybill übertrumpft:
„Wir fahren in die Schweiz, dort wohnt meine Tante”, krähte sie, wobei ihr Pferdeschwanz, der ihr ein keckes Aussehen gab, lustig im Wind flatterte.
Keines der Schulkinder beachtete seinen dunkelhaarigen, blassen Kameraden, wie er, die schäbige Schultasche auf dem schmächtigen Rük-ken und vorbei an wenig einladenden Fabrikhallen, den Weg in die ärmliche Vorstadtsiedlung einschlug.
In seinem kleinen Kopf schwirrten die klangvollen Namen der verschie-denn Urlaubsziele durcheinander. Sie alle würden wegfahren, er aber würde dableiben müssen. Wenn er nach Hause kam, würde ihn keine chromblitzende Limousine erwarten, niemand würde sagen: „Iß nur schnell, Kind, dann fahren wir an den See.”
Nein. Noch nie hatte jemand so zu dem achtjährigen Mirko Jankovic gesprochen, denn sein Vater war nach einem Arbeitsunfall seit Jahren gelähmt, und seine Mutter, die früher als Bedienerin wenigstens ein paar Pfennige zu der kärglichen Unfallrente ihres Gatten hatte zuschießen können, war immer mehr dem Alkohol, diesem zweifelhaften Tröster der Ärmsten, verfallen. Zwar hing sie in ihren nüchternen Momenten auch weiterhin mit großer Liebe an den Ihren, ihrem Ehemann Slavko und dem kleinen Mirko, hatte sie aber getrunken, verwandelte sich ihre Zuneigung in Bosheit und verzweifelten Haß, so daß es um Mirkos Kinderstube reichlich schlecht bestellt war.
Die Sonne stand schon im Zenit.
Bald war Mirko zu Hause. Er sah, wie schon so oft, sein halbverfallenes kleines Elternhaus und davor den verwilderten Vorgarten.
Da hörte er es wieder, und sein kleines Herz krampfte sich zusammen: aus der halbgeöffneten Tür drang die keifende Stimme seiner Mutter. Mami schimpft schon wieder, fuhr es ihm durch den Kopf. Sicher ist wieder kein Geld im Haus, und Mami macht wie immer den Vater dafür verantwortlich.
„... Miete nicht zahlen, sitzen wir auf der Straße. Auch beim Krämer haben wir keinen Kredit mehr. Mirko braucht neue Schuhe. Und was ist mit mir? Was habe ich vom Leben? Wenn du nur deine sündteuren
Medikamente hast, das ist natürlich die Hauptsache”, schleuderte sie ihrem wehrlos im Rollstuhl sitzenden Mann entgegen, gerade als Mirko das Zimmer betrat.
„Grüß Gott, Mami und Papi”, murmelte er zaghaft und wollte sich rasch in eine stille Ecke verdrücken.
Aber da hatte ihn schon die Mutter am Ranzen erwischt.
„Was, schon aus der Schule zu Hause? Du hast mir gerade noch gefehlt”, fuhr sie ihn an.
Sie hatte schon wieder getrunken. Auf dem Tisch bemerkte der Kleine die halbgeleerte Flasche und daneben das schmutzige Glas. In seiner Not schaute er auf seinen Vater. Doch als dieser dem hilfesuchenden Blick seines Sohnes begegnete, rannen ihm einige Tränen über die stoppeligen Wangen. Mehr konnte er für Mirko nicht tun.
Da faßte Mirko den festen Entschluß, daß irgend etwas geschehen müsse, was diesem Elend ein Ende bereitete. Er stellte die Schultasche in eine Ecke und rannte hinaus, denn er wollte mit seinen Gedanken allein sein.
Ganz sicher würde er seinen Eltern helfen. Er wußte nur noch nicht, wie.
Wie immer, wenn er weder aus noch ein wußte, lenkte Mirko auch heute seine Schritte nach dem nahegelegenen Rummelplatz. Dort besaß Antonio del Mare, ein immer lachender, kraushaariger Italiener, ein lärmendes, stets von Kinderscharen umlagertes Autodrom.
Nur bei ihm fand der kleine Junge Liebe und Verständnis, nachdem sie einander vor zwei Jahren, anläßlich eines Wandertages seiner Schulklasse unter der Führung von Fräulein Baumann, der etwas ältlichen Lehrerin, kennengelernt hatten.
Damals mußte Mirko traurig abseits stehen und zusehen, wie seine Kameraden lustig herumflitzten, er aber hatte kein Geld. Das tat schon sehr weh, denn zu dieser Zeit konnte Mirko noch nicht verstehen, daß das wahre Glück nicht von Geld und Vergnügen abhänge. Damals wünschte er nichts sehnlicher, als am Steuer eines dieser funkelnden Wägelchen dahinzubrausen. Die ersten bitteren Tränen der Enttäuschung standen in seinen Augen, als sich plötzlich eine große Hand auf seine Schulter legte und eine tiefe, aber freundliche Stimme sagte:
„Was ist denn mit dir? Willst du nicht auch fahren?”
Verlegen blickte der Bub zu dem großen, freundlichen Mann auf, dessen Augen ihn fröhlich, aber verständnisvoll anblitzten.
„Ach so, mein Kleiner, du hast kein Geld. Aber das macht ja nichts”, sagte der junge Italiener, und schon fühlte Mirko sich aufgehoben und in das nächstbeste Auto gesetzt. Noch nie war der Kleine so glücklich gewesen wie damals, als auch er strahlend seine Runden ziehen durfte. Beim Abschied hatte der Italiener ihm als einzigem zugewinkt und gerufen :
„Komm mich bald wieder mal besuchen, Kleiner, aber ich weiß ja gar nicht, wie du heißt...”
„Ich bin Mirko”, hatte das Kind hastig geantwortet und war schnell den anderen nachgerannt, die schon einen kleinen Vorsprung hatten. Er hatte einen neuen Freund gewonnen.
Auf dem Weg zum Rummelplatz wurde Mirko immer zuversichtlicher. Denn gemeinsam würden sie beraten und gemeinsam einen Ausweg finden. Aber wie groß war Mirkos Enttäuschung, als er von der Kassierin erfahren mußte, daß Antonio in Geschäften in die Stadt gefahren sei und erst morgen wiederkommen würde.
Ziellos trottete Mirko nun durch die gewundenen Gäßchen von Mittenwald. Sein Problem beschäftigte ihn immer mehr, er wußte aber zugleich, daß er ohne seinen Freund Antonio doch zu keiner Lösung kommen konnte. So entfernte er sich unbewußt immer mehr von daheim. Mittenwald war zu dieser Zeit ziemlich menschenleer.
Er mochte wohl eine halbe Stunde herumgeirrt sein, als er zur Konditorei „Conradi” kam. Direkt davor war ein knallrotes Sportkabriolett eingeparkt, noch dazu mit ausländischem Kennzeichen, wie der Kleine sofort bemerkte, das seine ganze Aufmerksamkeit an Anspruch nahm. Wie weggeblasen waren da seine Sorgen, als er mit seiner Knabenhand über den glänzenden Lack fuhr. Auch die Innenausstattung beeindruckte ihn maßlos: Sitze aus wohlriechendem schwarzem Leder sowie komplizierte Armaturen zeichneten dieses Wunderwerk der Technik aus, das wohl jedes Bubenherz höher schlagen ließ. Und er konnte nicht widerstehen. Zaghaft schloß .sich seine kleine Faust um das mit Leopardenfell überzogene Lenkrad. Da fiel sein Blick auf eine überaus wertvolle Kamera, die auf der Abläge hinter dem Fahrersitz achtlos hingeworfen lag. Was war da Martins schäbige Box dagegen, mit der er vorige Woche geprahlt hatte. Schwer wog sie in seiner Hand, als er einen Blick durch den Sucher riskieren wollte. Und was für ein besonders wertvolles Objektiv diese Kamera zu haben schien!
„Na, du kleiner Meisterphotograph!” sagte hinter ihm eine Frauenstimme. Vor Schreck wäre ihm beinahe das kostbare Kleinod entglitten. Purpurne Schamröte überzog sein altkluges Kindergesicht, als ihm eine elegante Dame gerade noch rechtzeitig die Kamera aus der Hand nahm. Blitzschnell drehte sich der Kleine um, und noch ehe sie irgend etwas hätte sagen können, rannte er schon die Straße hinunter, ohne sich noch einmal umzublicken.
„Frau Architekt, Ihre Handtasche!” rief Frau Conradi, die Gattin' des Konditors, und schwenkte ein glänzendes Krokotäschchen.
„Vielen Dank, Frau Conradi”, murmelte diese verwirrt.
„Ja, und dann noch etwas: Können Sie mir sagen, wer dieser liebe Junge war, der eben noch bei meinem Wagen gestanden ist?”
„Ach der”, war die eher abschätzige Antwort.
„Das war nur der kleine Mirko' Jankovic, ein armes Kind. Sein Vater ist gelähmt und seine Mutter ... na ja.”
„Danke schön. Aber ich muß jetzt fahren.”
Die Dame setzte sich ans Steuer, startete und fuhr weg.
Die großen, traurigen Kinderaugen gingen ihr nicht aus dem Kopf. *
Astrid Anspach war eine erfolgreiche Architektin. Uberall in Deutschland und in der Schweiz konnte man die großen Bauwerke finden, für deren Entwürfe sie verantwortlich gezeichnet hatte. Freilich hatte sie es am Anfang schwer gehabt, sich gegen ihre männlichen Kollegen durchzusetzen. Doch das war nicht immer so gewesen.
Astrid war das Kind immens reicher Eltern. Sie war in der Schweiz aufgewachsen, wo ihr Vater, an dem sie sehr hing, einer weit über die Grenzen des Landes hinaus berühmten Klinik vorstand. Hier fanden Potentaten aus aller Herren Ländern Heilung oder zumindest Linderung ihrer Leiden. Auch Astrids Mutter Isabell, Isabell Stein, wie sie mit dem Künstlernamen geheißen hatte, damals, bevor sie Astrids Vater kennengelernt hatte und eine gefragte Soubrette in Paris war —, war einst zur Behandlung in die berühmte
Schweizer Klinik gekommen. Primär Anspachs sicheres Auftreten und sein bestimmtes Wesen hatten sie vom ersten Tag an zu ihm hingezogen. Aus dieser ersten Zuneigung erwuchs eine tiefe und anhaltende Liebe, die überraschenderweise erwidert wurde.
Bald standen die beiden vorm Traualtar. Die Hochzeit war ein Stadtgespräch. Die Leute wunderten sich über die seltsame Wahl des begnadeten Chirurgen. Natürlich mußte Isabell ihren über alles geliebten Beruf aufgeben und sich ganz der überragenden Persönlichkeit ihres Gatten unterwerfen. In der Zeit des Honigmondes war sie zwar eine der glücklichsten Frauen auf der Welt, doch als sie von ihrer Hochzeitsreise, die sie bis in die fernsten Länder geführt hatte, zurückgekehrt waren, wurde ihrem Mann von seinem verantwortungsvollen Beruf wieder alles abverlangt, so daß er kaum Zeit fand, sich um seine schöne junge Frau zu kümmern. Eine erste leise Unzufriedenheit machte sich bei ihr bemerkbar. Doch dann kam die kleine Astrid, und neuer Sonnenschein zog wieder in das Haus Anspach.
Anfangs versuchte die Mutter, in der Tochter die künstlerischen Neigungen zu wecken, die sie nun leider unterdrücken mußte, doch Astrid geriet in ihrem nüchternen Denken mehr nach ihrem Vater. Eine heimtückische Krankheit raffte Isabell hinweg, als Astrid gerade zehn Jahre alt war. Nun mußte sie der Vater in ein teures Internat stecken, wo sie allerdings eine hervorragende Erziehung genoß. Dort war Astrid stets einer der fleißigsten Zöglinge. Nach dem Abitur erfüllte ihr Vati den heißesten Wunsch: das Architsk-turstudium. Dieses führte sie im Laufe der Jahre an die Universitäten von Paris, Mailand und Wien. Die ganze Kraft ihrer Jungmädchenjahre legte sie in dieses schwierige Studium, so daß sie kaum Zeit hatte, sich um etwas anderes als um komplizierte Baupläne und statische Berechnungen zu kümmern. Wenn ihre Kommilitonen sie ob ihrer selbstgewählten Zurückgezogenheit neckten, hatte sie stets nur die eine Antwort parat: „Erst die Arbeit und dann das Vergnügen.” Nicht daß Astrid etwa unhübsch gewesen wäre; im Gegenteil: sie war zum Anbeißen hübsch mit ihrem blonden Wuschelkopf und ihrer ranken, sportlichen Figur. Außerdem war sie eine ausgezeichnete Schwimmerin, die, wo immer sie auch hinkam, bewundernde Männerblicke auf sich zog. Damals aber kamen ihr die Männer bloß sehr albern vor. — Bis sie Ralf Erwin traf.
Edition Literaturproduzenten (Verlag für Jugend u. Volk)
ZEICHNUNGEN: