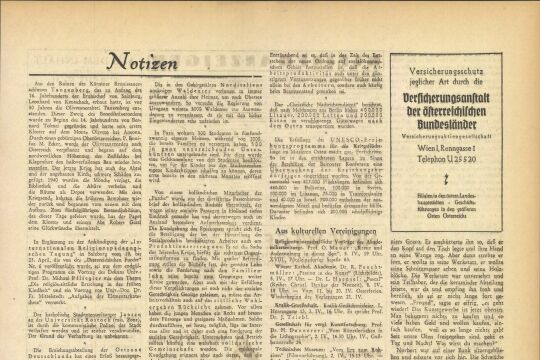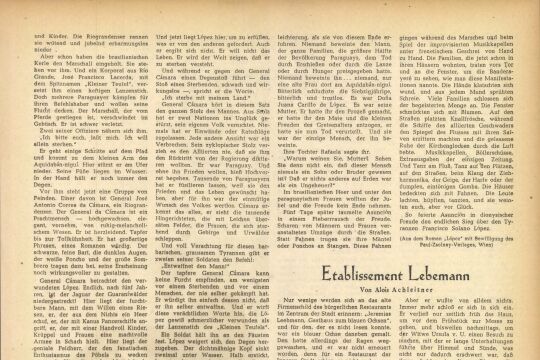Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Alexander Petrowitsdh Iswolsky
August 1919
Soeben lese ich, daß Alexander Iswolsky gestorben ist. Die Blätter widmen ihm lange Nachreden. Sie nennen ihn den Vater des Krieges, den Mann, der sein Land noch größer haben wollte, und der erleben mußte, es zerschmettert zu sehen. Ich glaube immer, man schätzt ihn zu hoch ein. Einen Krieg wollen, ihn im richtigen Augenblick herbeiführen, dazu gehört ein Riese wie Bismarck, ein Mann von sicherem, zielbewußtem Handeln. Das war Iswolsky gewiß nicht.
Alexander Petrowitsch hat sich selbst am besten charakterisiert, als er mir sagte: „Das Leben ist schwer für mich, car je suis un ambrtieux, double d'un sentimental“ (denn ich bin ein Ehrgeiziger, in dem ein Sentimentaler steckt). Dieser Zwiespalt gab seinem ganzen Leben etwas Schwankendes, Unsicheres.
Obwohl er unschön war, hatte er in seiner Jugend Erfolge, die wohl jedermann zu Kopf gestiegen wären, und die aus ihm, der kein großes Vermögen und keine sonderlichen Familienbeziehungen hatte, einen der gesuchtesten jungen Leute der Petersburger Gesellschaft machten. Darin, daß seine Stellung eben nur auf persönliche Erfolge aufgebaut war, lag auch der Grund zu seiner beinahe krankhaften Empfindlichkeit. Wer von Kindheit her auf der festen Basis einer Familienstellung mit entsprechendem Vermögen steht, ist nicht so sehr auf Beifall angewiesen und nicht so empfindlich gegen jede Verletzung seiner Eitelkeit.
Die Geschichte seiner Verheiratung hat mir Iswolsky oft erzählt, und sie hat mir immer so gut gefallen, besonders solange ich das Vorspiel dazu nicht kannte: am Tage seiner Ankunft in Kopenhagen, erzählte er mir, traf er in einem Salon die Tochter seines Chefs, des Grafen Toll. Es war ein grauer Nebeltag, und Komtesse Mimi trug einen großen Hut, der ihr Gesicht tief beschattete. Sie plauderten eine Stunde zusammen — und wenige Tage darauf waren sie. verlobt. Nun das Vorspiel dazu: Komtesse Toll war mit dem Grafen Adlerberg verlobt gewesen. Ich habe den Grafen später, gichtgeplagt in München, und zwar gerade bei Iswolskys kennengelernt. Adlerberg war zurückgetreten, was Tolls sehr kränkend empfinden mußten. Da erwirkte die Kaiserin-Mutter, Maria Feodorowna, die hohe Protektorin der Familie Toll, die Ernennung des brillanten Legationssekretärs Iswolsky nach Kopenhagen, und in der Abschiedsaudienz gab sie ihm den Rat, sich um die liebliche Ariadne zu bemühen.
In dieser Fassung ist die Geschichte weniger romantisch. Wie dem auch sei, sicher bleibt, daß man sich keine glücklichere, harmonischere Ehe denken konnte als diese rasch beschlossene. Selten haben zwei Menschen einander so wunderbar ergänzt. Frau Iswolsky ist ein liebenswürdiges, sonniges Wesen, das alles leicht und von der guten Seite nimmt. Als sie Botschafterin in Paris wurde, nannte man sie allgemein „Le sourire de Paris“ („Das Lächeln von Paris“). Ihr Mann hatte sie und ihre Kinder herzlich lieb. Ihre Heiterkeit war ihm eine Lebensnotwendigkeit geworden. Die Ehe ertrug sogar die Belastung einer Schwiegermutter, wie sie in den „Fliegenden Blättern“ nicht schöner vorkommt. Gräfin Toll wohnte mit auf der Gesandtschaft, fand beständig, daß ihre Tochter sich nicht genug ihr widme, daß ihr Schwiegersohn es nicht genug weit gebracht habe. Ihr Mann sei schon mit 32 Jahren Gesandter gewesen — in ... Neapel! Dies alles und oft viel mehr ertrug „mon gendre Monsieur Iswolsky“ („mein Schwiegersohn, Herr Iswolsky“), wie sie ihn stets nannte, mit einer Geduld und Sanftmut, die einem Heiligen zur Ehre gereicht hätte. Nach Belgrad, wo ich Alexander Petrowitsch kennengelernt habe, war er ohne seine Familie gekommen, und die Art unserer Belgrader Geselligkeit gab fast täglich Gelegenheit zu langen intimen Plaudereien, entweder zu zweit oder in ganz kleinem Kreise. Das war das Richtige für Iswolsky, da war er in seinem Element, man fühlte seinen Scharm und begriff seine Erfolge. In großer Gesellschaft habe ich ihn nie besonders brillant oder geistreich gefunden. Wie alle zartbesaiteten Menschen brauchte er dazu eine homogene Atmosphäre. Er hatte die so seltene Gabe, amüsant und witzig zu sein, ohne zu ermüden, und wußte das Gespräch zu lenken, ohne daß man es merkte. Frauen gegenüber besaß er ein ganz merkwürdiges intuitives Verständnis, traf immer den Ton, der zur Stimmung paßte, das Wort, das man erwartete.
Iswolsky las viel, in allen Sprachen der zivilisierten Welt. Ich habe nie bemerkt, daß er ein besonderer Bewunderer Englands zum Nachteile Deutschlands gewesen wäre. Jede Kultur interessierte ihn, nur für Halbkulturen hatte er nichts übrig. Als ich einmal von einem, sagen wir — exotischen Diplomaten sprach, meinte er: „C'est encore un de ces sangliers, dont la civilisation a fait un cochon!“ („Das ist auch so ein Eber, aus dem die Zivilisation ein Schwein gemacht hat!“)
Oft und viel habe ich ihn damals von Baron Aehrenthal sprechen hören, er bewunderte ihn restlos, als Mensch und als Diplomaten. Bei der schönen Tante seiner Frau, Natalie Narischkin, hatte ihn Iswolsky intim kennengelernt. Er zitierte Aehrenthal und dessen Aussprüche fortwährend und hat mir mehr als einmal auseinandergesetzt, welches Glück für die österreichisch-ungarische Monarchie Baron Aehrenthals Berufung zum Minister des Äußeren wäre. Zu dieser Zeit kann das nicht unaufrichtig gewesen sein. Hat er die Gefühle Baron Aehrenthals gegenüber Rußland mißverstanden? Hat er selbst, der immer Schwankende, die seinen geändert? Wer kann es sagen?
In Belgrad wollte Iswolsky absolut nicht bleiben, er schützte vor, daß er es seiner Frau nie zumuten werde, sich in dieses Nest zu vergraben, daß es auch unmöglich wäre, dort eine anständige Wohnung zu finden usw. Wenn im Gespräch politische Fragen Serbiens berührt wurden, behauptete er immer, König Milan und Königin Natalie, deren respektive Einflüsse sich damals die Waagschale hielten, seien ihm gleich indifferent, bis auf den Umstand, daß die Königin eine Frau und von korrekter Lebensführung wäre. Wenn ich insistierte, schob er mir die eben erschienene „Princesse lointaine“ von Rostand in die Hände. Es gehörte zu seinen Theorien, daß eine junge, hübsche Frau katholisch sein müsse und niemals von Politik, besonders von Balkanpolitik, sprechen dürfe.
Etliche Monate später war Alexander Petrowitsch in München akkreditiert. Die alte Gräfin Toll hatte doch eine gute Eigenschaft, sie war die Freundin der Kaiserin-Mutter. In München lebte zunächst alles glücklich und zufrieden. Tolls hatten ungezählte Verwandte und eine Villa am Tegernsee, fühlten sich in Bayern ganz wie zu Hause, und der Salon der russischen Gesandtschaft war bald einer der angenehmsten und gesuchtesten. Als wir im Sommer 1899 auch nach München versetzt wurden, fand ich, daß Alexander Petrowitsch die Ruhe schon etwas satt hatte. Der Sentimentale war befriedigt, aber der Ehrgeizige rührte sich in ihm. Zunächst hat er versucht, die bayerische Regierung in der Frage der Abgaben des Eisernen Tores ein bißchen gegen uns zu hetzen, so als gewisse Fingerübung. Im Laufe des Winters fuhr dann das Ehepaar auf drei Wochen nach Petersburg und bald darauf nach Darmstadt, wo das Zarenpaar zu Besuch weilte. Von Darmstadt zurückgekehrt, hat mir Iswolsky anvertraut, der Zar hätte ihn so inständig gebeten, den Posten eines Gesandten in Tokio anzunehmen, daß er endlich ja gesagt hätte. Er sei doch noch zu jung, um in München zu sitzen, wo er gar nichts zu tun hätte. Gräfin Toll war natürlich unzufrieden und schimpfte: ihre Tochter könne die Seereise nicht vertragen, also müsse man die sibirische Bahn benützen, die noch kaum fertiggestellt sei, daböi wurde immer wiederholt, wie inständig Zar Nikolaus Iswolsky gebeten habe, Tokio anzunehmen ... so oft, daß die boshaften Münchner behaupteten, die Reise verzögere sich etwas, weil der Zar durch andere Geschäfte verhindert wäre, die Lokomotive in eigener Person zu heizen. In puncto Geld war der sehr gut dotierte Posten Japan höchst willkommen, denn Iswolskys lebten gewiß über ihre Verhältnisse. Die Finanzpolitik des Hauses ward einmal sehr lustig beleuchtet. Wir redeten alle dem Gesandtschaftsattache Xavier Orlowski zu, sich Pferde zu kaufen. Dieser wehrte sich und meinte, in München könne man sehr gut ohne Wagen existieren, überdies habe er auf seinem früheren Posten Paris Schulden gemacht, die erst bezahlt werden müßten. Da rief Mimi Iswolski lachend: „Aber was für eine Idee, wer wird denn seine Schulden zahlen!“
Bei Ausbruch des Krieges mit Japan war die ganze Familie Iswolsky wieder mit Schwiegermutter vereint in Kopenhagen, wo es zwar selten große politische Fragen gab, aber des öfteren eine Kaiserin-Mutter von Rußland. Von dort aus wurde Alexander Petrowitsch nach Petersburg an die Spitze des Ministeriums des Äußeren berufen, wie so oft hochprotegierte Diplomaten, ohne sich jemals vorher auf einem verantwortungsvollen oder schweren Posten bewährt zu haben. Einige Tage nach seiner Ernennung schrieb er mir noch einen kurzen Brief, in welchem befriedigter Ehrgeiz mit großer Angst um die Zukunft kämpften. Ich bin sicher, daß er erst als Botschafter in Paris restlos glücklich war.
Wie ungeheuer viel liegt doch darin, die richtigen Leute auf den richtigen Platz zu stellen, wie oft werden auch talentierte Menschen zum Verhängnis, wenn man sie vor Aufgaben stellt, denen vielleicht ihr Geist, aber nicht ihr Charakter gewachsen ist. Aber das Schicksal lenken kann keiner, „les hommes s'agi-tent mais Dieu les mene“.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!