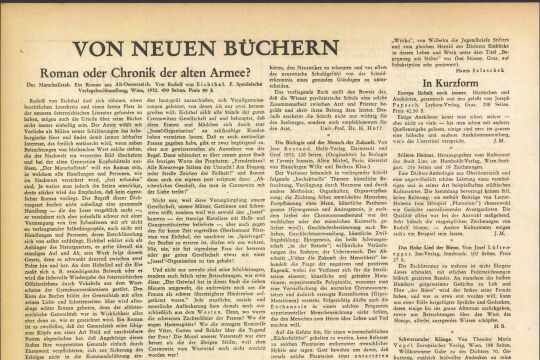Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Frauentum auf der Waage
Attentat auf den Mächtigen. Roman. Von Edzard Schaper. Verlag S. Fischer, Frankfurt. 168 Seiten.
Der „Mächtige", der Oberprokureur des heiligen dirigierenden Synod, der kirchliche Beauftragte und Stellvertreter des Zaren, heißt Pobjedonoszew, und das bedeutet „Siegträger“. Nicht daß die Macht an »ich ein Sieg sei, aber dieser Mann trägt Liebe und Opfermut in sich, während er äußerlich die alte Macht, die traditionelle Macht, die zaristische, absolutistische Macht vertritt. 1901 geht er in eine deutsche Kurstadt, um sich einer nötigen Kur zu unterziehen; dort »oll er einem Attentat russischer revolutionärer Studenten zum Opfer fallen. Im Verlaufe spannender, köstlich in Humor gekleideter Situationen begegnet der „Mächtige“ jener Studentin, die ihn töten sollte. Die Persönlichkeit des Oberprokureurs vernichtet durch weise, lächelnde Behutsamkeit und durch den spürbaren Abstand zu den Dingen und dem Geschwätz der revolutionären Formeln den Mut der Attentäterin, und die beiden, Opfer und Attentäterin, treffen sich wie Vater und Tochter, wie altes und neues Rußland, in heiter gehaltenen, aber um so lösenderen Gesprächen: Liebe, Freiheit, Macht und Gewalt, Massen und einzelner. — Schaper hat in diesem Buche ein Lob der Gewaltlosigkeit geschrieben, jener einzigen geistigen Kraft der Vermittlung zwischen fernsten Lebensbildern und lebendigen Menschen.
Thomas Quercy. Ein Roman. Von Stanislas d’Otremont. Verlag Jakob Hegner, Köln. Uebersetzt von Georg Hermanowski. 311 Seiten. Preis 12.80 DM.
Man denkt an Eichendorffs „Ahnung und Gegenwart“, wenn man diesen Roman liest — obwohl sie verschieden sind wie die Zeiten, von denen beide Bücher berichten. Eichendorffs romantische Lebens- sehpsucht steht gegen die eines Kranken, der seine Geschichte erzählt. Thomas Quercy ist ein von Krankheit Gezeichneter, der sich selbst zu seinen Wurzeln verfolgt: er zieht sich in seine dörfliche Landeinsamkeit zurück, pflegt die Blumenbeete, vor allem die Rosen; wird selbst gepflegt von einer alten, schweigsamen, aber klugen Bedienerin; kommt, ungläubig, wie er zunächst ist, mit seinem Dorfpfarrer gut aus und mit den alten Adeligen des nahen Schlosses; wird geliebt von einem jungen Mädchen, das an dieser Liebe tapfer stirbt; und Hebt selbst ein noch jüngeres Mädchen, durch dessen Liebe er selbst geheilt wird. Das hört sich doch alles sehr einfach und romantisch an. Aber in den Selbstschilderungen des Thomas Quercy runden sich die alt-ewigen Themen des Sichgesundlebens: „die unmittelbare Verbindung mit dem All, die Rückkehr in die tiefen Schichten der Erinnerung, das aufrichtige Suchen nach Gott und jetzt noch … Isabelle“. Jede einzelne Station die;es Lebens und deren Zusammenhang werden mit französischer Räson, Feinfühligkeit und in flüssigem Stile klar und deutlich herausgehoben. Sehnsucht nach Leben und Liebe zum Leben atmet dieses Werk d’Otremonts in sanfter, eindringlicher und bedeutender Weise.
Diego Hanns Goetz OP.
Ein Haus im Hügelland. Roman. Von Erskine Caidwell. Rororo-Taschenbuchausgabe. Deutsch von Doris Brehm. 149 Seiten. Preis 1.50 DM.
Von einem Erskine Caidwell weiß man, was man zu erwarten hat. Für zarte Nerven hat er nicht geschrieben. Dieser Sohn eines Geistlichen aus den amerikanischen Südstaaten hat ein sehr robustes Temperament und versucht durchaus nicht, zu verbergen, daß er unter anderem auch einmal Baumwollpflücker war und daß er sich nicht erst erzählen lassen mußte, wie in South-Carolina, in Georgia und Florida gewisse Weiße mit den Schwarzen umzugehen pflegen. Er hat es selbst mitangesehen und es hat ihn nicht erbaut. Er hat davon eine empfindliche Stelle bekommen, und der Sproß einer heruntergekommenen Sklavenhalterdynastie, der in dem kleinen Roman, den wir hier vor uns haben, in der Gegend herumlärmt, sich betrinkt, sein Geld verspielt und seine junge Frau verprügelt, ist nur einer von denen, die sich Caidwell vorgenommen hat. Er bekam es immer wieder mit solchen Rohlingen zu tun, deren Väter irgendwann einmal zu Großgrundbesitz und Reichtum gekommen waren und dann vom Schweiß der Neger lebten und die Herren spielten und Texasbarone wurden, mit drei bis vier Kebsweibern und den Allüren eines Rowdy. Auch Grady Dunbars Pseudoherrenarroganz ist so perfekt wie seine flegelhaften Manieren, und daß er am Ende mit sechs Kugeln im Leib abgeht, liegt im Bereich des ohnehin schon zu Erwartenden. Aber es ist auch hier noch etwas mit im Spiel, das zu einem Spezifikum Caldwellscher Typen geworden zu sein scheint, denn auch dieser, Grady Dunbar neigt dazu, sich mit Brutalitäten und Quälereien Genuß zu verschaffen, und wo er auftritt, ist der Teufel los. Weil er ein hübscher Bursche war, hatte sich Lucyanne in ihn verliebt; aber sie bekam es dann sogleich zu spüren, daß Grady nicht nur sozusagen mero- wingische Vorstellungen von einer Ehefrau hatte, sondern auch eine sonderbare Art und Weise, mit Frauen umzugehen. Hier gleitet Caidwells Roman von der soziologischen auf die psychologische Ebene hinüber, und es ist bemerkenswert, mit welcher Ausführlichkeit er die Quälereien beschreibt, deren sich Lucyanne zu unterziehen hatte. Obwohl alle Schlüpfrigkeit vermieden ist, spüren wir hier das Fasziniertsein Caidwells von perversen Situationen, und seine Dialoge werden umständlich und in einer fast peinlichen Weise genau. Es tritt auch wieder der weiße Mann auf (wie in „Jackpot“), den der Verkehr mit Negerinnen unfähig gemacht hat, eine weiße Frau zu lieben, und diese seelische Impotenz (eine Besonderheit in den amerikanischen Südstaaten) ist ein psychologisches Ingredienz dieses Romans, das man keinesfalls außer acht lassen darf, denn es fermentiert das Ganze.
Camilla schweigt. Roman. Von Märtha Buren. Aus dem Schwedischen übertragen von Fritz Schaufelberger. Paul-Zsolnay-Verlag, Hamburg und Wien. 300 Seiten.
Es geht in diesem schwedischen Roman um die Komplikation eines Dreiecks oder, um es verständlicher zu sagen, um einen Ehebruch und einen Mann zwischen zwei Frauen. Das ist nicht gerade vertrauenerweckend, denn diese Art von romaneskem Arrangement ist schon vor einem halben Jahrhundert von Rilke als der Einfall der Einfallslosen verspottet worden; jener, die immer den Dritten oder die Dritte brauchen, um ihre Geschichten vom Fleck zu bringen und um von den Zweien abzulenken, um die es gehen müßte. Als ich den schwedischen Titel las: „Den andra Kvinnan“ (auf Deutsch: „Die andere Frau“), war ich denn auch rasch geneigt, dieses Buch beiseite zu legen und es jenen zu überlassen, die nun einmal immer die gleichen Zerstreuungen kauen. Aber ich kam doch nicht dazu, und das, was mich daran hinderte, nicht weiterzulesen, waren die dialogisierten Monologe zweier Frauen, die — post festum muß man hier sagen — Jahre nach dem Tod des gemeinsamen Mannes noch zwei Tage lang miteinander umgingen wie die Katze mit der Maus. Sie trafen sich noch einmal, die einstigen Freundinnen, holten sich aus, schnüffelten aneinander herum, trieben einander in die Enge, belauerten sich und belogen einander, und im Hintergrund, an der Wand, hing das Bildnis des bläßlichen Mannes, der beiden noch immer ein Stachel im Fleisch war. Es war nicht erbaulich, was dabei an den Tag kam, aber es war bemerkenswert und es wurde ein scharf gewürzter Beitrag zur Psychologie des Weiblich- Allzuweiblichen, das nicht hinan, sondern höchstens hinabzieht. Wie sie sich hassen und beneiden, wie sie ihre Ressentiments ins Spiel bringen und ihre Komplexe, wie sie sich lächerlich finden und wie der gewesene Mann noch einmal ein Vorwand wird, um vertagte Rache aneinander zu vollziehen, wie sie sich demütigen, um dann doch vor der allerletzten Rücksichtslosigkeit noch Halt zu machen — das ist mit einer verblüffenden Ungeniertheit dargestellt.
Das macht diesen Roman trotz seiner sonstigen Durchschnittlichkeit lesenswert. Ein wenig geistert hier Strindberg im Raum herum.
Die Dame in Gold. Roman. Von Friedrich Schreyvogl. Verlag Kurt Desch, München, Wien und Basel. 320 Seiten.
Friedrich Schreyvogls „Dame in Gold“ gehört zwar zu den „kakanischen“ Romanen der Doderer, Musil und Joseph Roth, aber er gehört zu dieser respektablen Spezies nur äußerlich und nur deshalb, weil er, wie es im Klappentext heißt, „das kaiserliche Wien der Jahrhundertwende“ ausbreitet. Das ist jetzt in den mittleren Bereichen der deutschsprachigen Literatur gerade le dernier cri; und so schieben sich denn auch in diesem Roman noch einmal die Klimt und Bahr und die anderen Wiener Zelebri- täten über das Fin-de-siecle-Parkett. Auch die Herren Offiziere gehen auf und ab, und die alte Fürstin Pauline Metternich arrangiert die Maiauffahrt und macht Konversation im Sacher-Garten. Der Jugendstil ist an der Reihe, und ein Arbeiter-Bildungs- vereinsfestchen geht wie ein kleinbürgerliches Kaffeekränzchen vor sich. Das alles aber ist nur Vorwand, um eine Liebesgeschichte in Gang zu bringen. Sobald sie anfängt, wird es attraktiv und wie im Märchen. Denn ein armes Mädel aus der Wiener Vorstadt — natürlich ist es wunderschön und hat ein griechisches Profil — wird die Herzgeliebte des reichsten Mannes von Oesterreich und Umgebung, heiratet ihn, wird respektive geheiratet, wird große Dame und später, nach einigen Irrungen und Wirrungen, sogar noch Fürstin. Glück muß man haben, wird sich der Leser sagen. Es ist einfach rührend, wie es vorwärtsgeht, und Kyra ist so schön, so apart und so gut, eine tiefe Seele, und ihr Prinz ist ein äußerst flotter Mann. Es ist aber schade, daß dann der leidige Krieg auf einmal alles vermasselt und die beiden, teilweise so Hochwohlgeborenen, in Gärtnerhäuschen ziehen müssen. Doch dort reifen sie dann innerlich noch sehr, und wenn sie nicht schon gestorben sind, dann leben sie heute noch, vielleicht als Philemon und Baukis.
Ich kann mir denken, daß sich die Firma Hörbiger und Wessely diese Story nicht entgehen lassen wird. Anspruchsvolleren Lesern aber empfehle ich nicht diesen „Kakanismus“, sondern Joseph Roths „Radetzkymarsch", denn glücklicherweise ist er wieder zu haben und billig genug, als Rororo-Druck Nr. 222.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!