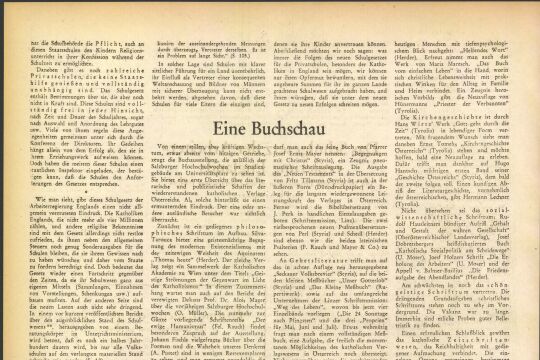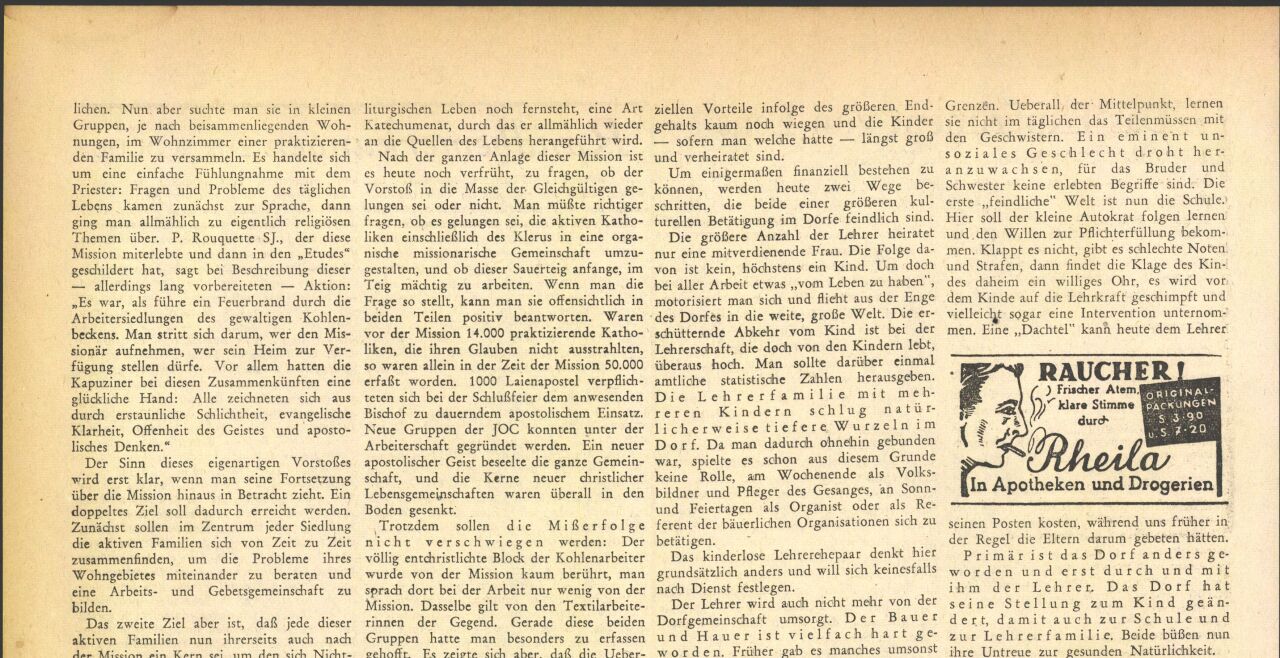
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Entfesselte Phantasie
Die Wiener Festwochen haben uns noch kurz vor Torschluß einige Premierenabende geschenkt, die Klassisches und Modernes mit Geschick und Phantasie in Szene setzten. Das Burgtheater brachte Shakespeares „Viel Lärm um Nichts“ in der Uebertragung von Wolf Graf Baudissin, mit der Musik von Henry Purcell. Wenn Shakespeare Messina auf die Bühne stellt, so ist, was wir sehen, im Grunde nur Kulisse. Unser Zuschauerdasein aber wird zu einem Nichts vor dem Nichts auf der Bühne, das Dasein, Ereignis, Theater wird. Theater, das dem Zuschauer gibt, was ihm gefällt und was er nur will, und doch des Zuschauers gar nicht bedarf, da es in sich geschlossen, selbst ein Universum ist. Das mag auch der Grund dafür sein, daß die verschiedensten Regieauffassungen über ein Stück von Shakespeare nebeneinander bestehen können und gleichermaßen zutreffen. Wenn nur eines dabei bedacht wird: daß jedes Stück, das Königsdrama wie das . Lustspiel, darnach verlangt, als Theater genommen zu werden, um Welt sein zu können. Leopold Lindtbergs Regie wußte das in jeder Szene; besonders aber in den Pausen zwischen den Szenen, die niemals Leerlauf sind. Das ist Theater: wenn die Kulissen gewechselt werden, and die einfältigen Gerichtsdiener, die schon
den Gerichtssaal aufbauen, ihre Mützen ziehen vor dem Altar, der noch herausgetragen wird. Durchsichtig (fast transparent) das Bühnenbild von Teo Otto, das Ensemble vollendet. Viel Applaus.
Die Aufführung von Ferdinand Raimunds Zauberspiel in zwei Aufzügen „Die gefesselte Phanthasie“ im Akademietheater wirft die Frage auf, ob eine Aufführung auch dann gut sein kann, wenn sie nicht unbedingt dem Geist des Dichters entspricht. Dafür würde sprechen, daß „Die gefesselte Phantasie“, als sie vor nunmehr 125 Jahren entstand, einen aktuellen Anlaß hatte. Raimund wandte sich darin gegen den Einbruch rationalistischer Tendenzen in das Reich der zeitgenössischen Dichtung, gegen den phantasielos empfundenen Biedermeier-Zeitgeist. Außerdem war ihm das Stück ein Bekenntnis persönlicher Art, in dem er sein Wesen in zwei gegensätzlichen Verkörperungen auf der Bühne erscheinen ließ und nicht zuletzt auch dem Gerücht einiger Neider entgegentrat, die behauptet hatten, daß er für seine Stücke nur den Namen hergebe. Inzwischen ist die Phantasie längst wieder frei, hat im Surrealismus neue Zauber- und ' Irrgärten entdeckt. Ob dies der Grund dafür war, daß in der Neuinszenierung Ulrich Bettacs Käthe Gold keine gefesselte, sondern vielmehr eine ent-
liehen. Nun aber suchte man sie in kleinen Gruppen, je nach beisammenliegenden Wohnungen, im Wohnzimmer einer praktizierenden Familie zu versammeln. Es handelte sich um eine einfache Fühlungnahme mit dem Priester: Fragen und Probleme des täglichen Lebens kamen zunächst zur Sprache, dann ging man allmählich zu eigentlich religiösen Themen über. P. Rouquette SJ., der diese Mission miterlebte und dann in den „Etudes“ geschildert hat, sagt bei Beschreibung dieser — allerdings lang vorbereiteten — Aktion: „Es war, als führe ein Feuerbrand durch die Arbeitersiedlungen des gewaltigen Kohlenbeckens. Man stritt sich darum, wer den Missionär aufnehmen, wer sein Heim zur Verfügung stellen dürfe. Vor allem hatten die Kapuziner bei diesen Zusammenkünften eine glückliche Hand: Alle zeichneten sich aus durch erstaunliche Schlichtheit, evangelische Klarheit, Offenheit des Geistes und apostolisches Denken.“
Der Sinn dieses eigenartigen Vorstoßes wird erst klar, wenn man seine Fortsetzung über die Mission hinaus in Betracht zieht. Ein doppeltes Ziel soll dadurch erreicht werden. Zunächst sollen im Zentrum jeder Siedlung die aktiven Familien sich von Zeit zu Zeit zusammenfinden, um die Probleme ihres Wohngebietes miteinander zu beraten und eine Arbeits- und Gebetsgemeinschaft zu bilden.
Das zweite Ziel aber ist, daß jede dieser aktiven Familien nun ihrerseits auch nach der Mission ein Kern sei, um den sich Nicht-praktizierende gruppieren. Sie halten Hausversammlungen ab, bei denen nicht nur gebetet und über religiöse Dinge gesprochen wird, auch die weltlichen Interessen werden beraten; man hilft sich gegenseitig in materieller Not, bei Erziehung der Kinder und überlegt, wie anderen geholfen werden kann. Dieses Tatchristentum bildet für den Nicht-praktizierenden, der dem sakramentalen und
fesselte Phantasie ist, die von Unruhe getrieben nur szenenweise beflügelt und leicht ist? Sonst zeigt die Aufführung Vorzüge und Schwächen Raimunds, dem das Parodistische besser gelang als das Allegorische, der Humor (der aus der Gegenüberstellung und Verquickung des Wienerischen und der Plüsch-Romantik seiner Feenwelt lebt) besser als die ernsten Partien, dessen naive Komik ergreifender ist als seine Philosophie. Bester Raimund ist die Darstellung der Raimundrolle des Harfenisten Nachtigall durch Hermann Thimig: heiter, kindlich, wienerisch.
Entfesselt erscheint die Phantasie auch in Joseph Kesselrings „Arsenik und alte Spitze n“, das im Theater am Parkring gespielt wird. Das Kellertheater wird hier zur Mördergrube: Die beiden Spitzenhäubchenschwe-stern Brewster sehen es als ihre Aufgabe an, alte, alleinstehende Herren mit einem Holunderweincocktail (Rezept: ein Viertelliter Holunderwein, ein Löffel Arsenik, etwas Strychnin, eine Spur Zyankali) vor einem allzu einsamen Lebensabend zu bewahren. Mit ihnen im Wettstreit steht ihr Neffe Jonathan, der aber aus egoistischen Moti-
ven handelt. Die Aufführung ergab ein gut gebautes Lustspiel, das mehr Groteske als Travestie ist. In der Betonung des Gegensatzes zwischen der übertriebenen Persiflierüng der Morde und der simplen Liebesgeschichte der normalen Randfiguren wird dies deutlich. Dahinter steht aber das Element der Satire kaum zurück, die herzlich über Hollywoods Gruselfabrik samt Frankenstein-Inventar lachen läßt. Ein drittes Element darf nicht vergessen werden: der „Schwarze Humor“, der es zulaßt, daß „Der Mord als schöne Kunst betrachtet“ wird (Thomas Quincey), der, wie ihn Audiberti charakterisiert, für das Falsche plädiert, um das Wahre zu sagen. Die Aufführung Wolfgang Glücks hielt sich nicht lange bei solchen philosophischen Ueberlegungen auf: sie bot ein bühne:> wirksames Schauerkabinett (aufgebaut von Gerhard Hruby) und hatte die Lacher auf ihrer Seite.
Wieland Schmied
Das Theater der Courage bringt als Frühsommerpremiere in Uraufführung das Stück eines jungen Oesterreichers, „Ein Boot will nach Abaduna“ von Kurt Benescb. Eine symbolhafte Geschichte, mit Erinnerungen an Kafka, Camus und andere, die dennoch ein eigenes Talent verrät, das sich von den angelesenen Themen lösen, und von klischeehaften Gestalten (so hier ein unmöglicher Priester) befreien kann. — Eine Handvoll Menschen, auf der Flucht aus einem terroristischen Land, in ein Land, das als Paradies erträumt, erfühlt, dumpf gedacht wird. Worauf der an Bord erscheinende Einwanderungskommissar, der die Einlaßscheine ins Paradies zu vergeben hat (er selbst eine Mischung aus Höllenkommissar und Engel vor dem Himmelstor nach Adams Fall) zunächst feststellt, daß alle diese Flüchtlinge arme Sünder sind, und die einen begnadet und die anderen verwirft oder zumindest zum Fegefeuer verurteilt. Diese letzteren haben auf dem Boot entlang der Küste des gelobten Landes zu fahren bis zu ihrer Läuterung. — Diese einfache Story dramatisiert Benesch durch die Ermordung des linientreuen Kapitäns und seines Steuermanns und durch eine nicht ungeschickte Charakterisierung seiner Typen. — Die Aufführung leidet unter der grellen Härte der Regie, zeigt aber einige beachtliche Talente und ist durchaus zu verantworten. Wer sollte denn sonst solche Stücke junger Autoren spielen und ihnen damit Gelegenheit geben, zu lernen, und dem Publikum Gelegenheit, einen Blick in die Werkstatt der Jungen zu tun, wenn
nicht diese Kellertheater? „ . , . , TI
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!