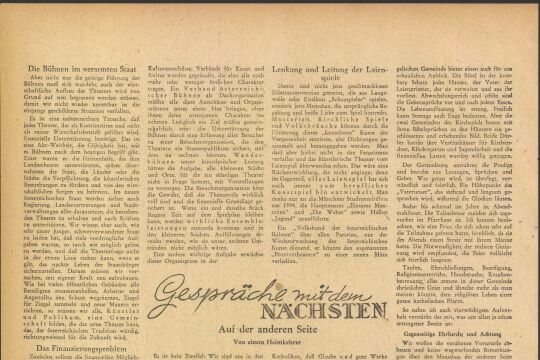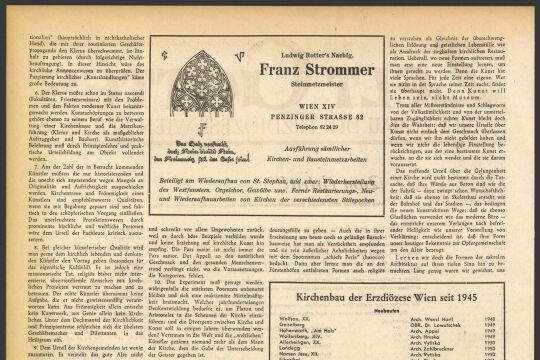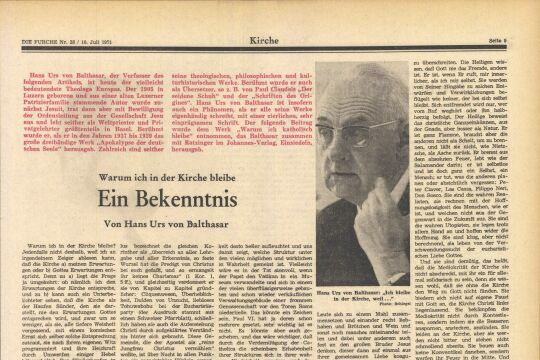Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Bleibt die Kirche ein Ort des Schönen?
„Das Schöne wird die Welt erlösen“ sagt Dostojew-skijs „Idiot“, der Fürst Myschkin. Alexander Solsche-nizyn hat sich dieses Wort in seiner Nobelpreis-Rede zu eigen gemacht. Es mag hilfreich sein, Überlegungen zum Verhältnis von Glaube und Schönheit, wie von Kirche und Schönheit mit der Erinnerung an diese beiden russischen Christen zu verbinden. Der Autor der „Aufzeichnungen aus einem Totenhaus“ und jener des „Archipel Gulag“ sind in ihrer Zuwendung zum Schönen ja nicht in Gefahr, als ethisch unangestrengte ,Jistheten“ im landläufig abwertenden Sinn dieses Wortes mißverstanden zu werden.
„Das Schöne wird die Welt erlösen“ sagt Dostojew-skijs „Idiot“, der Fürst Myschkin. Alexander Solsche-nizyn hat sich dieses Wort in seiner Nobelpreis-Rede zu eigen gemacht. Es mag hilfreich sein, Überlegungen zum Verhältnis von Glaube und Schönheit, wie von Kirche und Schönheit mit der Erinnerung an diese beiden russischen Christen zu verbinden. Der Autor der „Aufzeichnungen aus einem Totenhaus“ und jener des „Archipel Gulag“ sind in ihrer Zuwendung zum Schönen ja nicht in Gefahr, als ethisch unangestrengte ,Jistheten“ im landläufig abwertenden Sinn dieses Wortes mißverstanden zu werden.
Was aber ist schön? „Der Glanz der Wahrheit“? - „Was beim Anschauen gefällt?“ - „Die allgegenwärtige verborgene Mathematik der Natur?“ Der hier gegebene Rahmen reicht nicht aus, solche alten oder neuen Definitionsversuche näher zu bedenken oder das Schöne im Umfassenderen von Kunst und Kultur zu situieren. Solche Bescheidung versetzt ohnedies in zahlreiche Gesellschaft: Die meisten Menschen wissen sehr wohl, was für sie (und erfahrungsgemäß für viele andere) schön ist. Sie haben aber auf die Frage nach dem Schönen keine Theorie bereit, sondern zeigen auf etwas in Natur oder Kunst hin, das - poetisch geredet - „hinreißt und tröstet und hilft“.
Geht es dem Christentum überhaupt um dieses Schöne? Hat in solcher Hinsicht Jerusalem wirklich wesensgemäß und nicht bloß faktisch etwas mit Athen gemein? Freilich ist die europäische Kunstgeschichte, insofern sie vom Schönen handelt, zum großen Teil auch Kirchengeschichte. Ist aber das Christentum nicht mehr dem nüchternen Wahren und dem alltäglich zu tuenden Guten verschrieben als der beseligenden Schau des Schönen?
Der protestantische Theologe Gerhard Nebel hat immerhin behauptet, die Welt des Neuen Testamentes sei des Schönen gänzlich bar; die Galiläer, unter denen das göttliche Wort Fleisch wurde, seien provinziell, kulturlos, und es sei unausdenkbar, daß hier Schönes geschehen sollte. Kritisch gegenüber katholisch-kultureller Pracht sagt Nebel weiter: „Wem immer es auf Weltbreite, auf gestaltete Räume, auf heroisches Menschentum, auf Sittlichkeit, Formenpracht und mythische Emigration ankommt, wird sich vom Protestantismus abgestoßen fühlen. Luther hat die Goldkammern des Mythos zerstört und die dürftige Stiftshütte an ihre Stelle gesetzt. Wer das Schöne liebt, wird in der Scheune der Reformation frösteln wie Winckel-mann und nach Rom ziehen.“
Diese protestantische Ästhetikkritik hat, so scheint es, einige Entsprechungen in der katholischen Tradition: Bernhard von Clairvaux bekämpft die religiöse Prachtentfaltung der Clunia-zenser. Franz von Assisi bleibt (im Urteil Hans Urs von Balthasars) „aller Ästhetik fremd und voraus“. Gleiches gilt für Ignatius von Loyola.
Aber der „puritanische“ Eifer Bernhards bewirkt dennoch nichts als die bewegend schöne Einfachheit der Zisterzienserarchitektur. Und dem durch Franziskus ausgelösten geistigen Schock drängt sich sogleich und von allen Seiten das Ästhetische an und bietet sich als Schale und Ausdrucksform dar (wie wiederum Urs von Balthasar bemerkt hat). Die Dynamik des Ignatius schließlich faltet sich aus in barocker Kunst, und Johannes vom Kreuz wird durch dunkle Nacht und Wüste hindurch das schöne Wort zuteil, das ihn zum größten Dichter Spaniens werden läßt.
Im Neuen Testament, das allen diesen Heüigen Maß gibt, ist Schönheit als Eigenschaft der Schöpfung gewiß keine zentrale Kategorie. Die schönen Lilien des Feldes sind nicht interesselos anzuschauen. Man soll von ihnen vielmehr lernen, sich jenem Gott anzuvertrauen, der schon das „Gras“ so herrlich kleidet und darum den Menschen noch viel weniger aus seinem Segen fallen läßt. Erst in der Apokalypse, dem letzten Buch der Bibel, ist ausschwingend vom Schönen die Rede: Als Inbegriff erfüllter Hoffnung erscheint hier das himmlische Jerusalem, die „geliebte Stadt“, das wiedergewonnene und noch überbotene Paradies. Diese Stadt ist zugleich ein Ort der Schönheit und der Güte, denn ihr Maß ist vollkommen und nichts Böses findet in sie Einlaß. Hier ist endlich vereint, was in der Geschichte immer wieder auseinanderfällt zur tiefen Kluft zwischen Ästhetik und Ethik.
Was der Christ als ewiges Ziel erhoffen darf, ist nicht nur gut, sondern auch schön. Es erscheint daher nicht ins Belieben der Christen gegeben, das Schöne gering zu schätzen, gerät es doch dem gläubigen Schauen zum Vor-Schein und dem gläubigen Hören zum Vor-Klang des ewigen Lebens, zum eschatologischen Glanz und Klang.
Gewiß ist dieses Schöne für Christentum und Kirche nicht von selbst schon eine Art von „Sakrament“. Abgelöst von Güte und Wahrheit kann es zum Götzen werden; es kann nach dem schönen bösen Engel geraten, der nicht Abglanz Gottes, sondern selbst die Mitte sein wollte; es kann in hochkirchlicher Sterilität erstarren. Die Zuwendung des heiligen Pfarrers' von Ars zu religiösem Kitsch ist ein bleibendes sanftes Gericht über jeden kirchlichen Ästhetizismus. Und Dostojewskij begriff das welterlösende Schöne ja vor allem als den schönen, weil guten, Christus ähnlichen Menschen und nicht als ein künstlerisches Objekt. Trotz solcher gebotener Relativierung bleibt es in katholischer Sicht der Kirche jeder Epoche aufgegeben, des Schönen als Kunst aber auch als Natur zu achten, es ermöglichen und bewahren zu helfen.
Kirche als Ort des Schönen? Steht das heute und hierzulande überhaupt in Frage? Gewiß hat beispielsweise in Österreich keine andere Institution soviel an Schönem in nicht museal gewordenem „Besitz“ und „Gebrauch“ wie die katholische Kirche mit Kirchenhaus, Kloster, Gemälde, Skulptur und geistlicher Musik. Nur ein geringer Teil von all dem entstammt freilich der jüngsten Zeit. Das meiste ist altes Erbe und als solches doppelwertig,. ebenso Geschenk wie Last.
Zunächst Last im schlicht ökonomischen Sinn als Baulast zur Denkmalpflege, die nicht zuviel vom Kirchenbudget aufzehren soll. Dann aber gerät es vielen zur nicht immer bewußten moralischen Last: Die toten Väter im Glauben waren in der Dimension des Schönen, ja der Kunst überhaupt, offenbar größer als die heute Lebenden. Mag es in anderen Dimensionen auch umgekehrt sein, solche Last der Toten verursacht leicht Ressentiment, pauschale Denunzierung des Schönen als Luxus und falsche Repräsentation und die Aufrichtung eines scheinbar unversöhnlichen Gegensatzes zwischen „schön“ und „gut“, zwischen „ästhetisch“ und „ethisch“. Man darf sich in diesem Zusammenhang an eine Bemerkung J. P. Sartres über Tizian erinnern, dessen „radioaktiver“ Leichnam jüngere Maler an der Entfaltung gehindert habe.
Ort und Zeit für das Schöne in def Kirche wäre vor allem die Liturgie. „Wie ist so glanzlos geworden das Gold!“ Solche biblische Klage hört man heute nicht selten in Zusammenhang mit einem Verlust an Gestalt, Sprache, Farbe als Folge der jüngsten Liturgiereform. Aber alles restaurative Lamento trägt wenig dazu bei, daß Kirche und Liturgie prophetischer, schöner, färbiger, klingender werden. Es bedarf vielmehr der Menschen, die auch außerhalb der Liturgie „katholisch“ sind: In Kommunikation mit Toten, Lebenden und noch nicht Geborenen; mit ihnen fühlend, leidend und sich freuend. Einer solchen Katholizi-tät werden geisterfüllte Sprache und Form auf Dauer nicht fehlen.
Auch die Wohnung des Christen ist, jenseits der Alternative schlicht oder prächtig, ein Indiz dafür, ob solche Ka-tholizität begriffen worden ist. Gewiß gibt die Anekdote zu denken, die erzählt, eine Ordensoberin habe - wegen der schönen Einfachheit ihres Klosters gerühmt - lächelnd bemerkt, das Haus
-ätz MnutFitiöV. -ttwntü. doM 7tnsnih' wäre noch einfacher geraten, wenn man mehr Geld gehabt hätte. Das einfache Schöne ist aber nicht notwendig auch das teuerste. Oft signalisiert ja die Warenhaus-„Ästhetik“ von „katholischen Büros“ und Wohnungen nicht jene Bescheidenheit, die dem Christen zweifellos ziemt, sondern Mangel an Phantasie und Unkenntnis der Tatsache, daß man nicht nur mit Worten, sondern auch mit Materialien und Formen „lügen“ kann Die umstrittene Integrierte Gemeinde in München hat jedenfalls begriffen, daß man die Alternativen zu alldem nicht der Anthroposophie und ähnlichen geistigen Bewegungen überlassen muß.
Auch in Zukunft sollte das Schöne in der Kirche zu einem großen Teil das dankbar geerbte alte Schöne sein dürfen. Zwar sagte ein junger amerikanischer Benediktiner nach dem Konzil, als der Papst seinen Orden gebeten hatte, den gregorianischen Choral weiterhin zu pflegen, richtig: „Wir sind keine Museumswächter!“ Man ist aber, und das wußte der junge Mann offenbar nicht, kein Museumswächter, wenn man den ererbten liturgischen oder monasti-schen Raum so bewohnt und ererbtes Gerät und Lied so „gebraucht“, daß sie eben nicht museal werden.
Neben dem Recht für die Toten geht es aber um das Recht der Lebenden und jener, die nach uns kommen. Auch ihnen und ihrer Kunst, von welcher ein Bruchteil eines Tages als schön empfunden werden wird, hätten sich Christen und Kirche als Institution zuzuwenden und mit ihnen unbefangen zu kommunizieren. So könnte verhindert werden, daß Kirche und Kultur so auseinanderfallen, wie dies in einigen romanischen Ländern im Ganzen geschehen ist.
Hätten Christen zwischen Güte und Schönheit zu wählen, dann stünde der Vorrang der Güte außer Zweifel. Für gewöhnlich gilt es aber, nicht zu wählen, sondern zu verbinden. Vor dem leicht erworbenen Vorwurf, es gehe hier um Elite und Hochkultur, brauchte man in der Kirche keinesfalls mehr Angst zu haben als in jenen Großgruppen, aus deren Reihen er am häufigsten zu vernehmen ist.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!