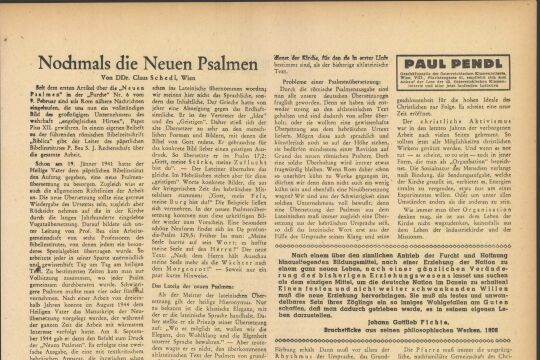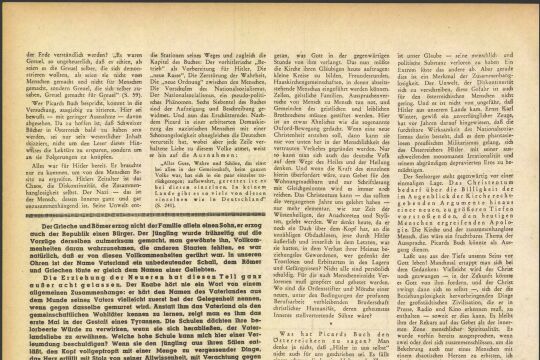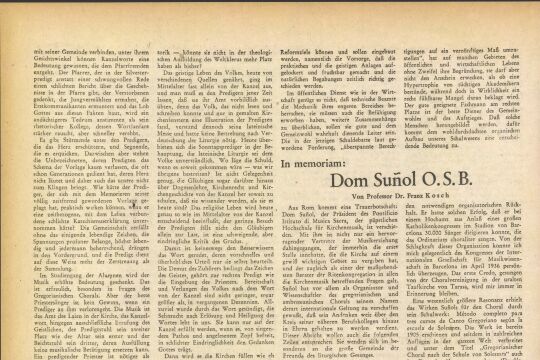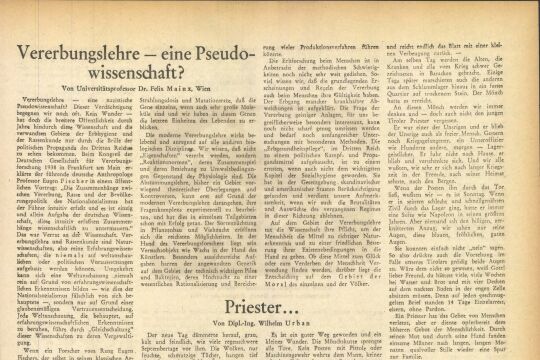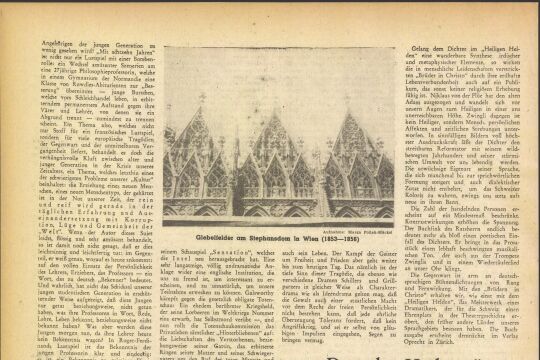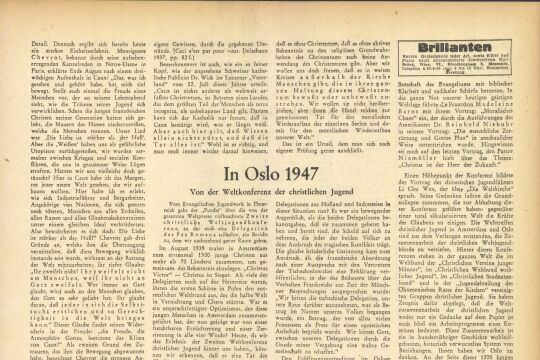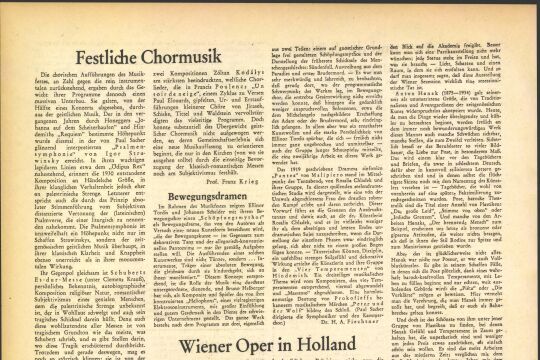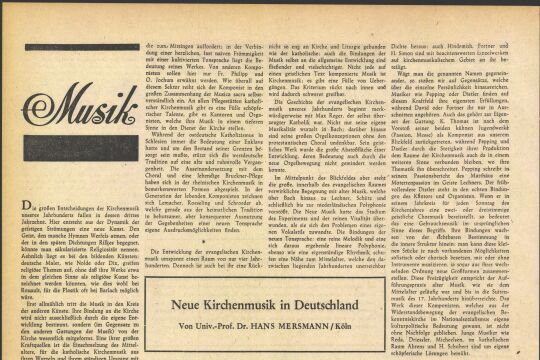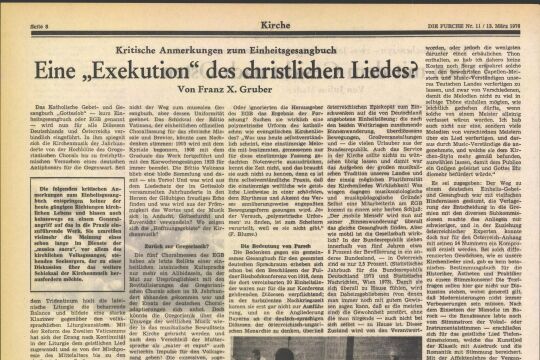Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Modeme Kirchenmusik für die ganze Gemeinde
Die Konstitution über die heilige Liturgie des II. Vaticanum hat zwar die bisher schillernd-unklaren Aussagen über die Kirchenmusik - bei Pius X. und Pius XII. „ancilla“ und „admini- strata“ (Magd und Helferin) im liturgischen Vollzug - eliminiert, mit deren Rangerhöhung die Verwunderung der versammelten Konzilsväter hervorgerufen. Das ihr gewidmete VI. Kapitel war an Umfang gleich dem der Gesamtmesse, aber mit der bedingten Gültigkeit des Gregorianischen Chorals und der hemmungslosen Demokratisierung des Volksgesanges wurde den Experimentierern in der Kirche Tür und Tor geöffnet. Die Vollwertigkeit der Musik hatte zwar die Funktionsgleichheit mit dem gesprochenen Wort hergestellt, dem nun folgendem Dilemma aber nicht abgeholfen! Ein Dammbruch schien alles fortzuschwemmen. Singende Kapläne und dilettierende Außenseiter machten sich ans Werk, das Gesamtwerk überlieferter Kultur vom Grund auf zu zerstören und mit dem Einströmen der Songrhythmen in die Subkultur unterzutauchen. Sollten sie den „notwendigen Teil der feierlichen Liturgie ausmachen und die heilige Handlung begleiten?“
Wie sollte die nun anhebende Kirchenmusik zu einer neuen schöpferischen Phase kirchlicher Kunstgesinnung werden, wenn sie sich so weit von den Ursprüngen und der Vorbildhaftigkeit des Chorals entfernte, die bisher besagte, daß „alles liturgische Singen in ähnlicher Weise, wie er es tut, aus tieferen geistigen Quellen schöpfen und nach ähnlich vollendeter Übereinstimmung von Darstellung und Inhalt suchen muß“ (Urbanus Bomm).
Der Reichtum von unschätzbarem Wert, den uns die Meister der lateinischen Ordinariumsgesänge der Messe hinterließen, muß vielfach in den Konzertsälen zum Klingen gebracht werden, denn der Übergang zu der folgenden Praxis legte nur mehr das Gerippe von der einst so ergiebigen Symbiose von Wort und Ton im liturgischen Raum bloß, am Schwall der Wort- Tonhülsen konnte sich die Meditation nicht entzünden, die in der klassischen Messe das Innere des gläubigen Menschen ausleuchtete: Von der Depression des Kyrie zum Jubelschrei des Gloria, vom Gleichschritt des Credo zum Lösepreis des Agnus Dei, das Heiligkeit im Sanktus und Benediktus uns zuteil werden läßt!
Das Aufgeben der lateinischen Kultsprache mußte die unerträglich zerredeten „Kommentarmessen“ auf den Plan rufen, an deren Anfang und Ende nicht das zeugende Wort, sondern die Wortfülle des Mystagogen steht; die Messe zelebriert sich erst aus dem Wust des Gesprochenen und verabsolutiert sich im „Gesamtwerk“ der Rollenträger im Gottesdienst, die aktivierend und rezipierend das Wort empfangen und zurückgeben, um sich so an der „participatio actuosa“ zu engagieren! Dem Wort in der Muttersprache war damit Genüge getan, die Analogie im Musikalischen sollten die „Jazzmessen“ erbringen.
Der elitäre Charakter der Kirchenmusik hatte sich seit den Tagen der Romantik zum letzten Mal (Franz Liszt und Anton Bruckner) ernstlich mit den Strömungen der gegebenen Zeit und deren Wandel im Musikalischen auseinandergesetzt. Ausnahmen in der Zwischenkriegszeit bestätigen die Regel. Der Anschluß an den Jazz kam leider zu spät und wurde mit den Bemühungen des Amerikaners Charles Edward įves (1874-1954) von den euro päischen Musikern nicht zur Kenntnis genommen, erst 1930 wurden dessen Kompositionen - Amalgamierungsversuche des Jazz mit amerikanischer Musik - auch bei uns bekannt
In dieser Bedrängnis kam die Adaption der gregorianischen Formeln dem Wort-Ton Verhältnis in der neuen Liturgie zu Hilfe. Aber sehr bald stellte sich heraus, daß hier eine Vergewaltigung der deutschen Sprache mit den lateinischen Melodieformeln vor sich gegangen war. Eine Verfremdung der Sprache kam in dem Sinne zustande, daß die gregorianische Vertonung mit der Nebenordnung der Silben rechnet, die deutsche mit der Unterordnung.
„So wurde der deutsche Präfations- text den bekannten Formeln unterlegt Durch die stete Wiederholung gleichbleibender Rezitationsformeln entbehren wichtige Sinnakzente eines musikalisch-deklamatorischen Reliefs. Weil die natürliche Gestaltung der Wort-, Satzglied- und Satzakzentuierung fehlt, wirken die vertonten Texte spannungslos und eintönig. Der Duktus der melodischen Formeln, wie sie hier Verwendung finden, ist für die lateinische Sprache geschaffen worden. Die plötzliche Erhebung einer imbetonten Silbe auf den nachfolgenden Tonus rectus und die damit verbundene falsche Betonung verletzen das Gefühl für eine richtige musikalische Sprachbehandlung, und das in einer Zeit, da in der weltlichen Musik, im besonderen in der Oper, das Verhältnis Sprache und Musik eine weitere Klärung erfahren hat.“ (Hermann J. Burbach)
Als Grundanliegen stellt sich das gestörte Sprachverhältnis heraus, das es von der Wurzel her zu sanieren gilt. Schüchterne Lösungsversuche liegen für den deutschen Sprachbereich allenthalben vor. Als stabilisierendes Element bietet sich wieder die lateinische Kultsprache an, von der Egon Wellesz (1885-1974) behauptet: „Ich habe den lateinischen Text genommen (für das Canticum sapientiae, op.104), nicht allein des reinen Klanges der Worte wegen, sondern auch, weil die von der Zeit losgelöste lateinische Sprache dem Musiker das gewünschte Medium bietet, in Tönen zu sagen, was er sagen muß, ohne sich in die Bindung eines gegenwärtigen Idioms zu begeben.“
Wenn es auch nur wenige nach dem II. Vaticanum geschriebene lateinische Messen gibt, - die Gründe sind bei vielen Komponisten aus Rentabili tätsgründen durchschaubar, aus der lateinischen Weltsprache wurden die vielen regionalen Kultsprachen, - so könnten sie wegweisend für die Zukunft werden, da sie unbeschwert von den Lasten der Vergangenheit das Bündnis mit der modernen Gegenwart im musikalischen Geschehen nicht scheuen.
In seiner „Missa super duodecimales modos“ erweist sich Anton Heiller als Nachfahre Alban Bergs und Vollender der Wiener Schule Arnold Schönbergs; die lateinische Messe des Begründers der Zwölftonmusik, Josef M. Hauer, von 1926 wurde nach Zuendeführung durch Nikolaus Fheodoroff erst 1972 zur Uraufführung gebracht. Damit hat die serielle liturgische Musik ihren Einzug in die Kirche gehalten und neue Entwicklungen der musica sacra anvisiert. Dem Bedürfnis nach mehr Kontinuität liegen die für die Wiener Sängerknaben komponierte Missa Viennensis von Peter Planyavs- ky, die Messe: „Gib uns den Frieden“ (1970) von György Ligety aus den Jahren 1963 bis 1965 und von Dieter Gais- bauer (1973) zu Grunde.
Überraschend groß ist das Angebot nicht für die Liturgie bestimmter Werke für Aufführungen zu Weihestunden in der Kirche oder im Konzertsaal, als sollte hier die Automatik des Wort-Tonvollzuges in der Liturgie durch mehr Möglichkeiten zur Meditation Genüge getan werden. Leonard Bemstein’s „Mass“ stehe hier für die vielen anderen! Zur Eröffnung des Kennedy-Centers 1971 geschrieben, ist sie keine Messe im Sinne eines kirchlichen Gottesdienstes, sondern eine Reflexion darüber, was in Menschen vorgeht, wenn sie einer katholischen Messe beiwohnen. Bernstein bezeugt damit seinen „Glauben an den Glauben“.
Die künstlerische Note der vielfältig erscheinenden Propriengesänge und Deutschen Messen wird sich dann einstellen, wenn sie sich aus der Sphäre liturgischer Gebrauchsmusik herauslösen und sich den großen Vorbildern in dieser Sparte der Kirchenmusik, Michael Haydn (117 Gradualien und 45 Offertorien) und den zeitlosen Einlagen Anton Bruckners bewußt anschließen. Allzu lange haben hier nur Lückenbüßer das Feld beherrscht, und erst über den Zusammenschluß qualitätsvoller Ordinariums- und Propriengesänge aus Meisterhand könnte der verpflichtende Kanon der Deutschen Messe der Zukunft sich zu neuen Gipfeln aufschwingen.
Schon lassen das Deutsche Ordina- rium (1966), das Deutsche Proprium zum Dreifaltigkeitsfest für Chor, Volk und Orgel (1967) und die Kleine Deutsche Messe für Kinderchor und Orgel (1976) Anton Heillers aufhorchen, ebenso wie die Deutsche Messe für gemischten Chor a cappella (1974) Michael Radulescus.
Dem Sprachmelos galten zu Zeiten der Volksliturgischen Bewegung die Bestrebungen Vinzenz Gollers und später Hermann Kronsteiners; ihre bahnbrechenden Versuche waren für die kommende Zeit Modelle, von den simplen Imitationen des gregorianischen Chorals Abschied zu nehmen. 1974 wurden so die einstimmigen modalen „Deutschen Choralgesänge“ Augustin Kubizeks für das monasti- sche Brevier der Benediktinerkonvente beendet, oder die St. Michaels- Messe ebenfalls auf der Basis des deutschen Choralgesanges.
Das Schicksal der vielen Kirchenchöre wird von der Aufgabe abhängen, die ihnen abverlangt und der Förderung, die ihnen von den offiziellen kirchlichen und staatlichen Stellen entgegengebracht wird. Nur sterilisierte a-cappella-Sätze der Renaissance zur Wiedergabe zu bringen, erzeugt Nostalgie! Darum die bewegte Mahnung der Konzilsakte, die Kirchenmusiker mögen „Vertonungen schaffen, welche die Merkmale echter Kirchenmusik an sich tragen und nicht nur von größeren Sängerchören gesungen werden können, sondern auch kleineren Chören angepaßt sind und die tätige Teilnahme der ganzen Gemeinde der Gläubigen fördern.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!