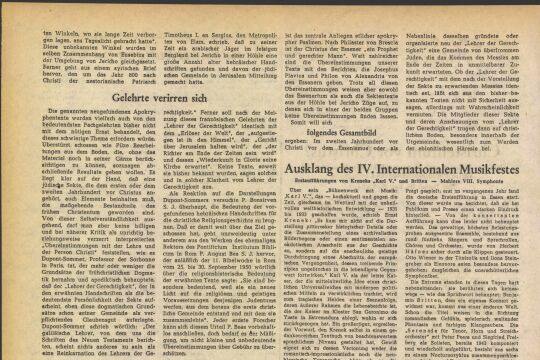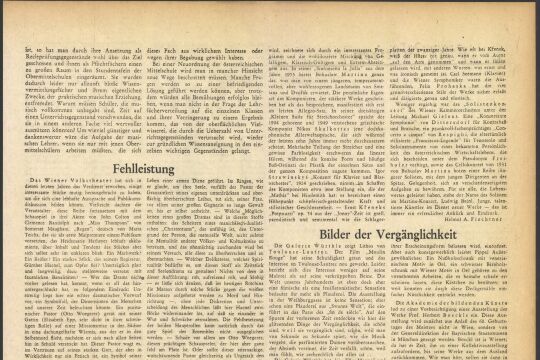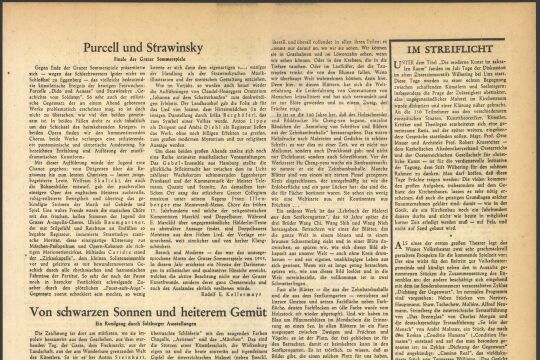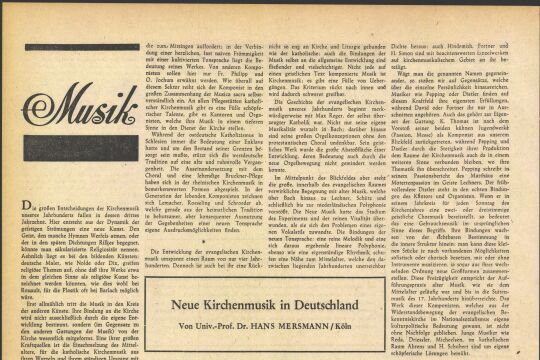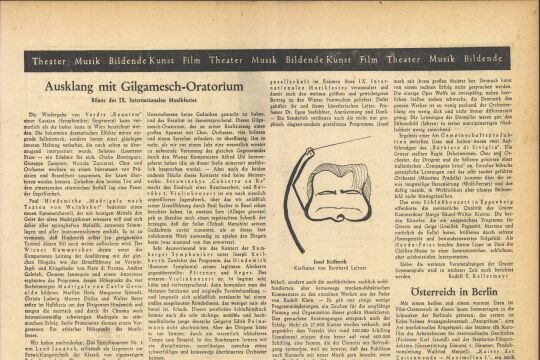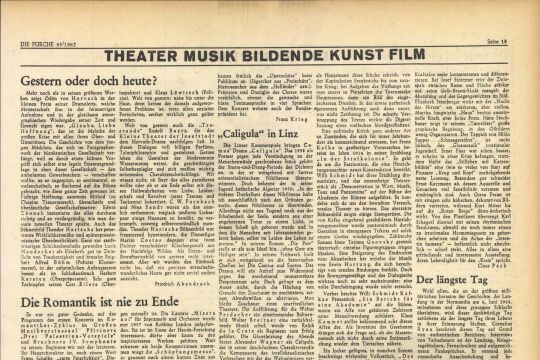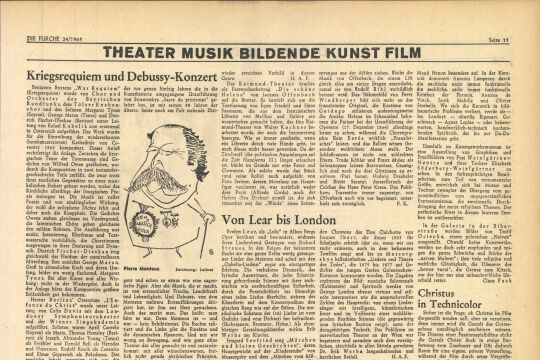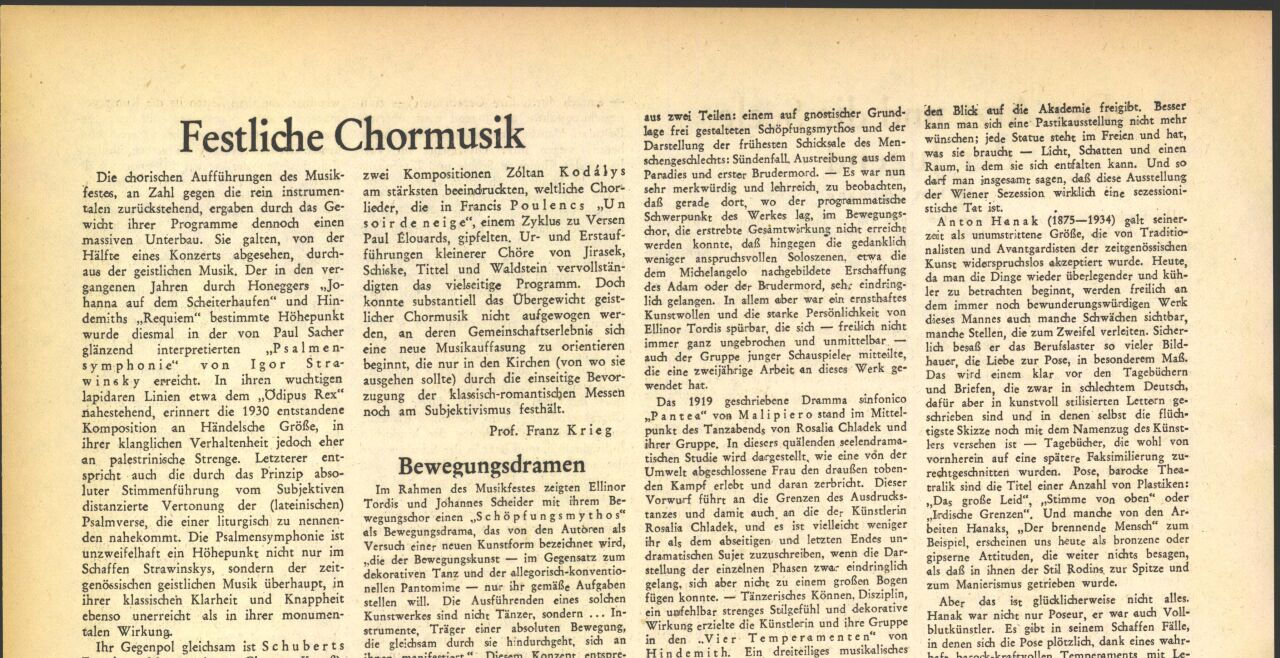
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Festliche Chormusik
Die chorischen Aufführungen des Musikfeste , an Zahl gegen die rein instrumentalen zurückstehend, ergaben durch das Gewicht ihrer Programme dennoch einen massiven Unterbau. Sie galten, von der Hälfte eines Konzerts abgesehen, durchaus der geistlichen Musik. Der in den vergangenen Jahren durch Honeggers „Johanna auf dem Scheiterhaufen“ und Hin- demiths „Requiem“ bestimmte Höhepunkt wurde diesmal in der von Paul Sacher glänzend interpretierten „Psalmensymphonie“ von Igor Stra- w i n s k y erreicht. In ihren wuchtigen lapidaren Linien etwa dem „Ödipus Rex“ nahestehend, erinnert die 1930 entstandene Komposition an Händelsche Größe, in ihrer klanglichen Verhaltenheit jedoch eher an palestrinische Strenge. Letzterer entspricht auch die durch das Prinzip absoluter Stimmenführung vom Subjektiven distanzierte Vertonung der (lateinischen) Psalmverse, die einer liturgisch zu nennenden nahekommt. Die Psalmensymphonie ist unzweifelhaft ein Höhepunkt nicht nur im Schaffen Strawinskys, sondern der zeitgenössischen geistlichen Musik überhaupt, in ihrer klassischen Klarheit und Knappheit ebenso unerreicht als in ihrer monumentalen Wirkung.
Ihr Gegenpol gleichsam ist Schuberts Es-dur-Messe (unter Clemens Krauß), persönliches Bekenntnis, autobiographische’ Komposition religiöser Natur, romantischer Subjektivismus eines genialen Menschen, dem die palestrinische Strenge unbekannt ist, der in Wohllaut schwelgt und auch sein tragisches Schicksal darein hüllt. Denn auch diese wohllautendste aller Messen ist von tragischem Grundton wie das meiste, was Schubert schrieb, und es gibt Stellen darin, wo diese Tragik erschütternd durchbricht. Trotzdem und gerade deswegen, mag es noch so störrisch klingen: sie ist von der Liturgie weiter entfernt als die Psalmensymphonie Strawinskys. Denn in der Liturgie, der Gemeinschaft der Heiligen, hat der Einzelne und sein Schicksal aufgehört, zu sein.
Als geistliche Kantate hat auch „D e r verlo’rene Sohn“ von Debussy zu gelten, obgleich die religiöse Beziehung hier nur durch den Text vermittelt wird. Die Musik hat ihre Schönheiten und Besonderheiten, doch keine geistlichen Töne. Man erlebt höchst angeregt und interessiert das Werden einer Klang weit, die Debussy heißt, aus ihren Massenetschen und anderen Wurzeln, lächelt erstaunt über den Wagner-apothetischen Ausklang und ist am Ende für das ganze Werk weniger begeistert als für den, der es mit zwanzig Jahren schrieb.
Als kirchenmusikalischer Beitrag zum Musikfest ist vor allem die Uraufführung der Missa Cantate Domino von Ernst T i 11 e 1 in der Franziskanerkirche zu würdigen (Leitung: Prof. Dr. Gillesberger), die einen kirchenmusikalisch bedeutenden Versuch der Erneuerung barocker Mehrchörigkeit und damit musikalischer Gottesraumgestaltung darstellt. Dieser Versuch ist, wenn auch zuvörderst in archaistischem Sinne, geglückt. Darüber hinaus ist die Messe ein reifes, mit sicherer Meisterhand geschriebenes Werk von ruhiger Haltung und liturgischem Ernst, dem innerhalb der zeitgenössischen Kirchenmusik wohl eine Art palestrinischer Funktion zusteht.
Bruckners e-moll-Messe und Haydns Nelsonmesse (Burgkapelle und Michaelerkirche) boten weder kirchenmusikalische noch musikfestliche Höhepunkte. Dagegen brachte eine „G e i s 11 i c h e A b e n d m u s i k“ in der Karlskirche (Prof. Mertin) eine hochinteressante Auswahl alter Kirchenmusik, sonst kaum zu hören, zu trefflicher Wiedergabe. Man verspürte den Sprung über die Jahrhunderte kaum, als auf Perotinus (dessen „Sederunt principe “, um die Hälfte gekürzt, die doppelte Wirkung erreicht hätte), Oke- ghem, Josquin und Monteverde die Offenbarungsmotetten von J. N. David folgten, den Entwicklungsbogen des Jahrtausends kirchenmusikalischer Polyphonie gleichsam krönend.
Das Konzert des Wiener Kammerchors (Dr. Reinhold Schmid), des vielleicht reinst gestimmten heimischen Chorinstruments (nur durch die schnelle Ermüdung der Soprane beeinträchtigt), bot als einziges neben auch hier das Schwergewicht tragenden geistlichen Gesängen, worunter ein Gloria von Vaugham Williams und zwei Kompositionen Zöltan Ko da lys am stärksten beeindruckten, weltliche Chorlieder, die in Francis Poulencs „Un soir de neige“, einem Zyklus zu Versen Paul Elouards, gipfelten. Ur- und Erstaufführungen kleinerer Chöre von Jirasek, Schiske, Tittel und Waldstein vervollständigten das vielseitige Programm. Doch konnte substantiell das Übergewicht geistlicher Chormusik nicht aufgewogen werden, an deren Gemeinschaftserlebnis sich eine neue Musikauffasung zu orientieren beginnt, die nur in den Kirchen (von wo sie ausgehen sollte) durch die einseitige Bevorzugung der klassisch-romantischen Messen noch am Subjektivismus festhält.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!