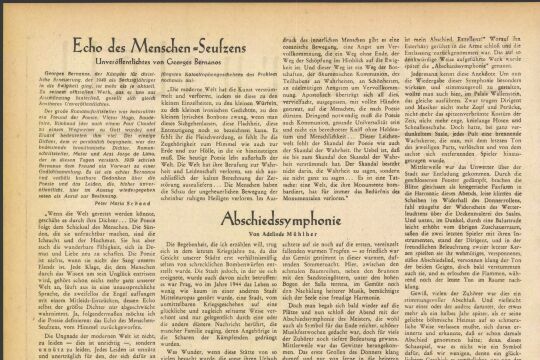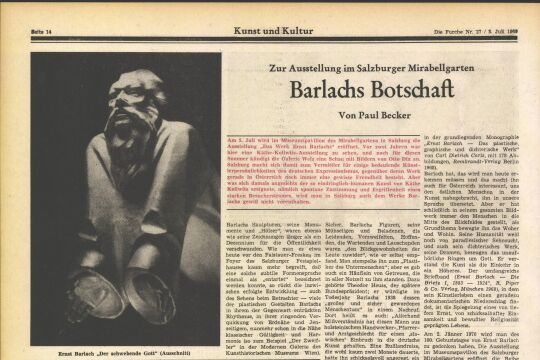Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Problematischer Fidelio
Ein Beispiel dafür, wie bei einer Regieführung Theorie und Praxis auseinanderklaffen können, bot die Neuinszenierung von Beethovens einziger Oper „Fidelio“ im Münchner Nationaltheater. Der junge englische Regisseur Michael Geliot hatte sich ein sehr überzeugendes Konzept ausgedacht: er wollte die Figur des Rocco ganz in den Mittelpunkt stellen, diesen Mann, der von Natur aus herzensgut ist, der aber seine Befehle bekommt und gewöhnt ist, diese auszuführen. Rocco lebt sein Familienleben in der Abgrenzung durch riesige Gefängnismau-ern, er möchte Gutes tun, er versucht, den Gefangenen möglichst lange die Möglichkeit zu verschaffen, sich im Tageslicht aufzuhalten, aber über seinen Schatten kann er nicht springen, das große Wagnis des Durchbruchs zur Freiheit ist nur dem Außergewöhnlichen, nämlich Leono-re, vorbehalten. „Wir sind alle Roccos“, sagte Geliot in einem Interview, „wir wünschen uns ein möglichst angenehmes Leben und sehen nicht die drohenden Gefängnismauern, die uns umgeben“.
Die Realisation sah jedoch weniger überzeugend aus: Michael Geliot brachte für die Ausstattung Ralph Koltai nach München mit und dieser Bühnenbildner baute unlogisch und, was noch weit schwerer wiegt, akustisch untragbare Räume. Die Inkonsequenz beginnt bereits bei der Frage: was soll hinter den monumentalen, kahlen Gefängrtismauern sein? Die Gefangenen kommen von unten, von Florestan weiß man ohnehin, daß er im Keller festgehalten wird — was ist dann in dem Monumentalbau? Die Gefängnisverwal-tung? Oder ein Hallenschwimmbad für Häftlinge? (so human war man damals noch nicht). Völlig unlogisch auch daa Schlußbild: ohne Ubergang geht es von Florestams Verlies zum Paradeplatz des Schlosses, ein riesenhafter Klappdeckel senkt sich auf das Gefängnis und versetzt uns in einen anonymen Raum, der keinerlei Bezug zur Handlung hat. Wenn Geliot und Koltai nur einen freien Platz für das Chorfinale schaffen wollten, ist das ein Nonsens in einer Aufführung, die sonst stilistisch ganz auf Realismus abzielt.
Noch schmerzhafter waren aber die musikalischen Auswirkungen der Raumaufteilung. Wolfgang Sawal-lisch legte die musikalische Einstudierung sehr dramatisch an und wollte nicht vertuschen, daß hier ein Symphoniker, ja eben der Symphoniker in die Welt der Oper eingebrochen war, um sein humanistisches Freiheitsideal zu artikulieren. Sawallisch ließ also das Bayerische Staatsorchester ganz symphonisch musizieren und schon der erste, strahlende E-Dur-Akkord der Ouvertüre hatte Größe und Entschlossenheit. Doch im 1. Akt machten sich die akustischen Probleme so stark bemerkbar, daß Sawallisch nur noch auf Sicherheit achten mußte und nicht mehr genügend Freiheit zur Gestaltung fand, wie sie ihm vielleicht vorschwebte. (Wie ernst es Sawallisch um das dramatische Element war zeigt, daß er auf die Leo-noren-Ouvertüre Nr. ' 3 — die als Bravourstück für den Dirigenten sehr beliebt ist — verzichtete).
Schade auch um die hervorragende Besetzung, die durch die akustischen Mängel verunsichert wurde. Hier zeigten sich auch gute Ansätze an Geliots Personenregie, vor allem gelang es ihm, aus Franz Crass einen ergreifenden, vermnerlicbten Rocco zu machen, und auch Ingrid Bjoner war eine auffallend sicher und schön geführte Leonore. Zum darstellerischen Höhepunkt der Aufführung wurde der Auftritt von Dietrich Fischer-Dieskau als Minister. Aber auch die blutjunge Ungarin Adrienne Csengery als Marzelldne, James King als Florestan und Leif Roar in der Rolle des Pissarro waren von exzellentem stimmlichen Format nicht zu vergessen der schlagkräftige Staatsopernchor und das engagiert spielende Bayerische Staatsor-chester. Viel Beifall und für die Szeniker auch heftige Buhs.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!