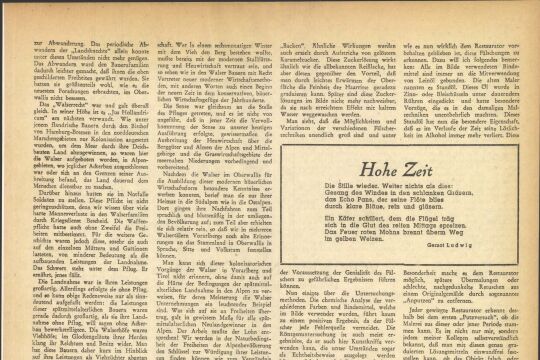Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Vorgang auf!
Wenn ich heute aus meiner langjähriger Bühnenlaufbahn einiges Selbsterlebte berichte, so soll es den Leser davon unterrichten, daß sich droben auf der Bühne manches ganz anders abspielt, als der Theaterbesucher die Welt des Scheins vom Zuschauerraum aus erlebt. Was sich oben aul den „weltbedeutenden Brettern“ (für den Sänger und Schauspieler oft unvorhergesehen ereignet, bleibt dem Publikum häufig verborgen und wird — glücklicherweise — von ihm oft gar nicht oder nur wenig bemerkt. Und daß dies gut ist, weil es die Illusion des der Bühnensuggestion willfährigen Zuschauers nicht stört, sollen die folgenden heiteren Kleinigkeiten dartun.
Der „paprizierte“ Tenor
Ich erinnere mich da eines Kollegen, eines Tenorbuffos von sehr kleiner, gedrungener Gestalt, dessen große, allerdings nicht besonders schöne Stimme ihn immer auf den für ihn schmerzlichen Gedanken brachte, wie wunderbar es wäre, Heldenpartien singen zu dürfen. Da dies im Theater natürlich allgemein bekannt war, so wurde er oft von den „lieben“ Kollegen als willkommenes Objekt ihres Spaßes benutzt, ohne daß er selbst sich dessen bewußt wurde. Besonders bös wurde ihm da in einer heute schon längst vergessenen volkstümlichen Oper mitgespielt. In einer darin vorkommenden Szene in einem Wirtshausgarten wurden Bier, Wein und Würstel aufgetragen, an denen sich einige fröhliche Zechkumpane gütlich taten. Unter diesen Wirtshausgästen befand sich auch besagter Tenorbuffo, der sich mit besonderem Eifer im Verzehren der Würstel hervortat, was natürlich seinen Mitspielern sofort eine erwünschte Gelegenheit bot, den verkannten „Heldentenor" hineinzulegen. Es wurden also für die zum bösen Streich ausersehene Vorstellung bei dem Wurstlieferanten unter anderem ein Paar „Frankfurter“ bestellt, die sich durch auffallende Größe auszeichneten, dafür aber den Nachteil hatten, daß sie mit einer übermäßigen Dosis Paprika gefüllt waren. Wie erwartet, stürzte sich unser eßfreudiger Tenor sofort auf dieses verlockend große „Frankfurterpaar“ - und biß herzhaft hinein. Die Wirkung war für die Arrangeure dieses Schabernacks zwerchfellerschütternd: Der arme Würstelesser wußte nicht, ob er sich mehr aufs Schimpfen oder aufs Ausspucken verlegen sollte, da sich ja beides zugleich nicht gut machen ließ. Den Höhepunkt aber erreichte die Lachlust der bösen Kollegen, als das arme Opfer, laut Vorschrift seiner Rolle, gleich nach dem Verzehren der Würstel ein fröhliches Trinklied in hoher Tenorlage zu singen hatte: Die Töne, die der „paprizierte“ Sänger da produzierte, wirkten derart greulich, daß trotz der allgemeinen Heiterkeit, die dieses Intermezzo auslöste, mancher Mitverschworene doch eine kleine Reue verspürte über den vielleicht zuweit getriebenen Spaß. Tagelang nachher hat der kleine Tenor keinen seiner falschen Freunde angesehen.
„Der Prophet“ und die zwölf Eier
An einer Opernbühne wirkte gleichzeitig mit mir ein Bassist, ein sympathischer, lieber Mensch, der durch zwei Eigenschaften auffiel: durch ein überaus mächtiges, dunkles, allerdings etwas robust gebrauchtes Organ und durch einen völlig kahlen Schädel, der in seiner wunderbaren Rundung einer glänzenden, überdimensionierten Billardkugel glich. Von diesem Kollegen ging die Mär, daß er seinen Schädel täglich rasierte (es konnte bei der Spiegelglatte auch nicht anders sein) und daß er vor jeder Vorstellung, in der er zu singen hatte, zwölf — sage und schreibe zwölf — harte Eier äße, um seinen mächtigen Korpus und seiner Stimme die nötige Kraft zu geben. Auf diese Gewalt seines Organs legte Kollege X. das größte Gewicht und auf diesen Umstand wurde nun von einigen Eingeweihten ein nichtswürdiger Plan aufgebaut; es sollte ihm an einem Abend eingeredet werden, daß er anscheinend schwer indisponiert sei, da seine Stimme diesmal auffallend klein und schwach klänge. Für diese Verschwörung wurde die Meyerbeer- sehe Oper „Der Prophet“ ausersehen, in dei unser Bassist einen der Wiedertäufer zt singen hatte. Schon nach den ersten, wi immer recht mächtigen Tönen des Kol legen X. nahte sich ihm einer unserer Mitverschworenen und fragte ihn teilnahmsvoll was denn mit ihm los wäre, daß man ihr heute so wenig hörte; ein anderer macht: ihn mit Bedauern auf seine sicherlicl schwere „Indisposition“ aufmerksam, eir dritter fragte ihn gar, ob er überhaupt sein: Partie würde zu Ende singen können. Die Wirkung war ganz wie erwartet: Der verzweifelte Bassist glaubte allmählich tatsächlich an seine in Wirklichkeit gar nicht bestehende Indisposition, und dies um sc mehr, als er gerade an diesem Tag nicht seine gewohnten zwölf, sondern eine kleinere Anzahl Eier gegessen hatte. In seiner Verzweiflung forcierte er sein ohnehin so pompöse: Organ so sehr, daß das Haus dröhnte und et dem Tenor, der den „Propheten“ sang und in unsere Verschwörung nicht eingeweiht war, derart in die Ohren brüllte, daß dieser ihn fragte, ob er denn wahnsinnig geworden sei. Langsam dämmerte dem armen Opfer doch auf, daß er den „lieben“ Kollegen aul den Leim gegangen war, und er sang seine Rolle in einer normalen Stimmstärke zu Ende; seine Zwölfeiermahlzeit hat er aber nach diesem Vorfall, wie er mir später einmal anvertraute, trotzdem nie mehr verabsäumt.
Das schwache Bett
Kollegen, die gerne mit ihren Mitspielern ihre Späße treiben, selbst aber keinen Scherz verstehen, lernte ich des öfteren kennen. Einen solchen Fall stellte ein ehemals sehr bekannter Bassist dar, der mir einmal in der lustigen Balgerei im letzten Akt der „Boheme“, in der ich den Marcel sang, fast die Perücke vom Kopf riß und sie mir dann in scheinheiliger Hilfsbereitschaft so verkehrt „zurecht“ richtete, daß mich nur mein Mißtrauen gegen diese „Freundlichkeit“ noch rechtzeitig warnte. Nie vergessen werde ich ein Erlebnis in der gleichen Puccini-Oper, das viel Aufsehen erregte und auch in den Zeitungen! besprochen wurde. Infolge der plötzlichen Erkrankung einer Hauptdarstellerin mußte in später Nachmittagsstunde an Stelle der ursprünglich angesetzten Oper die „Boheme“ für abends eingeschoben werden. Sei es nun, daß infolge der kurzen Vorbereitungszeit etwas überhastet vom technischen Bühnenpersonal gearbeitet worden war oder sonst ein unglücklicher Zufall mit im Spiel war, kurz, in der letzten rührenden Szene, in der die arme Mimi ihren Freund Rudolf aufsucht, um bei ihm zu sterben, ereignete sich etwas, was gerade das Gegenteil von der Tragik dieser Szene hervorrief. Als die Sängerin der Mimi, eine zarte, kleine Person, in ihrer letzten schwachen Hilflosigkeit sich auf das armselige Bett in Rudolfs Zimmer hinsinken ließ, fiel dieses mit lautem Krachen unter ihr zusammen, und die sterbende Mimi lag auf dem Boden. Ich werde nie vergessen, wie der Sänger des Collin, ein immens langer Bassist, und der Darsteller des Schaunard einen Lachanfall bekamen, der nur noch von dem Gelächter im Zuschauerraum übertroffen wurde. Glücklicherweise bewahrten sein Tenorkollege, der den Rudolf sang, und ich die Fassung und wir betteten die ganz verstörte kleine Mimi auf das Sofa in einer Ecke, damit sie dort in Ruhe sterben konnte. Die Stimmung war natürlich endgültig vorbei, und wir alle konnten kaum erwarten, daß der Vorhang fiel. Das Donnerwetter, das nachher vom Regisseur der Vorstellung auf den armen Bühneninspektor und den Requisiteur niederging, war noch gewaltiger als das Getöse, das das tusammenstürzende Bett verursacht hatte.
Leo Slezak — gut und schlecht gelaunt
Wer Leo Slezaks „Gesammelte Werke" gelesen hat, weiß, welch großes komisches Talent in dem gefeierten Tenor steckte. In einer „Fledermaus“-Aufführung, in der ich den Dr. Falke sang, gab Slezak den Alfred; Selma Kurz, die einstige große Koloraturprimadonna der Wiener Staatsoper, war die
Rosalinde der Vorstellung. Schon das Erscheinen Slezaks im letzten Akt, als er seinen mächtigen Körper in einen Rieserischlafrock gehüllt (fast möchte man sagen „gefüllt“) hatte, und er an einem Strick von der Dicke eines Schiffstaues vom Gerichtsdiener Frosch auf die Bühne gezogen wurde, erregte einen Sturm von Heiterkeit. Den Höhepunkt erreichte diese aber, als der „göttliche Leo“ seiner Partnerin, der Kurz, jedesmal wenn sie sich zu singen anschickte, mit zwei als Schere gebrauchten Fingern den Ton vor dem Mund „abschnitt“ und sie auf keinen Fall singen ließ, bis man merkte, daß die Diva schon allen Ernstes bös war. An diesem Tag schien Slezak überhaupt in einer besonders komischen Geberlaune zu sein, da er unter unbändigem Gelächter des Publikums, rittlings auf einem Stuhl sitzend, anfing, Witze in seiner leicht „bömakelnden“ Art zu erzählen, wie es ihm so leicht keiner nachmachte. Wenn ihm allerdings selbst ein Mißgeschick auf der Bühne passierte, hatte die Sache ein anderes Gesicht. Das erfuhr ich, als ich mit Slezak zusammen auf einer Provinzbühne im „Bajazzo“ gastierte. Entgegen aller sonstigen Gepflogenheit wurde diese Oper damals nicht mit ihrer „Milchschwester“, der „Cavalleria“, zusammen ge- gegeben, sondern Slezak sang vor dem „Bajazzo“ einen kleinen Liederabend auf der Bühne. Wir standen alle schon geschminkt hinter den Kulissen, um dem großen Kollegen zuzuhören. Als sich Slezak nach Beendigung des Konzertes verbeugte und dabei dem Souffleurkasten etwas zu nahe trat, glitt er plötzlich aus und rutschte mit all seiner mächtigen Leibesfülle in den Kasten hinein, bis sein Bauchumfang ihn vor einem weiteren Versinken bewahrte. Der darauffolgende Wutausbruch Slezaks war nur mit seinem Rasen als „Othello“ vergleichbar, wenn sich der zürnende Riese auch bald beruhigte und dann einen ausgezeichneten „Canio“ sang.
Eine „kitzliche“ Sache
Zum Schluß noch ein heiteres Erlebnis, an das ich mich trotzdem nicht mehr gerne erinnere, weil die Gelegenheit im wahrsten Sinne des Wortes „kitzlich“ war. In einer „Tiefland“-Aufführung, in der ich den Sebastiano gab, hatte mich laut Anweisung des Regisseurs der wackere Pedro auf einen Tisch hinzuwerfen und dort zu erwürgen; in meinen letzten „Todeszuckungen“ fiel ich dann vom Tisch auf den Boden, um hier bis zum Fallen des Vorhanges tot liegenzubleiben. Nun stand auf dem ominösen Tisch eine mit Milch gefüllte Schale, und bei meinem Ringen mit Pedro wurde diese Milch verschüttet. Kaum lag ich als „Toter" auf dem Boden, als ich ein leichtes „Klatschklatsch" auf meiner nackten Brust verspürte, und langsam kam die ganze Milch tropfenweise auf mich herab. Da man sich als Toter bekanntlich nicht rühren kann und es auf der Bühne noch weniger darf, mußte ich dieses scheußlich kitzelnde Gefühl bis zum Aktschluß aushalten, bis mich der fallende Vorhang, der mir diesmal nicht schnell genug herunterkam, von den Toten auferstehen ließ und von den marternden Milchtropfen erlöste.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!