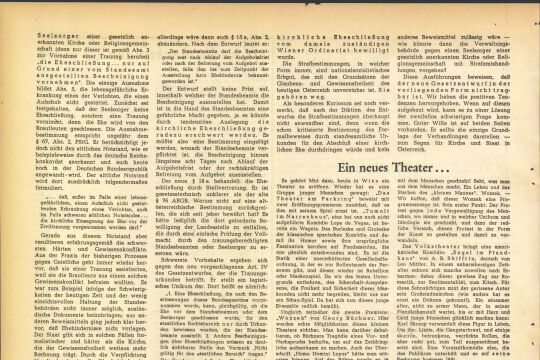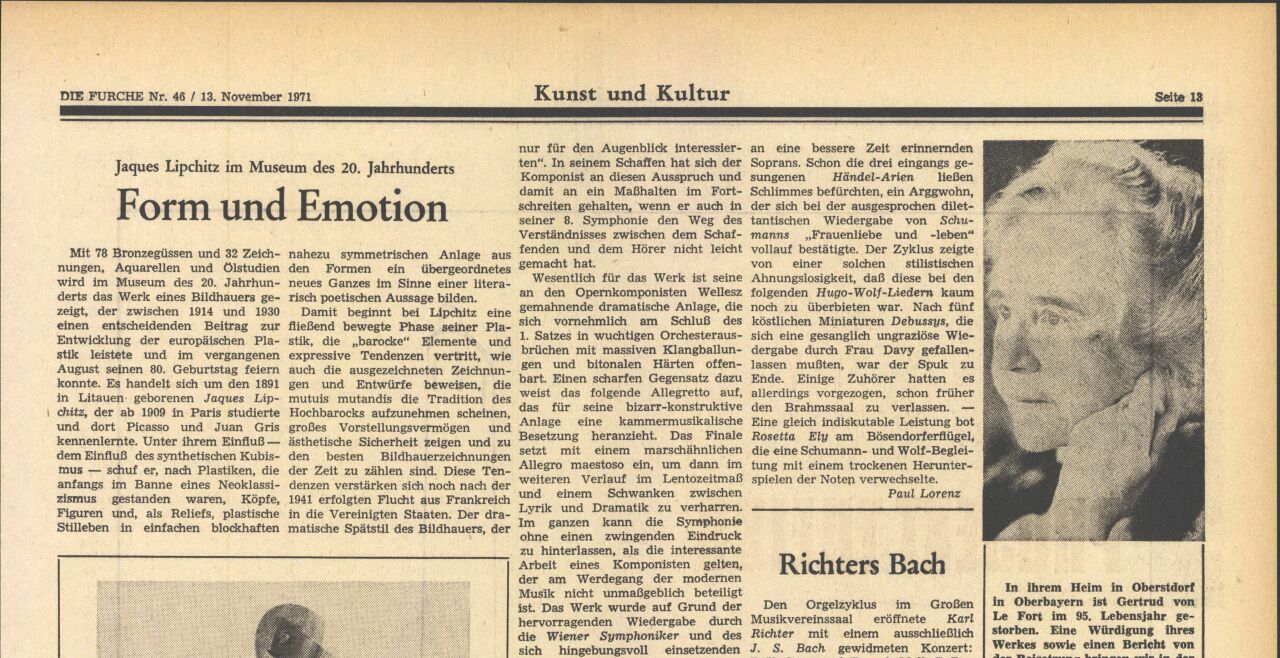
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Aus den Konzertsälen
Egon Wellesz hat sich als Musikwissenschaftler, Kritiker, Lehrer und vor allem als Opern- und Ballettkomponist sowie als Symphoniker einen geachteten Namen geschaffen. Es bedeutet für den jetzt Sechsundachtzigjährigen eine ihn gewiß erfreuende Ehrung, daß die Urauffüh rung seiner 8. Symphonie in seiner Heimatstadt Wien im großen „ORF“- Sendesaal stattfand. Wellesz, ein Schüler Schönbergs, hat vor Jahren als Gastvortragender in der österreichischen Gesellschaft für Musik gesagt, daß „viel Avantgardismus Manierismus sei und Experimente nur für den Augenblick interessierten“. In seinem Schaffen hat sich der Komponist an diesen Ausspruch und damit an ein Maßhalten im Fortschreiten gehalten, wenn er auch in seiner 8. Symphonie den Weg des Verständnisses zwischen dem Schaffenden und dem Hörer nicht leicht gemacht hat.
Wesentlich für das Werk ist seine an den Opernkomponisten Wellesz gemahnende dramatische Anlage, die sich vornehmlich am Schluß des 1. Satzes in wuchtigen Orchesterausbrüchen mit massiven Klangballungen und bitonalen Härten offenbart. Einen scharfen Gegensatz dazu weist das folgende Allegretto auf, das für seine bizarr-konstruktive Anlage eine kammermusikalische Besetzung heranzieht. Das Finale setzt mit einem marschähnlichen Allegro maestoso ein, um dann im weiteren Verlauf im Lentozeitmaß und einem Schwanken zwischen Lyrik und Dramatik zu verharren. Im ganzen kann die Symphonie ohne einen zwingenden Eindruck zu hinterlassen, als die interessante Arbeit eines Komponisten gelten, der am Werdegang der modernen Musik nicht unmaßgeblich beteiligt ist. Das Werk wurde auf Grund der hervorragenden Wiedergabe durch die Wiener Symphoniker und des sich hingebungsvoll einsetzenden Dirigenten Miltiades Caridis freundlich aufgenommen.
Nach der Pause der Martinee kam Gustav Mahler mit einem seiner schönsten und eingebungstiefsten Werke, mit dem „Lied von der Erde“ zur Aufführung. Der Altpartie lieh Herta Topper die reife Kunst ihres weichen, verhalten eingesetzten Prachtorgans, als Interpret der Tenorgesänge war Donald Grobe im Ausdruck besser als in der stimmlichen Verfassung.
In der zweiten Matinee des Orchesterzyklus V des ORF kam zuerst Boris Blachers „Concertante Musik für Orchester“, op. 10, zur Aufführung. Das Werk verdankt die Klarheit und geschickte Verarbeitung des ihm zugrunde liegenden Materials vielleicht auch der mit dem Musikstudium gleichzeitig gehenden seinerzeitigen Beschäftigung des Komponisten mit Architektur. Es hört sich oft kühl und formstreng mit neoklassizistischem Einschlag und polyrhythmischen Eigenheiten an, zeigt aber auch eine sonst bei dem bekannten Lehrer und Theoretiker Blacher nicht immer vorhandene Musizierfreude und einfallsreiche melodische Substanz, welche dieses Opus einer frühen Kompositionsperiode gut zur Geltung kommen läßt. — Als österreichische Erstaufführung und Hauptereignis der Matinee hörte man dann Enrico Mainardis „Concerto per due Violoncelli e orchestra“. In konzertmäßiger Form macht es Anleihen bei italienischer Volksmusik, die bei farbiger Instrumentierung — ohne Verwendung von Blechbläsern — in weit ausgesponnener Verarbeitung aufscheint. Dem Allegro sostenuto e vivace des ersten Satzes folgt als schönster Teil der Komposition ein Lento als kantables, elegisches Duett der beiden Solisten, begleitet von gedämpften Streichern. Hier und im melosreichen Finale kam das Spiel der zwei Meistercellisten, Enrico Mainardis und Ludwig Hoelschers, zu prachtvoller Entfaltung. — Als Schlußnummer folgte die 5. Symphonie von Jean Sibelius. Dem greisen, aber noch immer erstaunlich vitalen Dirigenten Robert Heger gebührt zusammen mit den Wiener Symphonikern der Dank des Publikums für die vorzügliche Ausführung der drei Werke.
Ein solch unglaubliches Debakel, wie es der Liederabend der bekannten, an ersten Opernhäusern der Welt engagierten Sopranistin Gloria Davy mit sich brachte, hat man schon lange nicht mehr erlebt. Die Sängerin befindet sich in einer derart schlechten stimmlichen Verfas- sund, daß man eigentlich ihren Mut bewundern muß, vor ein — auch nur bescheidene Ansprüche stellendes — Publikum zu treten. Sie produziert grelle, scharfe Töne, die in der hohen Lage immer mehr zu flackern beginnen und sehr häufig zu tief geraten, dazu kommt eine flache, farblose Mittellage eines großen, aber kaum an eine bessere Zeit erinnernden Soprans. Schon die drei eingangs gesungenen Händel-Arien ließen Schlimmes befürchten, ein Arggwohn, der sich bei der ausgesprochen dilettantischen Wiedergabe von Schumanns „Frauenliebe und -leben“ vollauf bestätigte. Der Zyklus zeigte von einer solchen stilistischen Ahnungslosigkeit, daß diese bei den folgenden Hugo-Wolf-Liedem kaum noch zu überbieten war. Nach fünf köstlichen Miniaturen Debussys, die sich eine gesanglich ungraziöse Wiedergabe durch Frau Davy gefallenlassen mußten, war der Spuk zu Ende. Einige Zuhörer hatten es allerdings vorgezogen, schon früher den Brahmssaal zu verlassen. — Eine gleich indiskutable Leistung bot Rosetta Ely am Bösendorferflügel, die eine Schumann- und Wolf-Begleitung mit einem trockenen Herunterspielen der Noten verwechselte.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!