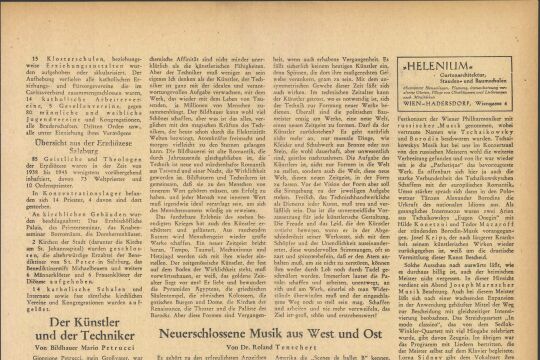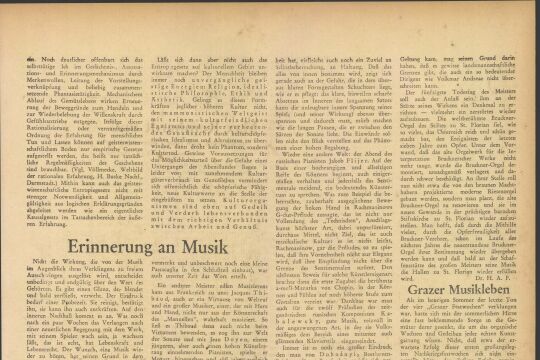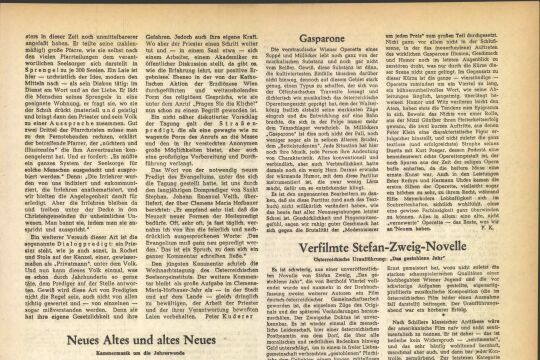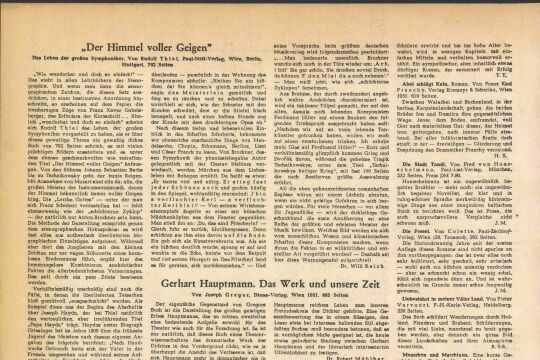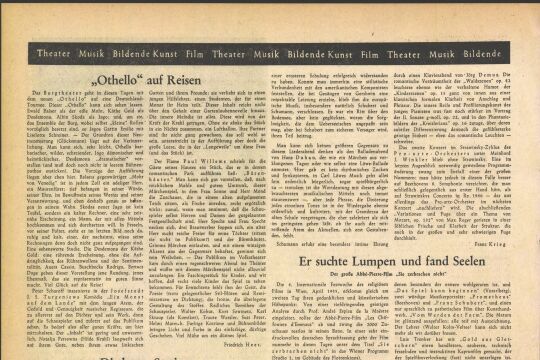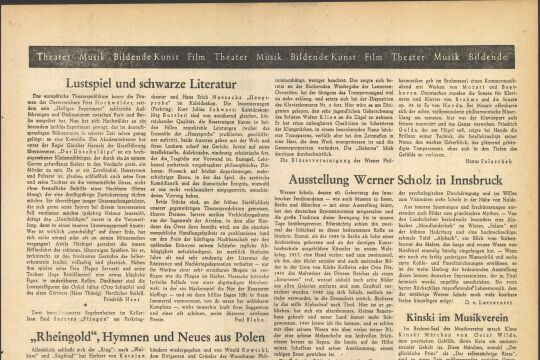Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Musik der inneren Welt
Was der Kammermusik ihren edelsten Wert gibt, ist nicht nur, daß sich auf ihrem Feld der Meister in der Beschränkung der Mittel zeigt. Kammermusik, zu der in weiterem Sinn auch das Lied und manches Klavierwerk gehört, führt uns vor allem den Weg nach innen, in den reinsten Bezirk der Seele.
Wie groß die Vielfältigkeit des Erlebens und der Darstellung sein kann, auch wo nur ein paar Streichinstrumente aufgeboten sind, das wird offenbar, wenn man im Laufe der Wochen verschiedene Quartettvereinigungen spielen hört. Sehr lehrreich, wie Mozart im Vortrag des C a 1 v e t-Quartetts nach der Richtung des Esprits, des französischen Temperaments gedeutet wird: das kMngt uns neu ungewohnt und widerspricht doch dem Geist Mozarts nicht, der allen Völkern das Seine sagt und sie dabei das Ihre aussprechen läßt. Merkwürdig auch, wie das V e g h-Q a r t e 11 mit seinem magyarischen Blut Werke der Wiener Klassik bringt. Hier mag sich die Volksart der Spieler zunächst zügeln müssen, doch dringt sie wieder durch, was eine Lebendigkeit eigenen Tons, gerade bei Haydn etwa, wo die landschaftliche Nähe fühlbar wird, zum Ergebnis hat. Die Vergeistigung des letzten Beethoven war nicht voll erreicht, aber das Ungestüm, die Kraft der Leidenschaft, dem Werk und den Spielern gemeinsam, Kunsternst und Können rücken zusammen das Ziel nahe.
Wie weit die rein geistige Komponente Beethovens, die sich etwa in der „großen Fuge“ am strengsten ausspricht, obwohl auch da alles auf dem Grund einer gewaltigen Leidenschaft gewachsen ist, zu voller Geltung gebracht werden kann, wird immer bis zu einem gewissen Grade dem Geiühls-urteil des einzelnen Hörers überlassen bleiben. Das Philharmpnia-Quar-tett ,hat den rühmlichen Versuch unternommen, das op. 130 mit der ursprünglich ihm als Finale zugedachten Fuge zu beschließen, und das war nicht nur interessant, sondern auch erhebend anzuhören. Ob aber Beethoven dem Wunsch nach einem leichteren, lockereren Schlußsatz nachgekommen wäre, wenn er nicht selbst gemeint hätte, die Fuge mute als Ausklang einer so konzentrierten Komposition den Hörern, wenigstens den Zeitgenossen, zuviel zu? Sehr schön stand, als Gegensatz und Vorklang, Haydns f-moll-Quartett mit der großartigen Schlußfuge am Beginn des Abends.
Ein Werk aus naher Vergangenheit, Respighis Dorisches Quartett, Zeugnis edlen Suchertums und einer hohe Achtung heischenden Persönlichkeit, ist vom B a-rylli-Quartett in Erinnerung gebracht worden, sehr sorgsam eingeübt und ganz in dem vornehmen, billige Wirkung verschmähenden Geist des Autors gespielt.
Daß der höchste Glanz der Mittel immer nur die Voraussetzung für den vollkommenen Dienst am Werk sein darf, in solcher Unterordnung aber den Weg zur höchsten Leistung erst freimacht, zeigte aufs erfreulichste der Abend des Amsterdamers George van Renesse. Fast scheut man sich, ihn einen „Pianisten“ zu nennen. Gewiß, seine Fertigkeit ist groß und untadelig. Wer hätte, nach dem herbgewaltigen Vortrag der f-moll-Sonate von Brahms, erwartet, die Debussy-Arabeske so flockenleicht, in einem so linden Legato förmlich über die Tasten ' gehaucht zu hören? Doch steigerte sich der Abend, der mit Haydn durch Werkwahl und Wiedergabe verheißend begonnen hatte, noch mit C£sar Franck. — Die Größe dieses Musikers wird uns erst allmählich klarer bewußt, und Renesse hat dazu Bedeutendes beigetragen. — Wunderschön schloß sich als Zugabe ein Bachisches Choralvorspiel in zartester „Registrierung“ an. Das Musikalische leuchtete in reinem Glanz — es ist ein Abend echter Kammermusik gewesen.
Solcher Kunstauffassung dient auch Fritz E g g e r, ein starker Könner, der doch nicht blenden will und gerade auch mit der gleichen Brahms-Sonate überzeugt hat: die stürmende Kraft und die fast scheue Verhaltenheit des Gefühls wurden mit gleicher Unmittelbarkeit Ereignis.
Weniger im Licht allgemeinen Urteils lebt die Könnerschaft des Sängers. Aber sie ist vielleicht noch der heiklere Fall, die schwierigere Aufgabe, sie hat mit dem lebenden Instrument zu schalten, das nicht nur empfindlidier ist, sondern auch überhaupt schwerer zur Meisterschaft gebracht werden kann. — Am Beispiel eine.- Elisabeth Schumann wird offenbar, was Singmeisterschaft ist. De Jahre, in denen wir sie entbehren mußten, haben ihr nichts anhaben können. Mit gleicher Leichtigkeit gehorcht die Stimme dem Ausdruckswillen, und so ist sie auch heute fähig, alle Feinheit zu geben, die der von der Sängerin bevorzugte und ihr besonders angemessene Bereich des Lieblichen, Heiteren braucht. So gab es wie eh und je einen reinen Stimm- und Seelenklang, wie er in unserer Erinnerung, wie zum Kristal! geformt, als der Silbenglcrckenklang jenes G aus Pami-nas Arie, jener „Ruh“', unverhallt lebte.
Dann kam Julius Patzak und sang von der „schönen Müllerin“. Sein Schubert-Vortrag, gleicherweise aus einer großen Musikalität wie aus einer unmittelbaren Natürlichkeit schöpfend, gab dem Meister und dem Lied sein volles Recht. Ein starker Höhepunkt war die „liebe Farbe“. Ludwig Weber hatte die „Dichterliebe“ und die „Vier ernsten Gesänge“ gewählt — fast ein Zuviel an Ernst und Dunkel. Niemals zuviel wird uns freilich ein Ernst, der vom Opernhaften weg zum Lied und zur Innerlichkeit strebt. Weber weiß auch seine Prachtstimme zu Sanftheit und Ruhe zu schmeidigen — so gelang ihm eine schöne Wirkung, die ihn ermuntern sollte, vom Lied nicht zu lassen. Opernsänger, Bühnentemperament, Besitzer- einer wunderbaren und wunderbar gesunden, spielend gehorchenden Stimme: das ist Hans FI otter. Auch ihn zieht's zum Liedgesang und zu den höchsten Aufgaben: er hatte sich die „Winterreise“ vorgenommen. Wie Weber scheint auch Hotter als Liedersänger alles meiden zu wollen, was man ihm als opernmäßig ankreiden könnte: er stellt das Ganze auf Verhaltenheit, läßt die Stimme niemals in ihrer Löwenkraft losbrechen, bescheidet sich auch nicht mit dem großstiligen Opern-Alfresko des Vortrags. Da liegt nun, gar bei der „Winterreise“, die Gefahr, der zu einheitlichen Stimmung, eines „gedeckten“, die Melancholie zum unerbittlichen Gesetz der Wiedergabe bestellenden Vortrags — zugleich tritt die mitunter scharf belichtete Einzelheit mit ungewohnter Schärfe vor. Demgegenüber sorgt die Stimme für zarte Eindringlichkeit, die Musikalität für sicher-' ste Führung — und der Weg zum ganzen Gelingen liegt in der Vereinigung der — noch gesteigerten — Abschattung des einzelnen mit der unter dem Eis und Nebel der Schwermut doch glosenden Leidenschaft, die ihr Wort stärker sprechen darf, ohne das Lied zu gefährden.
Mit interessanter Abwechslung fesselte Elena Nikolaidi ihre Hörer. In der Mitte ihres Programms standen Volkslieder ihrer griechischen Heimat (von R. Kubinzky in ein apartes Klanggewand von Flöte, Harfe und Cembalo gehüllt), Gebilde eigentümlichen Reizes; Italiener, Franzosen, Brahms und Marx umgaben sie. Die ungewöhnliche Stimme, von der seltenen Qualität des echten, schweren Alts, doch nun viel lockerer geführt, und das Vortragstemperament erzeugten viel Widerhall. Ereignis ganz anderer Art, obwohl es uns auch den erwünschten Atem der weiten Welt schenkte: die Chansonkunst der jungen Amsterdamerin Francoise Flore. Ein geschichtlicher Überblick über eine von Frankreichs eigensten und zugleich weltgewinnenden Gaben, aber gar nicht akademisch, sondern voll Frische, voll Vielfältigkeit und Verwandlungsgabe gebracht, eine Kleinkunst, die mit Ernst und Heiterkeit auch ans Herz rührt, in ihrem „intimen“ Charakter ins Innerliche reicht, zugleich ein winziges Bühnenspiel, dessen Gebärden und Mienen durch die hübschen, nach Zeiten wechselnden Kleider an Anschaulichkeit und Wirkung gewann.
Kammermusik der Bühne im feinsten und goldhaltigsten Sinn brachte uns die „Oper der Junge n“, von Karl Winkler musikalisch, von Josef Witt szenisch betreut, mit P e r g o 1 e s e s „S e r v a p a-d r o n a“. In einem Vorstadtsaal, nach Mozarts Schäferspiel von „Bastien und Bastienne“, rollte die entzückende Komödie ab, mit aller Frische der Jugend, die spielte und sang, und der Jugend, die dem alten Werk ungemindert innewohnt. Nur drei Personen, von denen eine stumm ist — und welches Leben, welche Abwechslung, welche Heiterkeit, welcher Mozart-Vorklang! Junge Sänger, Schüler der Akademie, haben hier Gelegenheit, zu lernen und vielen Freude zu machen; man muß dem frisch gewagten und fröhlich gewinnenden Unternehmen Glück wünschen auch um der weiten Volkskreise willen, die dadurch Freude haben und mit Kunst vertraut werden können. Freude, die von Kunst ausgeht, erwärmt die Herzen für lange Zeit, und die heitere Kunst, die so wenig Mittel fordert, daß sie überall in kleinen Sälen sidi zeigen “'kann, und die so viel gibt, ist nicht minder wertvoll als die ernste — und sie ist noch seltener.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!