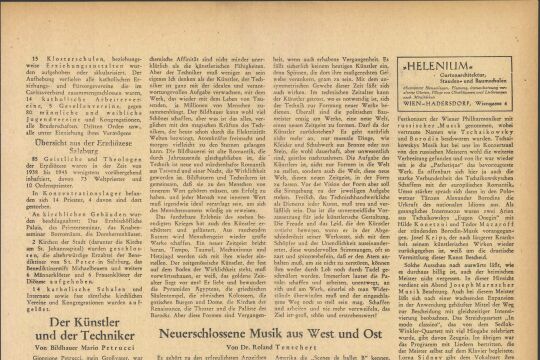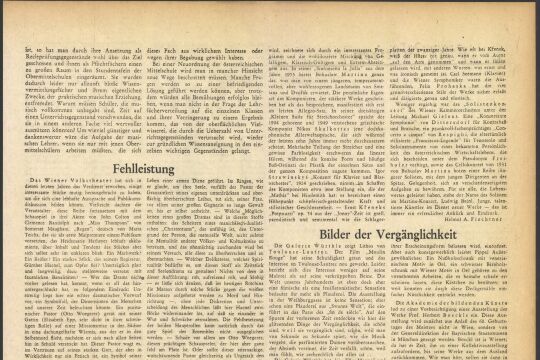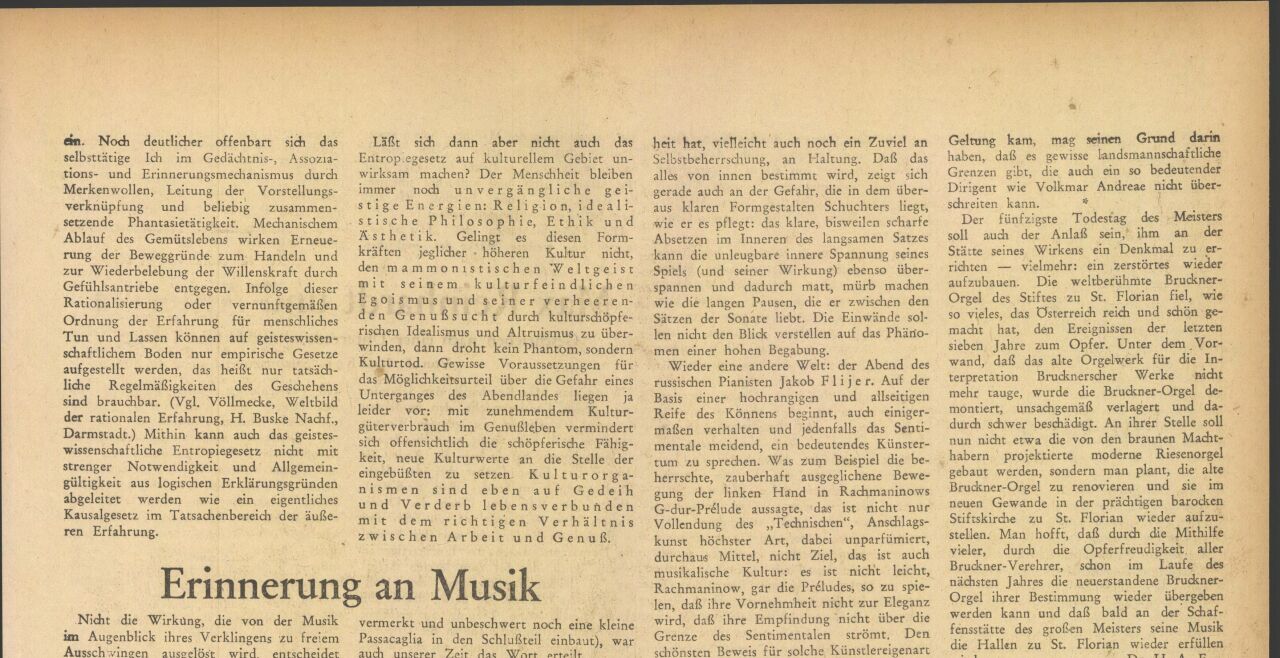
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Erinnerung an Musik
Nicht die Wirkung, die von der Musik im Augenblick ihres Verklingens zu freiem Ausschwingen ausgelöst wird, entscheidet unbedingt und endgültig über den Wert des Gehörten. Es gibt einen Glanz, der blendet und bald zerfließt, verweht. Der Eindruck bedarf einer Probezeit. Sie reinigt, bestätigt ihn, sie kann ihn auch entkräften. Auf den inneren Nachhall kommt es an. Was noch nach ein paar Wochen das Verlangen nach einer neuerlichen Begegnung mit dem Werk, mit seinem Spieler wach sein, ja wachsen läßt, das ist echt, hat Lebenskraft und Lebensrecht. Der Wunsch, eine Musik wieder zu hören, hat seinen Grund in dem Gefühl, -das Werk habe dem Hörer mehr zu sagen, zu geben, als er da erstemal erfassen, empfangen konnte, mehr und immer wieder Neues in aller Wiederholung: solche Unerschöpflichkeit, solche dauernde Verwandlung ist das Zeichen der Meisterwerke, sie bezeichnet auch den großen Künstler der Wiedergabe.
Einmal ist es das Werk in seiner eigenen Größe, dais den Spieler mitnimmt auf seine Höhe, dann wieder gibt der geniale Spieler dem schwächeren Werk von seiner Kraft, wie ein bedeutender Schauspieler ein mittelmäßiges Theaterstück tragen, zu höherer Wirkung bringen kann. Den reinsten, den vollsten Klang ergibt natürlich das Zusammentreffen hoher • Kunst im Werk und im Darsteller unter der — nicht immer gegebenen — Voraussetzung, daß die Individualität des Darstellers dem Werk ganz zu dienen fähig und gewillt ist. All dies reinigt sich und befestigt sich im Nachhall, in dem, was das innere Ohr bewahrt, was vom Herzen immer wieder ersehnt wird: im wahren Musikerlebnis.
So klingt in uns. der Ton einer Oboe nach, das Spiel eines wahren Meisters, des englischen Künstlers Leon Goossens. So vollkommen er sein Instrument beherrscht als Virtuose, mit einem schlanken, geschmeidigen, manchmal fast flötenhaft leichten und lockeren Ton, mit einem ruhigen, die Phrase klar mi lellierenden Atem, mit einer untadeligen rertigkeit:- es ist seine Musikerqualität, die, zugleich tragender Grund und schwebende Blüte seines Spielens, eines rechten, uneitlen Musizierens, den Eindruck bestimmt. Goossens ist überall zu Hause: in der vorklassischen Kunst von Bachs venezianischem Zeitgenossen Marcello, dessen Oboenkonzert uns in einem bachschen Klavierkonzert lang unerkannt, für eine vivaldische Unterlage Bachs gehalten, erhalten ist, so gut wie in dem Konzert von Vau-ghan Williams, wo sich die beiden Grundzüge des englischen Komponisten: Impressionismus und Volksweise, zum Tonbild vereinigen wie Schalmeienklang und wandernde Wolken zum Bild der Hirtenlandschaft. Für Oboe ist wenig geschrieben worden: die Möglichkeiten des Instruments sind begrenzt; wie weit sie werden können, weni der rechte Spieler sich findet, erweist Goossens. Wenn er zur Klavierbegleitung musiziert, kommt er aber doch ohne die Bearbeitungen nicht aus, die immer mißlich bleiben, auch wenn sie uns Kostbarkeiten wie eine Sinfonia au Bachs Osteroratorium aus ihrer halben Vergessenheit hervorholen — man hat diesmal freilich fast vergessen können, daß der Oboensatz aus einem größeren Ganzen und aus seiner Streicherumwelt weggehoben war. Mit Hindemiths Sonate, die vor allem der munteren Charakterseite der Oboe eine spielerische Gelegenheit gibt (und mit eben so spielender Leichtigkeit ganz unvermerkt und unbeschwert noch eine kleine Passacaglia in den Schlußteil einbaut), war auch unserer Zeit das Wort erteilt.
Ein anderer Meister edlen Musizierens kam aus Frankreich zu uns: Jacques T h i-b a u d, auch er ein Virtuose von Weltruf und ein großer Musiker, einer, der mit Herz und Hand, nicht nur aus der Könnerschaft des „Manuellen“, wahrhaft musiziert. So ließ es Thibaud denn auch nicht beim Virtuosen bewenden, es zog ihn zur Welt der Sonate und mit Jean Doyen, einem jüngeren, aber auch ,einen hohen Künstlerrang einnehmenden Pianisten, spielte er Mozart, hingegeben und süß, aber zugleich doch voll Energie und ohne Weichlichkeit, und eine Sonate von Gabriel Faure, ein Werk, das eine lange Probezeit bestanden hat — es ist eben siebzig Jahre alt und doch jung in seinem Schwung, in der Fülle seines Einfalls. Daß solche Musik uns in siebzig Jahren nicht vertraut geworden ist, ist doch sonderbar, ist ein Versäumnis. Man empfand das aufs neue, als-Doyen an seinem eigenen Abend, den er mit einem diesmal härter geprägten Mozart eröffnet hatte, einige kleinere Stücke von Faure spielte; sie wiegen leichter als die Violinsonate, sind aber gute, form volle, übrigens von Chopin erstaunlich unberührte Musik. Mit Debussy und Ravel gab Doyen, Pianist geschliffensten Könnens, Zeugnis dafür, daß man das nicht nur auf Klang und Verschweben, sondern auch auf Klarheit und Gestalt hin spielen kann, was im Falle Ravels besonders überzeugte.
Klarheit, Kontur, Haltung bestimmen Gilbert Schuchters Spiel. Wie merkwürdig, daß ein blutjunger Musiker mit Vorliebe die Hammerklaviersonate in sein auch jetzt wieder innerlich sehr anspruchsvolles Programm setzt! Obwohl er, nach außen hin, gar nicht den Stürmer und Dr'in. ger vorstellt und vorstellen will. Obwohl es ihm vorläufig auch noch an der Kraft für den Löwenprankenschlag des ersten Satzes fehlt! Doch der langsame Satz überzeugt. Hier ist etwas wie gläserne Klarheit, es mag sein, daß sie auf manchen kühl wirkt, hier ist eine zweifellose Reife, bei so jungen Jahren, die aber ebenso sicher keine Kühle ist, hier ist ein Ausweichen den äußeren Wirbungen gegenüber, das Keuschheit hat, vielleicht auch noch ein Zuviel an
Selbstbeherrschung, an Haltung. Daß das alles von innen bestimmt wird, zeigt sich gerade auch an der Gefahr, die in dem überaus klaren Formgestalten Schuchters liegt, wie er es pflegt: das klare, bisweilen scharfe Absetzen im Inneren des langsamen Satzes kann die unleugbare innere Spannung seines Spiels (und seiner Wirkung) ebenso überspannen und dadurch matt, mürb machen wie die langen Pausen, die er zwischen den Sätzen der Sonate liebt. Die Einwände sollen nicht den Blick verstellen auf das Phänomen einer hohen Begabung.
Wieder eine andere Welt: der Abend des russischen Pianisten Jakob F 1 i j e r. Auf der Basis einer hochrangigen und allseitigen Reife des Könnens beginnt, auch einigermaßen verhalten und jedenfalls das Sentimentale meidend, ein bedeutendes Künster-tum zu sprechen. Was zum Beispiel die beherrschte, zauberhaft ausgeglichene Bewegung der linken Hand in Rachmaninows G-dur-Prelude aussagte, dais ist nicht nur Vollendung des „Technischen“, Anschlagskunst höchster Art, dabei unparfümiert, durchaus Mittel, nicht Ziel, das ist auch musikalische Kultur: es ist nicht leicht, Rachmaninow, gar die Preludes, so zu spielen, daß ihre Vornehmheit nicht zur Eleganz wird, daß ihre Empfindung nicht über die Grenze des Sentimentalen strömt. Den schönsten Beweis für solche Künstlereigenart brachte dann die erste Zugabe: die berühmte a-mc!l-Mazurka von Chopin, in der Können und Fühlen auf noch höherer Stufe zum Gestalten vereint war. Dankbar war man auch für die zwölf Präludien des zeitgenössischen russischen Komponisten K a-ba 1 e w s k y, gute Musik, reizvoll in der ungezwungenen Art, in der sie Volksmäßiges dem Bereich eines mitunter auch glänzenden Klavierstils eingemeindet.
Immer ist es noch ein großer Eindruck, den man von Dohnanyis Beet'icven-Spiel empfängt. Berufenheit spricht sich aus, wunderbar bewahrte Kunst der Darstellung in der beseelten Tönung des Anschlags, in der Vornehmheit der ganzen Wiedergabe. Aber seine Liebe zu Liszt kennzeichnet ihn nicht minder: das Ritterliche, das Glänzende, der ungarische Nationalton, der bei Dohnanyi ja viel mehr zu Liszts Rhapsodien als zu Bartoks und Kodalys Bauernliedstil hinüberklingt, auch ein gewisser Welt-mannston, etwas Großstädtisches verbindet ihn mitiszt. All das spricht auch aus den neuen kleinen Klavierstücken, mit denen der Komponist Dohnanyi, hoch schätzbarer Meister einer d-moll-Symphonie, einer mit Recht bekannt gewordenen Klavierrhapsodie, an diesem Abend bekanntgemacht hat.
Von persönlichem Klang ist auch der Abend des russischen Tenors K o s 1 o w-s k i, von der Moskauer Oper, gewesen. Eine helle Stimme, wie wir sie von den Tenorsoli der russischen Volksliederchöre kennen, — undKoslowski hat sein Konzert beschlossen, indem er, solcherart, zu dem ausgezeichneten Klanggrund des Mussinschen Rotarmistenensembles aus dem reichen Schatz der Volkslieder seiner Heimat sang; eine echt lyrische Stimme, die das Zarte liebt, die in feiner Pastellmanier die Stimmung des Lieds, der Opernarie malt. Und er ist ein interessanter Künstler auch darin, daß sich sein Schauspielertemperament, Erbe und Gabe seines Volkes, auch auf dem Konzertpodium zur Geltung bringt: als er mit Paul Schöffler und Pantscheff die Duellszene aus dem „Eugen Onegin“ sang, begann er zu spielen und man glaubte die Szene vor sich zu sehen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!