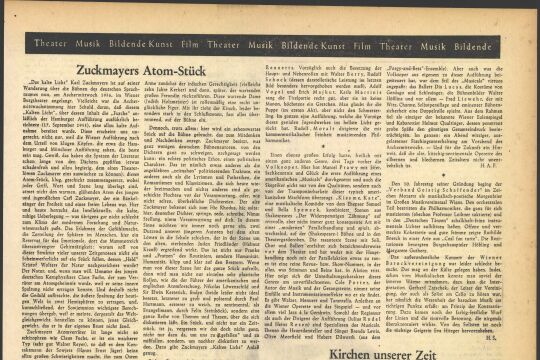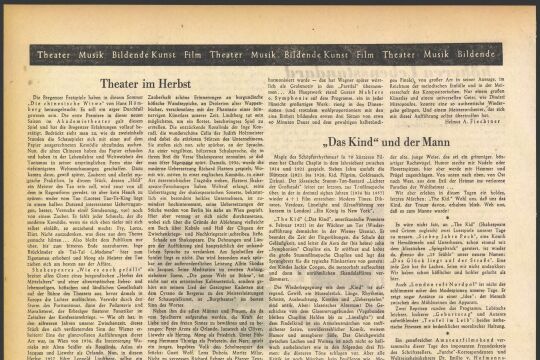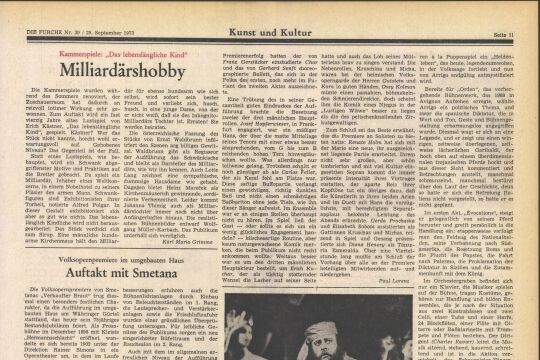Umjubelte Uraufführung der Oper "Der Riese vom Steinfeld" von Friedrich Cerha und Peter Turrini an der Wiener Staatsoper.
Der eine lehnte die Oper als Kunstgattung ab, der andere wollte sich nicht noch einmal der anstrengenden Arbeit der Komposition eines großen Bühnenwerkes widmen; mit der ihm eigenen Beharrlichkeit hat aber Staatsoperndirektor Ioan Holender sowohl den Schriftsteller Peter Turrini dazu gebracht, ein Libretto zu schreiben, wie auch den Komponisten Friedrich Cerha, noch eine weitere Oper zu komponieren. Als Liebe auf den ersten Blick beschreibt Ioan Holender in seinem Vorwort zu den im Wiener Sessler Verlag erschienenen Arbeitsgesprächen den Moment, als Cerha "mit Turrini zusammenkam und auch sein Werk kennen lernte [...]. Und das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen zwei äußerlich und in ihren Lebenserfahrungen so verschiedenen großen Künstlern, welche innerlich doch Seelenverwandte sind, ist nun eine Welturaufführung eines Auftragswerkes der Wiener Staatsoper" - die in zwei Akte bzw. 14 Szenen gegliederte, bei ihrer Weltpremiere pausenlos durchgespielte Oper "Der Riese vom Steinfeld".
Es geht darin um eine historische Gestalt: Vor 120 Jahren soll im Oberösterreichischen der Bauernbursche Franz Winkelmeier gelebt haben, der nicht aufhören wollte zu wachsen - bis er die Größe von rund zweieinhalb Metern erreicht hatte (Einen echten Schuh des Riesen kann man in der derzeitigen Ausstellung der Wiener Staatsoper über die Entstehung der neuen Oper im Gustav-Mahler-Saal begutachten). Als Außenseiter wurde er aus der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen und für alle Unglücksfälle im Dorf verantwortlich gemacht, bis ein profitgieriger Geschäftsmann ihn als Attraktion von Stadt zu Stadt schleppte und als Jahrmarktsensation begaffen ließ, ihn sogar Kaisern und Königen vorführte. Nur 27-jährig kehrte der Riese in seine Heimat zurück und starb an Tuberkulose. Doch damit war seine Geschichte noch längst nicht vorbei: Nach den Maßen des Riesen wurde eine Puppe gebaut, ans Wirtshaus genagelt und als Fremdenverkehrsattraktion vermarktet - ganz nach dem fragwürdigen, jedoch gar nicht so selten anzutreffenden Verhaltensmuster, genau das hochleben zu lassen, was man vorher zerstört hat.
Historische Gestalt
Dem Riesen selbst ging es dagegen kaum um Profit und Popularität, er wollte im Grunde nur als Mensch mit all seinen Gefühlen, insbesondere seinem Bedürfnis nach Liebe anerkannt werden; während der ganzen Handlung der Oper träumt er von seinem Zuhause und hat den Wunsch, dass seine Mutter ihm eine große Wiese kaufen möge, eine Wiese so groß, dass er darauf endlich klein wirken könne. Ganz wie in der erst vor wenigen Monaten uraufgeführten Oper von Laurent Petitgirard um den Elefantenmenschen Joseph Merrick geht es also auch hier um einen durch sein außergewöhnliches Äußeres zum Schauobjekt degradierten Menschen, um ein in seinen Gefühlen verletzliches Individuum, das der sensationslüsternen Masse gegenübersteht. Eine gefühlsintensive Leidensgeschichte um eine berührend wirkende Hauptfigur hätte diese Story werden können, in der Cerha-Turrini-Oper "Der Riese vom Steinfeld" wurde sie das aber nur bedingt. Denn dazu verlaufen viele Episoden dieses Stationendramas viel zu gleichartig: Ob die englische Queen Victoria oder der deutsche Kaiser Wilhelm II., ob Zirkusdirektor oder Rabbi, sie sind alle in einer aufgesetzten Überdrehtheit dargestellt, deren karikierende Absicht zwar leicht verständlich ist, die aber in ihrer satirischen Tiefenwirkung versagt - dies vor allem der teilweise erschreckend banalen Worte wegen, die Peter Turrini geschrieben hat. "Hojotoho, hojotoho, es erscheint der Willem zwo" als Auftrittsankündigung für den deutschen Kaiser - dieser Textkalauer gehört ebenso wenig in die Rubrik hochwertiger Operntexte wie die die Höhe ihrer Mützen besingende Wach-Truppe der englischen Königin oder die peinliche Präsentation eines Wasserklosetts, während Queen Victoria als "größte Frau der Welt" den "größten Mann der Welt" zu vergewaltigen versucht. Wesentlich origineller und in ihrer Komik pointierter wirkt die Szene des Dorfbürgermeisters, der den toten Riesen für seine Heimatgemeinde reklamiert - in diesem Moment ließen in der Tat verschiedenste Lokalpolitiker grüßen.
Allen diesen Szenen hat Friedrich Cerha differenziert gewobene und - auch wenn es der Komponist nicht hören will - an Alban Berg erinnernde Klangteppiche unterlegt, die mit farblichem Kolorit den Schauplatz charakterisieren: Klezmer-Anklänge sind bei der Szene im Prager Judenviertel unüberhörbar, Wagners "Walküre" lässt bei Kaiser Wilhelm grüßen, Elgar im Londoner Abschnitt des Werkes oder typische Akkordeon-Klänge beim Pariser Varieté-Bild. Atmosphäre wird dadurch vermittelt, zumal die prachtvoll spielenden Wiener Philharmoniker unter der hervorragenden Leitung von Michael Boder alle diese Szenen in nuanciert schmelzreicher Farbenpracht realisierten. Skurrilität und Ironie (auf die der Text immer wieder abzielt) sind dieser Musik aber ebenso fremd wie theatralische Steigerungen, nur in den expressiv aufwühlenden Zwischenspielen zwischen den Szenen kann man die Zerrissenheit des Riesen, seine seelischen Gefühlsschwankungen deutlich spüren. Aus dem Mund des Hauptdarstellers hingegen vernimmt man davon außer in einem zweimal angestimmten traurigen Lied kaum etwas. Dieser wehmütige Gesang gehört gemeinsam mit dem Liebesduett zwischen dem Riesen und der kleinen Frau zu den lyrisch empfindsamen, sinnlichen Höhepunkten des Werkes, das trotz seiner Kürze allzu statisch ausgefallen ist.
Neu, doch nicht verstörend
Dies liegt auch daran, dass sich die Figuren kaum entwickeln. Da ist die fast durchgehend passiv bleibende Hauptfigur des Riesen, von Thomas Hampson (seine stattliche Erscheinung von 1,95 Meter wurde durch Kothurne fast auf die Größe des historischen Riesen gebracht) einfühlsam, stets wortdeutlich, mit herrlich strömendem Bariton gesungen, dann die in den Riesen verliebte kleine Frau, deren Gesangsphrasen Friedrich Cerha in extremen Höhenregionen angesiedelt hat: Diana Damrau meisterte sie mit traumwandlerischer Sicherheit und einer für diese Höhenlagen außergewöhnlichen Textverständlichkeit. Berührende Wärme und Traurigkeit verlieh Michelle Breed der Mutter des Riesen; hervorragend - auf Grund ihrer Einsatzfreudigkeit, aber auch durch bemerkenswerte sprachliche Verständlichkeit - waren aber auch Herwig Pecoraro als den Riesen vermarktender Klammerschneider, Wolfgang Bankl als Zirkusdirektor, Conférencier und (sehr pointiert) als Dorfbürgermeister, Alfred Sramek als Teufel und als Sargtischler (der dem für den Standardsarg zu langen Riesen kurzerhand die Beine absägt), Heinz Zednik als Rabbi und als deutscher Kaiser sowie Margareta Hintermeier als Königin Victoria. Und dazwischen gab es auch noch - als Sprechrolle - den Musikzauberer oder versoffenen Komponisten, dargestellt von Branko Samarovski.
Jürgen Flimms Regie blieb eher unauffällig und tastete sich brav am Text entlang: zu den Personen und ihren Gefühlswelten machte er über das Textlich-Musikalische hinaus keine Aussagen; er hat sich aber auch nicht bemüht, die Szenenfolge spannungsreicher und stringenter erscheinen zu lassen (was gefährliche Längen verursachte bei einer von ihrer Dauer recht kurzen Oper). Er bewegte solide die Menschenmassen, zu denen neben den ausgezeichneten Solisten auch ein prachtvoll vorbereiteter Chor, samt Wiener Sängerknaben, Ballett und Bühnenorchester gehörten, in bewegt bunten Bildern des transparenten Einheitsdekors von Erich Wonder, das (nicht eben zwingend) ländliches Leben von einst mit städtischer Technologie von heute vereint, leicht die schnellen Szenewechsel ermöglicht und originell mit der Idee "zu groß/zu klein" spielt, wenn etwa der Thron für die beiden Herrscher überdimensional den kleinen Kirchturmidyllen im Modellbauformat gegenübersteht.
Eine neue, weder besonders berührende noch verstörende Oper hat die Wiener Staatsoper mit der Uraufführung des "Riesen vom Steinfeld" herausgebracht - ein Werk, das sich in seiner einfachen Nachvollziehbarkeit und gefälligen Musiksprache eindeutig zur Oper von altmodischer Machart bekennt. Galten diesem Einwand die ganz wenigen Buhrufe, die sich in den großen und langanhaltenden Jubel nach der Premiere mischten?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!