
Für immer zeitgemäß
Olga Neuwirths Auftragswerk „Orlando“ an der Staatsoper, Frederick Loewes „Brigadoon“ märchenhaft an der Volksoper, Stanisław Moniuszkos „Halka“ am Theater an der Wien.
Olga Neuwirths Auftragswerk „Orlando“ an der Staatsoper, Frederick Loewes „Brigadoon“ märchenhaft an der Volksoper, Stanisław Moniuszkos „Halka“ am Theater an der Wien.
Schon zu Beginn des Jahrhunderts wollte Olga Neuwirth der Wiener Staatsoper und den Salzburger Festspielen eine Oper über den wegen sexuellen Missbrauchs verurteilten Kärntner Kinderpsychiater Franz Wurst nach einer literarischen Vorlage von Elfriede Jelinek schmackhaft machen. Beide Intendanten, Ioan Holender und Gerard Mortier, lehnten ab. Nun landete Olga Neuwirth mit „Orlando“, einem Auftrag der Wiener Staatsoper, einen mehr als veritablen Erfolg. Nur wenige Buhs mischten sich in den kräftigen Schlussapplaus dieser mit Spannung erwarteten Uraufführung, mit dem eine der überzeugendsten Produktionen der Ära Dominique Meyer bedankt wurde. Dabei sah es bis zur Premiere gar nicht nach einer solchen Zustimmung mit ausverkauften Folgevorstellungen aus.
Neuwirths auf Virginia Woolfs gleichnamigem Roman basierendes, über drei Stunden dauerndes neues Musiktheater konfrontiert mit Madrigalen und Chorälen, Zitaten aus Barock- und Filmmusik, Rock und Pop, Kinder- und Weihnachtsliedern, die sie in unterschiedlich schillernde, intime wie heftig aufrauschende Klänge virtuos einbindet. Die kompliziert erdachte Partitur verlangt nach einem überdimensioniert besetzten Orchester, darunter um einen Viertelton heruntergestimmte zweite Geigen, womit dem Gesamtklang bewusst Unreinheit zuwächst, und bezieht anspruchsvolle Live-Elektronik mit ein.
Den meisten Eindruck hinterlässt diese Novität, so lange sie den Worten Woolfs folgt. Ab der Pause allerdings konfrontiert das von der Komponistin mit Catherine Filloux entworfene Libretto mit einer Vielfalt an Assoziationen, die auch deshalb mehr irritieren als fokussieren, weil die Musik keine neuen Farben mehr einbringt. Man wäre gut beraten gewesen, textlich bei Woolfs Original zu bleiben und der Versuchung zu widerstehen, Woolfs dichte, autobiographisch gefärbte Geschichte mit plakativen Hinweisen zu Nazi-Diktatur, Berliner Mauerfall, Missbrauchsskandalen oder Klimakrise bis in die Gegenwart zu erweitern. Selbst die eindrucksvoll die einzelnen Szenerien illustrierenden Videoeinblendungen (Will Duke) auf sechs immer wieder neu angeordneten Wänden – eine faszinierende Bilderwelt, welche die Regie (Polly Graham) in den Hintergrund drängt – vermochten diese Überlänge nicht vergessen zu machen.
Kate Lindseys vorzüglicher Orlando und Anna Clementis exzellenter Narrator stehen an der Spitze eines ideal aufeinander eingestimmten großen Ensembles in prachtvollen Kostümen von Comme des Garçons. Für die Leitung dieses anspruchsvollen Unternehmens hätte man sich keinen Kompetenteren wünschen können als Matthias Pintscher, selbst ein renommierter Komponist. Er leistete als Dirigent der vielfach herausgeforderten Instrumentalisten und der von drei Leitern geführten Chöre Außerordentliches und ermöglichte wesentlich das Gelingen dieser international viel beachteten Uraufführung.
Enttäuschender polnischer Verismo
Am Beispiel der Liebesgeschichte des Gutsherrn Janusz und seiner Leibeigenen Halka wird in Stanisław Moniuszkos Vierakter „Halka“ Kritik am Adel geübt und werden Standesunterschiede aufs Korn genommen. Obwohl die Bauerntochter Halka ein Kind von ihm erwartet, verlässt Janusz sie, um standesgemäß Zofia, die Tochter eines anderen Gutsbesitzers, zu heiraten. Halka verliert das Kind, geht im Wasser unter. Regisseur Mariusz Treliński, im Vorjahr mit dem International Opera Award als bester Regisseur prämiert, verlegt die Handlung dieser Koproduktion des Theaters an der Wien mit dem Warschauer Teatr Wielki aus dem Adels- und Bauermilieu in ein fahles polnisches Hotel der 1970er Jahre (Bühne: Boris Kudlička), deutet die Protagonisten zu Angestellten und Gästen dieses Hauses um. Notwendig ist diese verkrampft wirkende Transferierung des Geschehens an diesen Ort und in die jüngere Vergangenheit nicht. Die bis heute aktuelle Botschaft dieser Oper lässt sich schon aus dem originalen Libretto unschwer erfassen.
Auch musikalisch hatte man wenig Fortüne. Das lag vor allem am Dirigenten Lukasz Borowicz. Misstraute er dem subtilen Charme, den Moniuszkos Musik auch ausstrahlt? Ließ er deswegen das ORF Radio-Symphonieorchester, von dem man sich eine flexiblere Begleitung der Sänger erwartet hätte, so deftig auftrumpfen? Oder konnte er mit der Akustik des Theaters an der Wien zu wenig anfangen? Auch Tomasz Konieczny hätte als Janusz nicht so lautstark agieren müssen. Wie überhaupt die zum Teil am Haus am Naschmarkt debütierenden Solisten wenig Subtilität bei der Bewältigung ihrer vokalen Aufgaben zeigten. Einige, darunter Corinne Winters in der Titelpartie, schienen bis an die Grenzen ihrer vokalen Möglichkeiten gefordert. Von Piotr Beczała als Halka-Vertrauter Jontek, der diesen Part auch in Warschau singen wird, hätte man sich nicht nur in seiner berühmten Arie mehr gestalterisches Feingefühl erwartet, so brillant und effektvoll er diese Herausforderung auch meisterte.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!












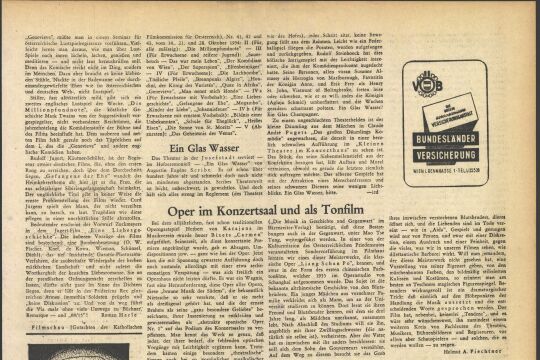


































































Werner%20Kmetitsch.jpg)


%20OFS_Monika%20Rittershaus%20(16).jpg)












_edit.jpg)



