"Lernen Sie Geschichte!" mahnte ein einstiger österreichischer Bundeskanzler vor Jahren einen Reporter. Hatten das drei Wiener Opernhäuser im Hinterkopf, als sie zu Premieren mit - durchaus verschiedenen -historischen Sujets luden? Bei Hector Berlioz' mehr als fünf Stunden in Anspruch nehmenden "Les Troyens" handelt es sich genaugenommen sogar um zwei Opern: In den beiden ersten Akten wird die Einnahme Trojas erzählt, in den drei folgenden über die Trojaner in Karthago berichtet. Der Komponist hätte seinen von Gluck und Spontini beeinflussten Fünfakter auch mit anderen Titeln versehen können. Denn anfangs dominiert die Seherin Kassandra, später steht Dido im Zentrum, der dritte Hauptprotagonist ist Aeneas. Vergils Epos "Aeneis" hat Berlioz seit frühester Jugend fasziniert und zu dieser Oper animiert. Den Plan führte er allerdings erst aus, als ihn eine Frau dazu bekräftigte: Liszts damalige Lebensgefährtin Fürstin Carolyne zu Sayn-Wittgenstein.
Der Sprung von 1500 bis 1200 vor Christus in das Jahr 1698 ist weit. Es ist auch ein anderes Genre, das Albert Lortzing mit seinem "Zar und Zimmermann" bedient: die deutsche Komische Oper. Geschichte schwingt aber auch hier mit. Im holländischen Zaardam -in der Oper zu Saardam umgetauft - hielt sich 1697/98 Zar Peter der Große auf, um Kenntnisse in der Schiffsbaukunst zu erwerben. Das erklärt den Titel dieses viel zu wenig gespielten Dreiakters. Saardams Bürgermeister van Bett spielt eine mindestens ebenso große Rolle wie der wegen der politischen Situation schließlich zur Rückkehr in seine Heimat gezwungene Zar, der lange mit dem Zimmergesellen Peter Iwanow verwechselt wird, mit dem er denselben Vornamen teilt. "Van Bett" wäre wohl ein weniger zugkräftiger Titel für diese in manchem Verdis "Falstaff" oder Strauss' "Capriccio" vorausahnende Oper.
Unterschiedlich gespiegelter Freiheitsheld
Wie verschieden sich Historisches darstellen und damit auch deuten lässt, zeigen Friedrich von Schiller und Gioachino Rossini, wenn es um den Schweizer Freiheitshelden schlechthin geht, nämlich Wilhelm Tell. In Schillers Schauspiel dauert es, ehe der anfangs politisch wenig interessierte Familienvater sich zum Anführer der Aufständischen gegen die tyrannisch agierenden Habsburger aufschwingt. Bei Rossini -die Oper spielt Anfang des 14. Jahrhunderts -ist er es von Anfang an. In diesem Vierakter wird auch sein Verhalten zu seinem Sohn deutlicher thematisiert.
Und wie stellt man sich in diesen Neuproduktionen diesen Themen? Als eine sich bis zum billigen Klamauk erstreckende "Revue in blau" - denn diese Farbe dominiert das Bühnenbild und die Kostüme dieser Produktion -deutet der auch für die grell-kitschige Ausstattung verantwortliche Hinrich Horstkotte Albert Lortzings "Zar und Zimmermann" an der Volksoper Wien. Begleitet von jenen Ingredienzien, die man gemeiniglich mit den Niederlanden verbindet: wie blauweiße Kacheln, Tulpen, Käse, Windmühlen, Holzschuhe.
Die zuweilen die Lachmuskeln strapazierende, sehr handfest servierte Komödie, gleitet im Finale unvermittelt und unnötig ins Skurrile ab, wenn der Regisseur die Kantatenprobe in ein Altersheim verlegt, die Choristen zu von Alzheimer geplagten Senioren mutieren lässt. Um damit die Tölpelhaftigkeit van Betts noch zu unterstreichen, wie er meint. Eines solchen Holzhammers hätte es nicht bedurft. Schon in seinen Auftritten zuvor zwang die Regie den sängerisch exzellenten Lars Woldt die Figur des van Bett mit nachgerade plump aufgeblasener Outriertheit zu überzeichnen.
Nur durchschnittlich erwies sich die übrige Besetzung. Am ehesten wusste Daniel Schmutzhard als Zar zu überzeugen, schlichtweg überfordert war Mara Mastalir als Marie. Schade, denn Christof Prick am Pult animierte das akkurat aufspielende Volksopernorchester zu einer betont spritzigen und durchsichtigen Interpretation, legte sämtlichen Sängern einen idealen Teppich, auch wenn ihn dann nur wenige entsprechend zu nutzen wussten.
In den 1970er Jahren waren, in einer gekürzten Version, Berlioz' "Les Troyens" erstmals im Haus am Ring zu sehen. Jetzt feiert dieses besonders ausführlich geratene Werk - auch wenn es in seinen zeitlichen Dimensionen von Wagners "Götterdämmerung" oder dessen "Meistersingern" noch übertroffen wird, was man zuweilen vergisst - in einer Koproduktion mit den Opernhäusern von London, Mailand und San Francisco an der Staatsoper eine Wiederkehr. In einer allerdings ziemlich Mummenschatz-artigen Szenerie (Es Devlin) und in der Regie von David McVicar, der das Geschehen in die Entstehungszeit des Werks, Mitte des 19. Jahrhunderts, transferiert. Den Grund dafür lässt er mit dieser Inszenierung offen. Ebenso, weshalb er auf eine Führung der zahlreichen Personen so gut wie verzichtet, sich stattdessen auf eine dann nur unterschiedlich die Handlung nachvollziehende, plakative Bildersprache konzentriert.
Wenn Joyce DiDonato die Bühne betritt, um vom ersten Ton an als Dido zu faszinieren, tritt all das rasch in den Hintergrund. Überzeugender lässt sich diese Partie kaum darstellen. Nicht mit diesem Format wusste Brandon Jovanovich als unterschiedlichen Höhenglanz verströmender Enée aufzuwarten, noch weniger die bereits in der Generalprobe Anna Caterina Antonacci ersetzende Monika Bohinec, so ambitioniert sie sich auch in ihre herausfordernde Aufgabe als Cassandre stürzte. Rollendeckend die übrigen Comprimarii. Aus ihnen ragte Szilvia Vörös als emphatische Schwester der Dido heraus.
Bestens vorbereitet zeigten sich die das Volk der Trojaner wie der Karthager darstellenden Staatsopernchoristen. Einen ebenso großen Abend wie DiDonato, die alle überstrahlte, hatte das von Alain Altinoglu mit ungeheurer Energie und Verve zu brillanter Klangentfaltung geführte Staatsopernorchester, das damit zum zweiten Star dieser gefeierten Premiere wurde.
Videowall und Schlagbaum
Mit der szenisch avanciertesten Auseinandersetzung eines historischen Stoffes konfrontiert das Theater an der Wien. Regisseur Torsten Fischer stellt in seiner in die Gegenwart gestellten Lesart von Gioachino Rossinis Spätwerk "Guillaume Tell" Bezüge zu den faschistischen Regimen her, hebt die Bürgerkriegsatmosphäre hervor, sieht Tell weniger als Helden denn als Manupulierten und in Walter Fürst den Anführer einer neuen, von der Tyrannei befreiten Schweizer Gesellschaft. Zudem rückt in seiner gedankenvollen Darstellung Mathilde in die Nähe einer Sophie Scholl. Um das deutlich zu zeigen, hätte es nicht unbedingt diese zuweilen mit zuviel kriegerischem Gerät, aber auch unnötigen Requisiten wie Schlagbaum oder Sesseln überfrachtete Szenerie von Herbert Schäfer und Vasilis Triantafilopoulos bedurft.
Unterschiedlich spannungsvoll, vor allem lautstark führte der damit kaum überzeugende Theater an der Wien-Intendant Diego Matheuz die Wiener Symphoniker durch die Partitur. Er zwang damit die Protagonisten, voran den intensivem Arnold (John Osborn) und die nicht weniger dramatisch ihren Part anlegende Jane Archibald als Mathilde zu unnötigem, den auch subtilen Reiz des Werks verkennendem Forcieren. Christoph Pohls Tell blieb blass. Wenig profiliert, wenn auch als Ensemble in sich stimmig, die übrigen Solisten, denen diese Inszenierung auch darstellerisch einiges abverlangt. Wie auch dem mit der gewohnten Präsenz aufwartenden, exzellenten Arnold Schoenberg Chor, den Fischer -er fasst dieses Stück zudem als Metamorphose des Themas "von der Nacht zum Licht" auf, wie man auf den Videos unschwer erkennen kann -vielfach in das Zentrum des Geschehens rückt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!




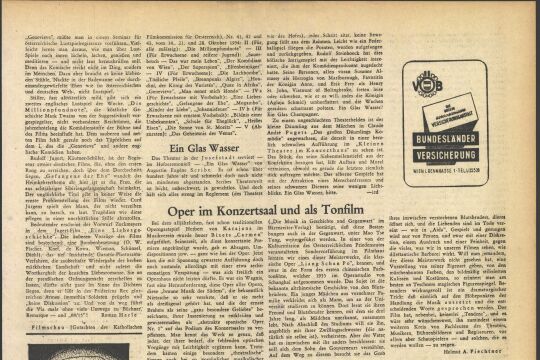








































































%20OFS_Monika%20Rittershaus%20(16).jpg)
















_edit.jpg)




