Selten wurden Erwartungen so enttäuscht, wie bei der Staatsopernerstaufführung von Weills "Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“, was sich auch an der Reaktion des Publikums zeigte.
Wenige Stunden vor der Premiere wurde die Vertragsverlängerung von Staatsoperndirektor Dominique Meyer und Generalmusikdirektor Franz Welser-Möst bekanntgegeben. Meyers Vertrag läuft bis 2020, der seines Musikchefs zwei Jahre kürzer. So lange besteht auch Welser-Mösts Verpflichtung als Musikdirektor des Cleveland Orchestras. Ob er mit diesem Weill-Dreiakter mehr Fortune gehabt hätte? Wer sich von dieser Produktion eine Antwort auf die Frage erhofft hatte, ob es sich hier um ein Stück handelt, dem man unbedingt im Repertoire der Staatsoper begegnen müsse, bekam sie jedenfalls nicht. Denn in der Art, wie dieser Dreiakter musiziert und szenisch arrangiert wurde, ist er entbehrlich. Nicht nur in Wiens erstem Haus.
"Sittenbilder aus unserer Zeit“
"Wenn man sieht, dass unsere heutige Welt nicht mehr ins Drama passt, dann passt das Drama eben auch nicht mehr in die Welt“, formulierte Bertolt Brecht 1926 seine Vorstellung von einem epischen Theater. Im Jahr darauf kam es zur ersten Begegnung mit Kurt Weill. Schon dabei wurde die Idee einer gemeinsamen Oper geboren. So begeistert Weill war, so zögerlich setzte er den ersten Schritt, komponierte erst einmal nach Texten Brechts die fünf Mahagonny-Gesänge, die er zum 1927 in Baden-Baden uraufgeführten Songspiel zusammenfasste, ehe beide die Oper in Angriff nahmen.
"Der Inhalt der Oper ist die Geschichte einer Stadt, ihre Entstehung, ihre ersten Krisen, dann der entscheidende Wendepunkt in ihrer Entwicklung, ihre glanzvolle Zeit und ihr Niedergang. Es sind ‚Sittenbilder aus unserer Zeit‘, auf eine vergrößerte Ebene projiziert“, charakterisierte der Komponist das Sujet der Oper, deren Uraufführung - 1930 im Neuen Theater in Leipzig - zu einem der größten Theaterskandale in der Geschichte der Weimarer Republik wurde. Für die Inszenierung verlangte er, "den rein musikalischen Ablauf zu sichern und die Darsteller so zu gruppieren, dass ein beinahe konzertantes Musizieren möglich ist“. Schließlich griff Weill für diesen stets - aber gerade heute besonders - aktuellen Zerrspiegel einer einseitig vom Geld faszinierten Gesellschaft auf die unterschiedlichsten Formen und Stilelemente zurück, womit sich in "Mahagonny“ von der frühen, hier parodistisch eingesetzten Polyphonie bis zu dem von ihm quasi kreierten Song alles findet. Sorgfältig eingeblendete Zitate, unter anderem aus "Freischütz“, "Tristan“, "Zauberflöte“ oder dem kitschigen "Gebet einer Jungfrau“, miteingeschlossen.
Ingo Metzmacher am Pult des von ihm zu differenziertem kammermusikalischen Musizieren angehaltenen Staatsopernorchesters versuchte diese Metaebenen von Weills Musik stets hörbar zu machen. Allerdings von einem so zurückhaltenden Temperament begleitet, dass sich bald Langeweile einstellte, die selbst in den zündendsten der 21 Nummern dieser Oper nicht vollends weichen wollte. Dabei hatte man sich gerade von diesem Kenner der Musik des vorigen Jahrhunderts eine nicht nur rhythmisch konzise sondern vor allem packende Deutung der Partitur erwartet.
Freilich hatte er immer wieder Rücksicht auf die Besetzung zu nehmen. Will man die gebrochene Ironie, den Sarkasmus dieser Revue - auch diesen Anspruch hat Weills Chef d’Œuvre - deutlich machen, bedarf es klarster Textverständlichkeit wie vokaler Brillanz, zudem eines besonderen Einfühlungsvermögens in das Stück wie seine Entstehungszeit. Damit eines Regisseurs, der dies alles seinen Darstellern vermitteln kann. Jérôme Deschamps kann es nicht. Was er auf die Bühne stellt, entpuppt sich als kaum mehr denn als ziemlich zufällige Arrangements.
So überraschte es nicht, dass selbst die Weill-erfahrene Angelika Kirchschlager, die freilich alle übrigen Protagonisten gesanglich wie darstellerisch weit überragt, unter ihren Möglichkeiten und damit dem Schwung und Witz von Weills Musik einiges schuldig blieb. Bei Elisabeth Kulman, so schön sie sang, vermisste man Bühnenpräsenz, ihre Leokadja Begbick war damit nur eine halbe Sache. Auch Herwig Pecoraro als Fatty und Tomasz Konieczny als Dreieinigkeitsmoses vermochten mit ihren Auftritten nicht zu erklären, dass sie mit dem bissigen Charme und der Doppelbödigkeit des pointenreichen Textes etwas anfangen könnten. Nicht anders Christopher Ventris’ Jim.
Skurril-bunte Gewänder
Selbst Heinz Zednik demonstrierte als "Regisseur der Bühne“, in kitschiger Uniform vor ein Regiepult gestellt, dass er sich in anderen Partien ungleich wohlerfühlt. Was auch für die sich nicht gerade durch klare Artikulation auszeichnenden Choristen galt. Sie tummelten sich in ebenso skurril-bunten Gewändern (Vanessa Sannino) auf der Bühne (Olivia Fercioni) - in die Höhe ragende Bretter, die sich zu zuweilen surreal anmutenden Häusern formen, mit einem Ausblick auf die Silhouette der vermeintlich besseren Welt Mahagonny - wie die übrigen nur zum Teil verständlichen Darsteller.
weitere Termine:
27., 30. Jänner, 2., 5. Februar
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!


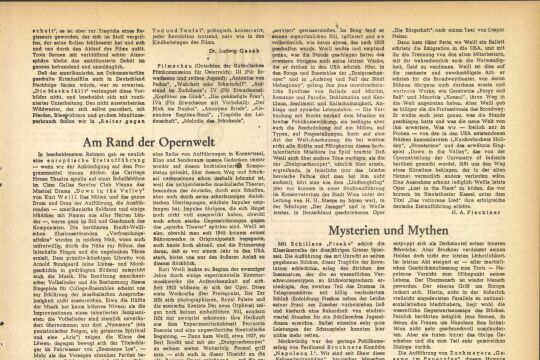















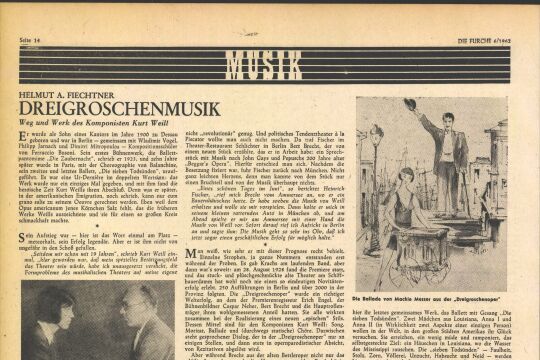
























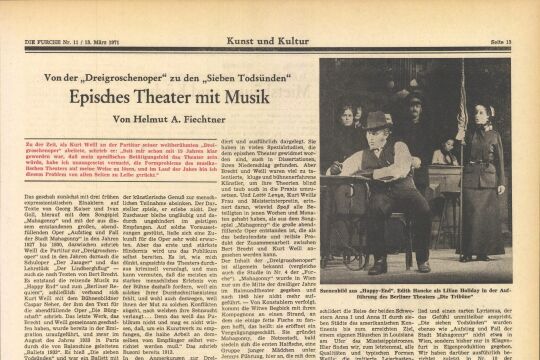






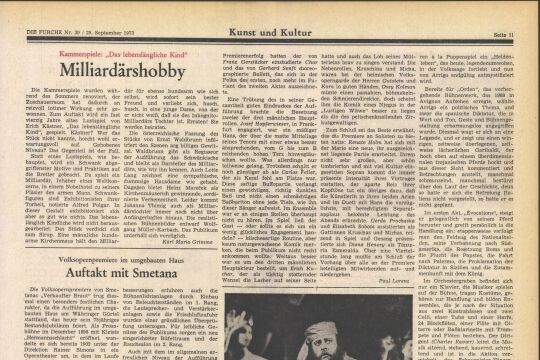




























%20OFS_Monika%20Rittershaus%20(16).jpg)



















