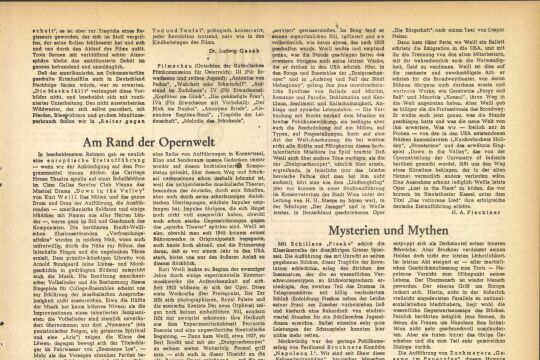Et wurde als Sohn eines Kantors im Jahre 1900 zu Dessau geboren und war in Berlin — gemeinsam mit Wladimir Vogel, Philipp Jarnach und Dimitri Mitropoulos — Kompositionsschüler von Ferruccio Busoni. Sein erstes Bühnenwerk, die Ballettpantomime „Die Zaubernacht“, schrieb er 1923, und zehn Jahre später wurde in Paris, mit der Choreographie von Balanchine, sein zweites und letztes Ballett, „Die sieben Todsünden“, uraufgeführt. Es war eine Ur-Derniere im doppelten Wortsinn: das Werk wurde nur ein einziges Mal gegeben, und mit ihm fand die heroische Zeit Kurt Weills ihren Abschluß. Denn was er später, in der amerikanischen Emigration, noch schrieb, kann nur cum grano salis zu seinem Oeuvre gerechnet werden. Eben weil dem Opus americanum jenes Körnchen Salz fehlt, das die früheren Werke Weills auszeichnete und sie für einen so großen Kreis schmackhaft machte.
*
Sein Aufstieg war — hier ist das Wort einmal am Platz — meteorhaft, sein Erfolg legendär. Aber er ist ihm nicht von ungefähr in den Schoß gefallen.
„Seitdem mir schon mit 19 ]ahrett“, schieb Kurt Weill einmal, „klar geworden war, daß mein spezielles Betätigungsfeld das Theater sein würde, habe ich unausgesetzt versucht, die Formprobleme des musikalischen Theaters auf meine eigene
Weise zu lösen, und im Laufe der Jahre bin ich diesem Problem von allen Seilen zu Leibe gegangen.“
„Royale Palace“, „Der Protagonist“, „Der Zar läßt sich photo-graphieren“ und „Der neue Orpheus“ waren solche Versuche. Aber erst in der Zusammenarbeit mit Bert Brecht, der mit den gleichen Formproblemen beschäftigt war, gelang das erste Paradigma des neuen epischen Theaters: das 1927 in Baden-Baden uraufgeführte „Kleine Mahagonny“, Vorläufer der abendfüllenden Oper „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ von 1930.
Außer Weills Songspiel standen an jenem denkwürdigen Abend noch Hindemiths Sketch „Hin und zurück“, Tochs „Prinzessin auf der Erbse“ und zwei „opera minutes“ von Milhaud auf dem Programm. Neben diesen avancierten und artistischen Werken wirkten die melodiösen und volkstümlichen Songs von Kurt Weill schockierend. Schockwirkung ging auch von der zweiten Fassung der Oper „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ aus, die am 9. März 1930 in Leipzig unter der musikalischen Leitung von Gustav Brecher uraufgeführt wurde. Nach jener Premiere wurde ein Mann beobachtet, der gleichzeitig applaudierte und „Pfui!“ rief. Dieser Zeitgenosse drückte genau die ambivalente Wirkung aus, die das Werk auf das Publikum übte. Ambivalent ist Brechts Text: Die glorifizierte Netzestadt, von steckbrieflich Verfolgten gegründet, von „Mädchen“ und Holzfällern aus Alaska bevölkert, die hier, nach sieben harten Jahren, endlich einmal alles dürfen; diese Stadt, „die nur ist, weil alles so schlecht ist“, geht am Schluß in Flammen auf. Mahagonny ist kulinarische Oper — und zugleich Aufhebung, Persiflage dieser Gattung. Die Musik ist kindlich-primitiv und raffiniert zugleich. Diese Partitur enthält das Brutalste und das Feinste, das Weill geschrieben hat: den Männerchor „Erstens vergeßt nicht, kommt das Fressen...“ und das „Lied der Liebenden“ von des Kranichen in hohen Bogen, das, altertümlich stilisiert, mit Terzen und einem Baß beginnt und an seinem Höhepunkt in reale Fünf-stimmigkeit mündet.
Die Mahagönny-Partitur enthält auch das Bedeutendste und Kunstvollste, das Weill zu leisten imstande war: kantable, lyrisch bestrickende Duette, hochdramatische Soli, meisterliche Orchesterfugati und großangelegte Chorensembles. Ein wichtiges Element dieser Musik ist ferner die Parodie bzw. die Montage.
In ausführlichen Anmerkungen zu der Oper „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ haben die beiden Autoren ihre Idee vom „epischen Theater“ dialektisch entwickelt, und dieses Dokument ist von Opern- und Theaterwissenschaftlern oft zitiert und kommentiert worden. Aber Lotte Lenja macht in ihren Erinnerungen an die Mahagonny-Zeit auch darauf aufmerksam, was für einen Spaß Brecht und Weill und alle am Stück Beteiligten in jenen Wochen hatten, als aus dem „kleinen“ das „große“ Mahagonny wurde.
*
Zwischen diesen beiden Fassungen lag die „Dreigroschenoper“ von 1928, deren Entstehungsgeschichte vor kurzem Heinrich Fischer erzählt hat. Im Jahr 1928 nämlich hatte ein junger Schauspieler, Ernst Josef Aufricht, ganze 27 Jahre alt, das Berliner „Theater am Schiffbauerdamm“ übernommen und dem damaligen Münchner Chefdramaturgen Heinrich Fischer angeboten, sein Mitdirektor zu werden. Aber womit sollte man beginnen? Man dachte an „Mississippi“ von Georg Kaiser, an Wedekinds „Frühlings Erwachen“ — aL:r beide Stücke schienen
nicht „revolutionär“ genug. Und politisches Tendenztheater ä la Piscator wollte man auch nicht machen. Da traf Fischer im Theater-Restaurant Schlichter in Berlin Bert Brecht, der von einem neuen Stück erzählte, das er in Arbeit habe: ein Sprechstück mit Musik nach John Gays und Pepuschs 200 Jahre alter „Beggar's Opera“. Hierfür entschied man sich. Nachdem die Besetzung fixiert war, fuhr Fischer zurück nach München. Nicht ganz leichten Herzens, denn man kannte von dem Stück nur einen Bruchteil und von der Musik überhaupt nichts.
„Eines schönen Tages im Juni“, so berichtet Heinrich Fischer, „rief mich Brecht vom Ammersee an, wo er ein Bauernhäuschen hatte. Er habe soeben die Musik von Weill erhalten und wolle sie mir vorspielen. Dann holte er mich in seinem kleinen ratternden Auto in München ab, und am Abend spielte er mir am Ammersee mit einer Hand die Musik von Weill vor. Sofort darauf rief ich Aufricht in Berlin an und sagte ihm: Die Musik geht so sehr ins Ohr, daß ich jetzt sogar einen geschäftlichen Erfolg für möglich halte.“
*
Man weiß, wie sehr er mit dieser Prognose recht behielt. Einzelne Strophen, ja ganze Nummern entstanden erst während der Proben. Es gab Krachs am laufenden Band, aber dann war's soweit: am 28. August 1928 fand die Premiere statt, und das stuck- und plüschgeschmückte alte Theater am Schiffbauerdamm hat wohl noch nie einen so eindeutigen Novitätenerfolg erlebt. 250 Aufführungen in Berlin und über 2000 in der Provinz folgten. Die „Dreigroschenoper“ wurde ein richtiger Welterfolg, an dem der Premierenregisseur Erich Engel, der Bühnenbildner Caspar Neher, Bert Brecht und die Hauptrollenträger ihren wohlgemessenen Anteil hatten. Sie alle wirkten zusammen bei der Realisierung eines neuen „epischen“ Stils. Dessen Mittel sind für den Komponisten Kurt Weill: Song, Moritat, Ballade und (durchwegs statische) Chöre. Dazwischen steht gesprochener Dialog, der in der „Dreigroschenoper“ nur an einigen Stellen, und dann stets in opernparodistischer Absicht, von Rezitativen abgelöst wird.
Aber während Brecht aus der alten Bettleroper nicht nur das „Milieu“, sondern auch die Hauptpersonen (den Bettlerkönig Peachum, den Chef der Straßenbanditen Macheath, den Polizeichef von London, Brown, genannt „Tigerbrown“) und mehrere Nebenpersonen übernahm und auch noch ganze Strophen von Francois Villon in freier Übersetzung in den Text montierte, hat Weill mit seiner Musik etwas durchaus Neues geschaffen. Wenn man von der barockisierenden Ouvertüre und einigen parodisti-schen Stellen im letzten Bild absieht, so ist die gesamte Musik, Nummer für Nummer, originale — und originelle — Erfindung. Wie hier Aggressives und Sentimentales, Jazz und Liedhaftes, Lyrisches und Melodramatisches gemixt und mit sicherer Hand hingesetzt wurde, ist unvergleichlich. Es gibt Genialität in jedem Genre. Die Songs, die Balladen und Chöre der „Dreigroschenoper“ sind genial auf ihre Art. Sie wurden sogar stilbildend, und eine ganze Generation von Unterhaltungsmusikern hat sie zu kopieren versucht. Im zeitgenössischen „epischen Theater“ wirken sie gleichfalls nach: bei Boris Blacher, Rudolf Wagner-Regeny, Paul Burghard, Carl Orff, Hanns Eisler und Paul Dessau. „
Ebenso originell wie Weills melodische Erfindung ist seine Rhythmik, die vorwiegend auf den Formen der Tanzmusik der zwanziger Jahre basiert (Tango, Foxtrott, Shimmy, Slowfox und English-Walz). Unerreicht ist auch die Originalität seines Orchesterklanges, den man oft zu kopieren versucht hat und der auf der ausschließlichen Verwendung von Blasinstrumenten und einer Rhythmusgruppe beruht, die aus Klavier, Banjo und Schlagwerk besteht.
Die „Dreigroschenoper“ ist ein Kind ihrer Zeit, des Berlins der zwanziger Jahre; hektisch, aggressiv und sozialkritisch. Man hat
das Werk nach 1945 auf der Bühne zu neuem Leben zu erwecken versucht — mit zweifelhaftem Gelingen und Erfolg.
*
Das nächste gemeinsame Stück war „Der Lindbergh-Flug“ 1929. Im Jahr darauf folgte die Schuloper „Der Ja-Sager“. Die große Oper „Die Bürgschaft“, die Weill zusammen mit Caspar Neher schrieb — eines seiner Hauptwerke —, kam 1932 nicht mehr zum Zug. „Der Silbersee“, auf einen Text von Georg Kaiser, wurde noch 1933 an mehreren deutschen Bühnen gleichzeitig uraufgeführt, aber unmittelbar nach dem Start verboten. Brecht und Weill emigrierten zunächst nach Paris und schufen
hier ihr letztes gemeinsames Werk, das Ballett mit Gesang „Die sieben Todsünden“. Zwei Mädchen aus Louisiana, Anna I und Anna II (in Wirklichkeit zwei Aspekte einer einzigen Person) wollen in der Welt, in den großen Städten Amerikas ihr Glück versuchen. Sie erreichen, ein wenig müde und ramponiert, das selbstgesteckte Ziel: ein Häuschen in Louisiana, wo die Wasser des Mississippi rauschen. Die „sieben Todsünden“ — Faulheit, Stolz, Zorn, Völlerei, Unzucht, Habsucht und Neid — werden hier nur insofern als Laster gezeichnet, weil sie ihrem Träger gefährlich werden, der „sündigt gegen die Gesetze, die da reich und glücklich machen“, also von dem Ziel, dem bescheidenen bürgerlichen Wohlstand, abhalten. — Nur einzelne der meisterhaft geformten Nummern sind, was Einfall und Schlagkraft betrifft, ganz auf der Höhe der Song aus „Mahagonny“ und der „Dreigroschenoper“. Die Vergrößerung des Apparats und der musikalischen Formen hat, wenn man genau und kritisch hinhört, bei Weill eigentlich keine neuen Kräfte mobilisiert. Gewisse Grundfiguren der „Dreigroschenoper“-Songs wiederholen sich, und geblieben ist bei beiden Autoren die Vorliebe für jenes „mythische Amerika“ der Goldgräber, der Abenteurer beiderlei Geschlechts und der rasch aufstrebenden Städte, wo man die bekannten sozialkritischen Maximen Brechts am glaubwürdigsten demonstrieren kann (etwa mit Brechtschem Zynismus: „Wer keine Gemeinheiten duldet, wie soll der geduldet werden? Wer da nichts verschuldet, der sühnt auf Erden.“)
Und geblieben ist auch Lotte Lenja, Kurt Weills Frau, die berühmte Jenny aus der „Dreigroschenoper“ und aus „Mahagonny“. „Lotte Lenja singt Kurt Weill“, so heißt eine Platte, und so müßte man ein Kapitel überschreiben, das die Weill-Renaissance in Europa nach 1955 schildert. Genau fünf Jahre nämlich nach Weills Tod (am 3. 4. 1950) in New York, kehrte diese einzigartige Künstlerin nach Europa zurück. „Sie wurde in Hietzing (siel), einem Arbeiterviertel, geboren, ihre Mutter war Wäscherin...“, schrieb einer ihrer Biographen in einem Klappentext, und der gelernte Wiener lächelt. Aber wie dem auch sei: Sie konnte als Kind auf dem Seil tanzen und besuchte in Zürich eine Ballettschule. Im Landhaus Georg Kaisers lernte sie 1927 Kurt Weill kennen, und die beiden heirateten noch im gleichen Jahr. Lotte Lenja ist nur in Weilischen Bühnenwerken und als Interpretin der Chansons ihres Mannes aufgetreten. Sie hatte keine anderen Ambitionen. Aber hier war sie ideal und unübertrefflich. Die undefinierbare Rauheit ihrer Sopranstimme, die klare Diktion, ihr subtiles rhythmisches Gefühl, die Intensität des Ausdrucks, ihre hervorragende Musikalität und ihr zuverlässiges Gedächtnis: alle diese Qualitäten bewunderte man vor 30 Jahren, und man bewundert sie heute vielleicht noch mehr. Ihr Vortrag, ihr Stil entsprachen genau dem Geist des Berlins der zwanziger Jahre mit seinem Glanz und seiner Armut, seiner Skepsis und seiner Vitalität. So war sie, und so ist sie, fast unverändert, noch heute: Lotte Lenja, bewundert viel und viel gescholten, aber von keiner deutschsprachigen Chansonette oder Diseuse auch nur annähernd erreicht.
“LJier möchte der Biograph Weills am liebsten seine Ausfüh--1 A rungen beschließen. Mit der „Bürgschaft“ war ein Höhepunkt erreicht, mit den „Sieben Todsünden“ ein Kreis geschlossen. 1935 ging Weill nach Amerika, Hier entstanden, in rascher Folge, — meist für den Broadway — die Partituren zu „Johnny Johnson“, „Knickerbocker's Holiday“, „Street Scene“, „Lady in the Dark“ und einige andere, zuletzt „Lost in the Stars“. (Die „Furche“ vom 16. 12. 1961.) In allen diesen Stücken ist vom alten Weill kaum noch eine Spur zu finden. Ab und zu blitzt es, aber es zündet nicht mehr. Die Trennung von Brecht und Berlin, das Fehlen eines kritischen Publikums, statt dessen die allzu leichten, aber dollarschweren Erfolge in den Broadway-Theatern — all dies ist Kurt Weill schlecht bekommen. Für unser Gefühl ist das, was Weill „drüben“ schrieb, Konfektionsware: eine Legierung aus Puccini und Menotti, Gershwin, Musical und Operette. Man stellt das mit ehrlichem Bedauern fest — und kehrt zum alten, echten, nach Rauchtabak und Juchten riechenden Weill zurück. Denn der, einer der originellsten Musiker der ersten Jahrhunderthälfte, hat uns genug geschenkt, und den Ton, den er fand, den vergißt man nicht.