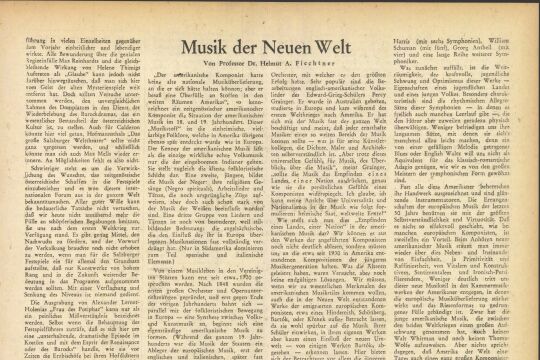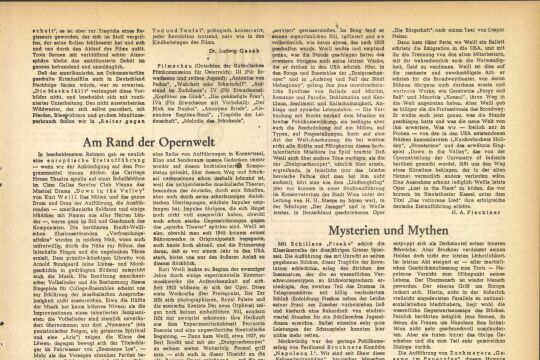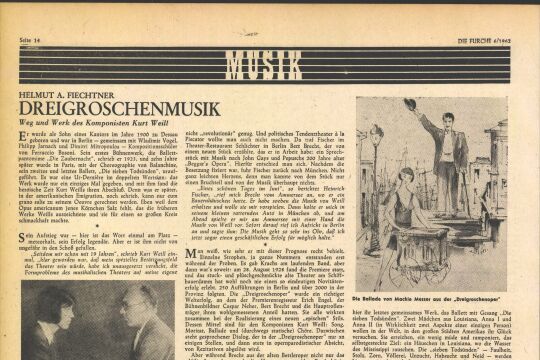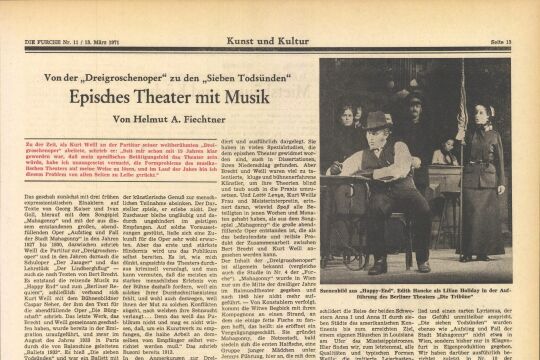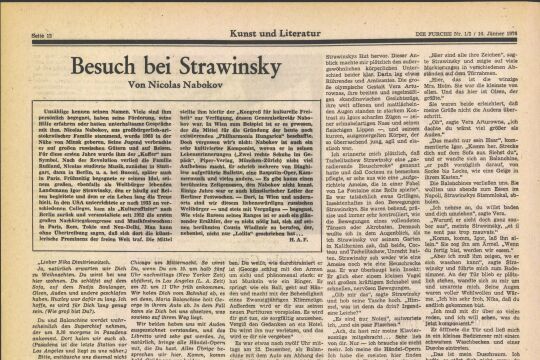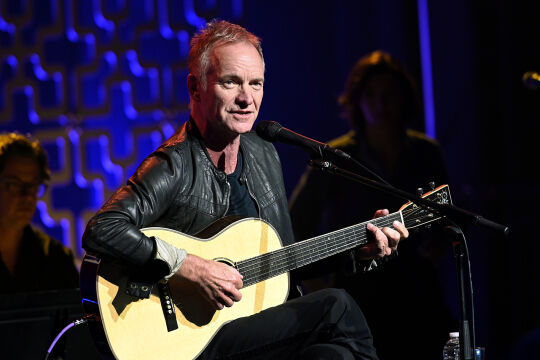Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Verzweifelt schön und tragisch“
„Franz Lehär — ja, Kurt Weill — nein. Seine Musik ist diejenige auf der Welt, an der ich nicht die geringsten Qualitäten entdecken kann.“ Dieses harte, apodiktische Urteil stammt von Arnold Schönberg, der, wie man weiß, nicht intolerant gegen anders schreibende, konservative Musiker war. Aber etwas fehlte ihm offenbar: das Gefühl für Charme — eine Qualität, deren seine eigene Musik oft in so schmerzlicher Weise ermangelt. Oder ist Charme, das interessant Anmutige, geistvoll Subtile, zart Lyrische keine Qualität? Weills Musik jedenfalls besitzt so viel davon, daß man mindestens ein halbes Dutzend zeitgenössische Musiker damit ausstatten könnte...
Das Suhrkamp-Taschenbuch „Über Kurt Weill“ (Beiträge von Theodor W. Adorno, Ernst Bloch, Paul Becker, Mary McCarthy, Walter Mehring, Erwin Piscator, Alfred Polgar und anderen, herausgegeben von David Drew, öS 46.20) ist ein Fest für Weill-Fans, weil sie in den Zeugnissen prominenter Künstler und Gelehrter, von Musikern, Dichtern und Philosophen, die Qualität einer Musik bestätigt finden, die wir nie ohne Interesse, Emotion und Rührung hörten. Das Gekläff der Nazi-Presse, ebenfalls durch einige besonders giftige und denun-ziatorische Stimmen vertreten, bestärkt uns nur in der positiven Wertung. Denn seit seiner Zusammenarbeit mit Brecht, die 1927 begann und 1935 endete, bot Weill ja politischen Zündstoff genug, er, der eher ein introvertierter, umpolitischer Mensch war, den Brechts Texte im Detail wahrscheinlich nicht interessiert haben. Aber er fand hier ein Vehikel für eine Musik und einen Tonfall, der ihm gefiel.
Sein Unglück — wie das vieler — war das Jahr 1933. Am 18. Februar, neun Tage vor dem Reichstagsbrand, kam es bei der Aufführung des Wintermärchens „Der Silbersee“ von Georg Kaiser mit Musik von Weill zu Tumulten, im März traf er in Paris Brecht, um die letzte gemeinsame Arbeit zu machen (das Ballett „Die sieben Todsünden“), 1935 fuhr er nach New York und begann für den Broadway zu arbeiten. Erfolgreich zwar und ohne Hemmungen, aber es war sein Ende als Künstler.
Als Komponist kommt Weill nirgend her und hat keine Nachfolge. Das trifft vor allem auf die Meisterwerke seiner mittleren Periode zu, von denen man aber neben „Dreigroschenoper“ und „Mahagonny“ auch die große Oper „Die Bürgschaft“ auf einen Text des ihm befreundeten Caspar Neher, das reizende, lyrisch-ironische Heilsarmee-Stück „Happy End“, vor allem aber die Schulopern „Der Jasager“ und „Lindbergh-Flug“ nennen sollte.
Was seine Musik von jeder anderen unverwechselbar unterscheidet, ist der charakteristische, bald, deklamierende, bald lyrisch-ariose Tonfall der Singstimmen, der aparte Klang seines Orchesters, meist ohne Streicher, in dem also die Bläser dominieren, unter diesen wieder zwei oft solistisch eingesetzte Trompeten und Saxophone, ergänzt durch Tuba, Banjo und ein manchmal verstimmtes Klavier. Die seine Musik am besten charakterisierenden Worte fand bereits 1932 der französische Kritiker Marcel More anläßlich des „Kleinen Mahagonny“: „Das Ganze ist von einer fremdartigen, phantastischen, halluzinatorischen Schönheit... Totengesang, Musik mit veilchenblauen Augen. Eine einzigartige Stimme spricht aus diesem Werk: sie ist verzweifelt schön und tragisch, wie der lange Stiel einer schwarzen Rose mit spitzen und scharfen Dornen... Es ist die Hymne, die den freudlosen Tagen vorangeht, die da kommen werden.“
Die weniger lyrische „New York Herald Tribüne“ nannte Weill in einem Nachruf den, international gesehen, individuellsten Kopf auf dem ganzen Gebiet des Musiktheaters im letzten Vierteljahrhundert.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!