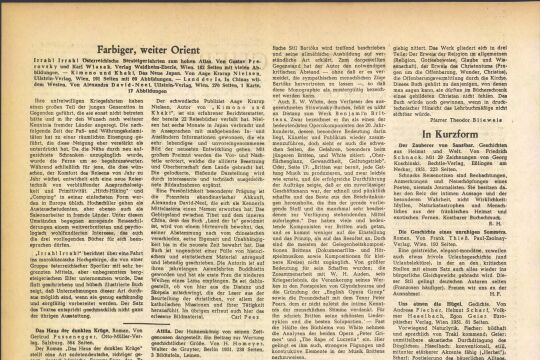Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ein Idol wird manipuliert
Als einzige Premiere der diesjährigen Opernfestspiele fand im Münchner Nationaltheater die Uraufführung der Oper in zwei Akten für Solisten, gemischten Chor, Orchester und Elektronik „Die Versuchung“ von Josef Tal statt. Es handelt sich dabei um eine Auftragsarbeit der Bayerischen Staatsoper, urad selbstverständlich steckt in einem Auftrag dieser Art ein gewisses Risiko. Natürlich war Josef Tal für die Münchner Staatsopern-Intendanz kein unbeschriebenes Blatt, denn der 1910 in Pinne bei Posen gebürtige, in Israel lebende Komponist ist seit 1965 Leiter der Abteilung für Musikwissenschaften und Direktor des Institut für Elektronische Musik an der Universität von Jerusalem und konnte mit seinen Opern ,Ashmedai“ (Hamburg 1971) und „Masada“ (Jerusalem 1973), sowie mit vielen Werken der absoluten Musik internationales Interesse finden Trotzidem bleibt ein nicht geringer Rest an Risiko, und diesen hat — so meine ich — ein subventioniertes Opernhaus auch zu tragen. Leider kann diese generelle Feststellung jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß man in diesem Fall von vergeblicher Liebesmüh' sprechen muß. Der Librettist Israel Eliraz ist ein profilierter Mann und er hat sein Textbuch zur „Versuchung“ im engen Kontakt mit dem Komponisten geschrieben.
Wir haben es also mit keiner Lite-raturoper zu tun, sondern mit der gemeinsamen Produktion, eines musikalischen und eines literarischen Autors. — Was aber ist das Thema der Handlung? Einige junge Leute, aus unterschiedlichen sozialen Schichten, machen sich auf, der Stadt — gemeint ist, der Tradition, der Zivilisation, dem Alltag —i zu entfliehen und begaben sich auf die Suche nach Neuland. Sie nähern sich einem Berg — gemeint ist, einem Midi, einem imaginären Ziel — und finlden ein völlig unverbildetes Naturwesen, mit dem zunächst eine Kccnmunikation nicht stattfinden kann. Die jungen Leute erteilen daraufhin dem Wesen Lektionen (Anleihen des Librettisten bei Bert Brecht!) und säe stopfen es voll mit dem Gedankengut, dem sie selbst entfliehen wollten —• Lektionen in Geld, Macht, Liebe, Glauben usw. Sehr schnell (allzu schnell) beherrscht der ominöse Mann das menschliche Vokabular, speichert die ihm erteilten Leihren, geht mit seinen Entdeckern in die Stadt zurück und begännt dort eine brutale Gewaltherrschaft auszuüben. Physische und psychische Zerstörung der Umwelt ist das Ergebnis. Am Ende bleibt die Hoffnung von einigen Unentwegten,, die sich erneut auf die Suche nach „hohen“ Zielen machen.
Das hört sich ganz plausibel an, steht aiber in krassem Gegensatz zu den Gesetzen der Bühne, denn hier schleppt sich eine nicht ins Dramatische 'Umsetzbare Gedankenfracht
drei Stunden lang quälend über die Bretter. Regisseur Götz Friedrich erzählt die Parabel, 'die er ein „modernes Mysterienspiel“ nannte, mit größtmöglicher Akribie. Immer wieder unternimmt er geradezu verzweifelte Versuche, die pathetische Zeigefinger-Pose zum Spiel hin aufzubrechen: in skurrilen Büdern schildert er Gleichnishaftes, läßt in Andreas Reinhardts steriler Plastikverpackung die Menschheitsgeschichte vom Sündenfall (mit Apfel!), über Liebesspiele bei elektronischem Vogelgezwitscher, bis zur Demonstration der Machtausübung auf dem Schachbrett und dem nimmersatten Finanzgebaren von Bankiers vorüberziehen, und zitiert auch noch Napoleon, König Ludwig II., Moses, Christus, den Papst und Lenin auf die Bühne. Götz Friedrich hat in den Darstellern Mitarbeiter gefunden, die alle ehrlich bemüht sind, ihr Bestes zu geben, allen voran Thomas Thomaschke, der den „Mann“ verkörpert Aber auch Catherine Gayer als „Frau“ oder Wolf gang Schöne dn der Rolle des „Johannes Kolumbus“ sollen eigens erwähnt sein, und sie mögen für die insgesamt 19 Sänger und Schaupdeler stehen, die alle den Einsatz für eine hoffnungslose Sache nicht gescheut haben
Man muß Josef Tal, dem Altmeister der zeitgenössischen Komponisten Israels, nicht bestätigen, daß er komponieren kann, aber was man bei diesem Opus völlig vermißt, ist die schöpferische Originalität. Das Instrumentarium, das Tai in seiner „Versuchung“ aufbietet, entspricht — die relativ kurzen Einspielungen elektronischer Musik ausgeklammert — einer normalen, großen Or-chesterbesetzung, mit zusätzlich sechs Schlaigzeuigspielern, Celesta, Harfe, Klavier, Cembalo, Saxophon und Gitarre. Die Musik ist in traditionellem Sinne notiert, und sie ist auch nicht belastet von der Sucht nach einem Modernismus um jeden Preis, aber dieser Paritur, die vom Choral bis zum Jazz-Sound so ziemlich alles enthält, was die letzten fünfzig Jahre an klanglicher Artikulation hervorgebracht halben, hat keinen eigenen Charakter. Selbst die rhythmischen Impulse, die das harmonische Einerlei bisweilen auflockern, zu schwach! Schade, denn auch im Musikalischen konnte diese Uraufführung — ebenso wie im Szenischen — von optimaler Voraussetzungen ausgehen: Gary Bertini — ein nerviger, energischer Dirigent der internationalen Spitzenklasse, in seiner Art stark an Salti erinnernd — führte die glänzend disponierten und mit größter Präzision musizierenden Münchner Philharmoniker sicher und zuverlässig durch lange Durststrecken, vorbei an einigen, wenigen musikalischen Oasen Wieder einmal — wie so oft im zeitgenössischen Musiktheater — hat die Interpretation das Werk selbst qualitativ überrundet.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!