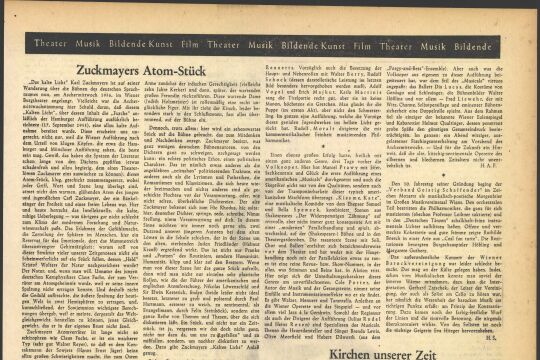Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ein Mozart-Ensemble triumphiert
Seit der Premiere im vergangenen Salzburger Festspielsommer ist Mozarts „Cosi fan tutte“, gewiß eine der im Gesamtkonzept vollendetsten Produktionen Karl Böhms mit seinem Lieblingsregisseur Günther Rennert (Ausstattung: Ita Maximow-na), ungeschlagenes Ereignis, in Spiel- und Gesangskultur, Witz, blankpolierten Pointen gleichrangig dem Erfolgs-„Figaro“ der beiden Künstler. Die überragende Klarheit und Disziplin dieser Inszenierung wirkte diesmal noch stärker, weil die Konturen sich verschärft haben: Was beim erstenmal noch Tändelei, starke Übertreibung, exaltierter Witz eines an Ideen überreichen Regisseurs schien, kehrte jetzt seine Bedeutung, seine kritische Originalität und Doppelbödigkeit hervor. Das Prinzip dieser „Cosi“ ist die Konsequenz der Darstellungsweise: Komik, die mit tiefstem Ernst vorgespielt wird, so daß sie in eine liebenswerte Groteske umschlägt. Verführerisch wirkt dabei die technische Präzision, mit der das Spiel abschnurrt, ohne etwas von seiner Intimität und Lebendigkeit einzubüßen, fulminant das Spiel mit Pointen und Requisiten, das stets die Leichtigkeit und Originalität des Zufalls hat.
Musikalisch setzt Karl Böhm gemeinsam mit den Wiener Philharmonikern dieses Konzept in ein Feuerwerk feiner Pointen um. Er trifft haargenau die Mozartsche Mischung aus Leidenschaft, Ironie, Freude am Spiel, an Satire und tieferer Bedeutung. Das Sängerensemble, das Mozart-Ensemble schlechthin, ist seit dem Vorjahr unverändert erhalten geblieben. Es ist im Gesamteindruck perfekt, kaum überbietbar. Kleine Mängel, etwa daß Brigitte Faßbaen-ders Dorabella ein wenig zu kühl, und Dietrich Fischer-Dieskaus Don Alfonso zu forciert wirken, scheinen gewichtslos. Vor allem, wenn man sich der makellos singenden Freunde Ferrando {Peter Schreier) und Gug-lielmo {Hermann Prey), der frech da-hinturtelnden Zofe Despina (Reri Grist) und der schwerblütig-innigen, im Timbre samtigen Fiordiligi (Gundula Janowitz) erinnert. Eine vielbejubelte, meisterhafte „Cosi“, die glücklicherweise auch im kommenden Jahr wieder zu sehen sein wird.
Nach sechs Jahren eines bemerkenswerten Publikumserfolges heißt es endgültig Abschied nehmen von Cavalieris „Rappresentatione di Ani-ma e di Corpo“. Sie ist zur geistlichen Paradepräsentätion dieser Festspiele in der Kollegienkirche geworden, der märchenhafte Prunk der Ausstattung Veniero Colasantis und John Moores genießt längst legendären Ruf. Und jetzt, da man dieses Totalkunstwerk Bernhard Baumgartners und Regisseur Herbert Grafs ein letztes Mal auf seine Qualitäten prüft, weiß man, daß nach der „Rappresentatione“ eine große Programmlücke zurückbleiben wird. Weil man der Rentabilität (und nicht zuletzt der Angst, damit einen zweiten „Jedermann“ heranzüchten!) diese Produktion geopfert hat. Erstaunlicherweise hat sich die Aufführung durch all die Jahre ungeminderte Frische bewahrt: Der Kampf der Engelsscharen und Seligen um die Aufnahme der guten Seele in den Himmel, das mystische Spiel der theologischen Begriffe, die Gestalt annehmen, um gegen Welt, weltliches Leben und Lust anzukämpfen, ist pralles Theater, großes Welttheater geblieben: Ein erschreckender Totentanz vor dem Prunkgrabmal, das Tor zu Unterwelt und Fegefeuer, zu den Schluchten der verdammten Seelen ist. Von szenischer Abnützung keine Spur. Dies freilich nicht zuletzt durch Ernst Märzendorfers straffe musikalische Organisation: die gewagten Chor- und Orchesteraufteilungen, noch von Herbert Graf souverän kalkuliert, die Einbeziehung von Emporen, Seitenkapellen, Nischen, garantieren ein akustisches Totalereignis, wie man es sonst bestenfalls aus Venedigs Markusdom kennt. Und die Ausführenden — Solistenscharen, Ballett, Chöre, Instrumentalisten — werden ungemein straff geführt. Hervorragend Suzanne Sarroca (Seele), Robert Kerns (Körper), Jose van Dam (Zeit und Welt).
Größter Publikumserfolg in der^ Reihe der großen Orchesterkonzerte war bisher Herbert von Karajans Abend. Seine Auseinandersetzung mit dem symphonischen Schaffen Bruckners ist nie im Zeichen naiver Gläubigkeit gestanden, sie war auch nie als Bekenntnis zur spätromantisch emotionellen Resignation oder gar zum Erbe barocker Traditionen zu verstehen, obwohl Karajan häufig einem von spätromantischer Gefühlswelt bestimmten Musizieren zuneigt. Seine Wiedergabe des d-Moll-Klavierkonzerts (Nr. 1, BWV 1052) von Bach, Einleitungsstück des Konzerts im Großen Festspielhaus, bewies das: aber zu sehr wirkte da das Linienspiel subjektiv verzerrt, zu sehr klang es nach privater Reflexion auf Bachs Werk — eine Haltung, die der Pianist Jean-Bernard Pommier mit seiner stilistisch heute untragbar gewordenen Interpretation noch unterstrich. — Um so eindrucksvoller aber dafür Karajans Wiedergabe von Bruckners „Siebenter“: Seine Beziehungen zu Bruckner resultieren vermutlich aus einer sehr kritischen Einstellung zu des Meisters spröden Formbildungsverfahren, zu seiner komplexen thematischen Arbeitsweise und der oft rauhen, abrupten Instrumentation. Man spürt da in Karajans Wiedergabe immer wieder den Reiz der musikalischen Widerstände: Gläubigkeit, Gefühl, Sinnlichkeit, Pathos sind fast ausgeschaltet. An ihre Stelle ist das Ausloten von Formen, ein Reflektieren auf kompositionstechnische Verfahren getreten. Karajan exerziert eine „werkskritisch moderne“ Wiedergabe vor. Dazu kam ein bestechend schönes Spiel der Wiener Philharmoniker, ein Spiel, das seine Faszinationskraft aus klaren Relationen, harten Kontrasten, aus dem natürlichen Fluß der Linien und Aufragen der Blöcke bezieht.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!