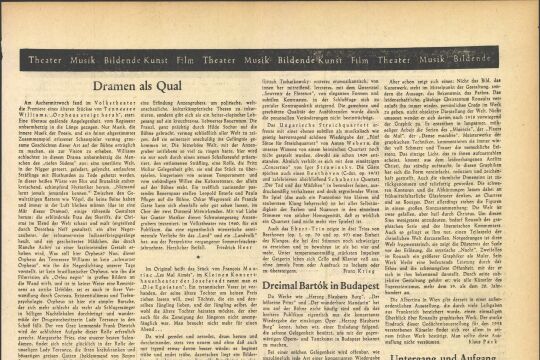Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Jubel für viel Geld
Üppig, wenngleich qualitativ und in der Programmierung bunt bis erschreckend gemischt bietet sich die Konzertreihe der zweiten Salzburger Festspielwoche dar: ein loses, nicht sonderlich „abgestimmtes“ Beieinander von großen Namen und bedeutenden Stücken, deren Zusammenstellung von Leitgedanken oder elitärer Festspielprofilierung, weiß Gott, nicht getrübt ist. Schon lange nicht hat die Kunst so herzhaft dem Kommerz die Hand gedrückt. Schon lange nicht haben Schallplattenfirmen so intensiv mitgemischt, die Legion reisender Finger-, Kehl- und Taktstockakrobaten zu lizitieren und den Durchschnittskonsumenten mit seinen wenig profilierten Wünschen „maßgerecht“ zu versorgen.
Üppig, wenngleich qualitativ und in der Programmierung bunt bis erschreckend gemischt bietet sich die Konzertreihe der zweiten Salzburger Festspielwoche dar: ein loses, nicht sonderlich „abgestimmtes“ Beieinander von großen Namen und bedeutenden Stücken, deren Zusammenstellung von Leitgedanken oder elitärer Festspielprofilierung, weiß Gott, nicht getrübt ist. Schon lange nicht hat die Kunst so herzhaft dem Kommerz die Hand gedrückt. Schon lange nicht haben Schallplattenfirmen so intensiv mitgemischt, die Legion reisender Finger-, Kehl- und Taktstockakrobaten zu lizitieren und den Durchschnittskonsumenten mit seinen wenig profilierten Wünschen „maßgerecht“ zu versorgen.
Emil Gilels etwa hatte ein exquisites Programm bereit, erkrankte jedoch und entschied sich dann in letzter Minute für ein klassisches Reiseprogramm, mit dem er auch gleich beim Carinthischen Sommer in Ossiach paradieren kann. Dennoch: sein Soloabend im Salzburger Mozarteum war wie stets eine musikalische Gratwanderung eines fabelhaften Technikers. Auch wenn Tempi und dynamische Angaben manchmal überzeichnet werden (etwa in Beethovens Waldstein- Sonate, op. 58, und in op. 101). Gilels spielt gewollt riskant. Artistische Parforceritte machen ihm Spaß. Auf Wellen kühner Steigerungen läßt er sich forttragen… Aber all diese Eigenwilligkeiten sind von so hoher Musikalität geprägt, Proportionen, große Bögen, Details, Farben stimmen zueinander, daß gar keine Zweifel aufkommen. Und Mozarts Variationen über „Tu Salve Domine“ (KV 398), die d-Moll-Fantasie (KV 397) und die a-Moll-Sonate (KV 310) formt er sehr besinnlich, zurückhaltend, mit schlankem Anschlag. Man müßte seine Wiedergaben Phrase für Phrase, Einzelheit um Einzelheit analysieren, um das unerhörte Raffinement seines Spiels zu erkennen. Etwa wie er Haltepunkte und Pausen ausschwingen läßt, Verzierungen anbringt, Figurationen auffächert.
Claudio Abbado dirigierte die Tschechische Philharmonie Prag. Immerhin ein Programm für Kenner: Mit den Komplikationen in Leoš Janačeks fünfsätziger Sinfo- nietta (1926) schlugen sich die Prager Gäste noch recht geschickt, vor allem mit dem skurrilen Blechbläsersatz, obgleich da und dort, zum Beispiel in der Intrada, Unstimmigkeiten im Orchesterbild auftraten. Daß dieses Orchester allerdings seit dem Abgang Karel Ancerls an Qualität viel verloren hat, daß es unter Vaclav Neumann geradezu „verfallen“ ist, bewies erst das Konzert unter Karl Böhm…
Alexander Skrjabins „Poeme de l’extase“, musikalisches Abbild von des Komponisten „träumerischer Sehnsucht nach der Erlösung und der Befreiung durch die schöpferische Tat“, hat in der Musikgeschichte seinen festen Platz. Die Wiedergabe unter Abbado bannte die schweifenden musikalischen Gedanken, die scheinbar lose aneinandergereiht sind, zu einer monumentalen Satzeinheit: Abbado weiß die Tschechen aus der Reserve zu locken, Streicher und Bläser bis ins Hymnische zu steigern. Das Orchester rauscht mächtig auf, schwillt, ohne freilich durch die trockene Akustik wirklich massive Dichte und Üppigkeit anzunehmen, die dem Stück entspricht. Zu hoffen wäre es, daß Skrjabin in Hinkunft in Salzburg seinen Platz bekäme. Die Gelegenheit: 1972 ist ein Skrjabin-Jahr — sein 100. Geburtstag. „Poéme Divine“ und vor allem die „Prometheus“-Symphonie sollte man sich vormerken.
Vor der Pause spielte Martha Argerich Beethovens erstes Klavierkonzert (op. 15): ein Automat, ohne Wärme, persönlichen Ausdruck. Mutwillige Agogik und falsche Pedali- sierung störten. Gleich einer Maschine ratterte sie den ersten und dritten Satz vor, das Largo wirkte ausgeglichener.
Nicolai Geddąs Liedwiedergaben werden von Jahr zu Jahr gekünstelter: Da ist zwar alles drin an kostbarem Timbre, an Raffinement, Dis kretion. Aber es ist seine Manier geworden, im kühlsten Pianissimo mit Arabesken zu spielen. Ob er — wie im Mozarteum — Schuberts „Italienische Canzonen“, seine schlichten Lieder oder Richard Strauss’ pralle Poesie singt, Verfeinerung wird da wie dort bis an die Grenzen getrieben. In Strauss’ „Allerseelen“ etwa klingt schon alles fast verweht, unirdisch, in der „Nacht“ wird das Verlöschen „aller Lichter dieser Welt“ zum fahlen Verdämmern tenoraler Kraft. Das geschmeidige Material scheint zu verfallen, weil Gedanken dafür zu schwer sind. Seine stimmlichen Möglichkeiten demonstrierte Gedda nur sehr gelegentlich: im „Pokal“ blitzen plötzlich Mittellage und Höhe in großen Bögen auf. Da ist mit einemmal ein Tenor, der singt, und nicht nur die Ahnung, daß hinter all dem bis auf den Nullpunkt zurückgenommenen Material, hinter manierierter lyrischer Artistik sogar eine schöne Stimme steckt. — Erik Werba begleitete: sehr inspiriert, mit schönem rundem Anschlag, ein Poet, der sein Handwerk liebt.
Christian Ferras, seit 1952 einer der prominentesten Geiger ist allmählich zu einem Routinier geworden, der seine Wiedergaben selbstgefällig inszeniert, nur noch nach äußeren Effekten untersucht und auslotet. Seine Wiedergabe von Bachs 3. Solosonate, C-Dur, zeigte, wie selbstgefällig er die Stimmenverschlingungen mutwillig dynamisiert, wie er polyphone Abläufe verzeichnet. Ferras überzeugt nur noch dort, wo er seinem romantischen Gefühlszeremoniell freien Lauf lassen kann: also in Debussys Sonate, deren kunstvoll ausgespielte Schlichtheit er mit schimmerndem Ton belebt, in Ravels „Habanera“ und „Tzigane“, artistischer Geigenkonfektion für rasende Techniker, oder in Fritz Kreislers virtuosen Belanglosigkeiten über ein Thema von Beethoven. Zu Beethoven selbst sind seine Beziehungen hingegen eher von allgemeiner Durchschnittlichkeit und daher recht indifferent: er spielt die F-Dur-Sonate (op. 24) liebenswürdig, mit fröhlicher Gelassenheit. Jean Claude-Ambrosini bestätigte sich als dezenter Begleiter.
Das erste Konzert der Tschechischen Philharmonie Prag unter Vaclav Neumann im Großen Festspielhaus war im Grunde eine Mordsblamage: Schuld daran war wieder einmal vor allem die Elektronenorgel des Hauses, ein unbewegliches, in massiveren Registern plärrendes, sonst tonloses Monstrum, dessen Kontaktknacken und -knistern und Nachhallen so ziemlich in alle Sätze der Missa Glagolskaja hineinplatzte.
Fragen muß man sich nur, ob die Salzburger Festspielorganisatoren überhaupt wissen, welches Instrumentarium ein Werk verlangt, wenn sie es aufs Programm setzen? Offenbar nicht, denn sonst hätte ihnen bei der Planung dieser Aufführung der Janddek-Messe allein beim Gedanken an die Orgel das Entsetzen kommen müssen.
Freilich, das Konzert war auch sonst kein Musterbeispiel an Präzision, Klangschönheit, Konzentration. Die Tschechen sind natürlich ein hervorragendes Orchester und Vaclav Neumann, ihr neuer Chef, ein Grandséigneur des Taktstocks, aber zusammen sind sie doch weit entfernt von dem, was dieses Orchester früher war. Dvořáks „Achte“ in einer dürren, faden, in den Forte-Passagen derb auftrumpfenden Wiedergabe wies das nach. Janačeks eigenwillige Instrumentationseffekte blieben auf der Strecke. Am besten der Chor der Philharmonie.
Der ganzen Aufführung „würdig" erwies sich das Solistenquartett: Nadezda’ Kniplovas noch immer sehr voluminöser Sopran klingt ausgeschrien, Vera Soukupovas Alt trägt zuwenig, Eduard Hakens Baß ist dumpf timbriert, nuancenarm, am überzeugendsten noch Vilem Pri- byls Tenor.
Das Publikum tobte allabendlich vor Begeisterung. So schlecht und uninteressant konnte ein Konzert gar nicht sein, daß sich auch nur ein Zuhörer empört hätte. Man wird den Verdacht nicht los, daß sich in Salzburg manche für ihr gutes Geld einfach nur noch ausjubeln wollen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!