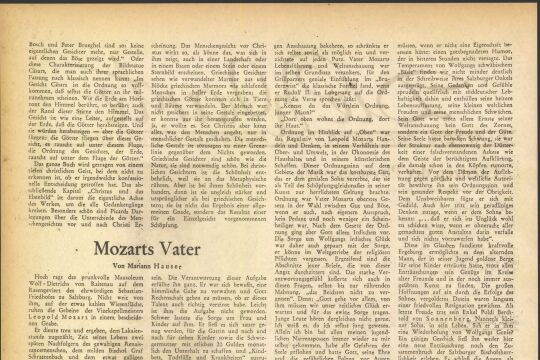Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Unbedingter Qualitätsanspruch
Er gibt keine Interviews, beantwortet keine Fragen, läßt sich nicht aushorchen, will in Ruhe gelassen werden. Ein Standpunkt, der rerespektiert werden soll. Allerdings muß er sich dann auch gefallen lassen, daß man sich ohne persönlichen Kontakt ein Bild von ihm macht, daß man ihn weniger zu porträtieren als vielmehr zu interpretieren versucht: Carlos Kleiber, genialer Sohn eines bedeutenden Vaters, zum erstenmal am Dirigentenpult der Wiener Staatsoper mit Wagners „Tristan“ und 10 Tage später ein zweites Mal mit dem „Rosenkavalier“.
Vater Erich, Sohn eines Wiener Gymnasialprofessors von patriarchalischem Zuschnitt, der ihm nicht nur die Musikalität, sondern auch die autoritative Begabung vererbte, hatte seinen Aufstieg über die Stationen der „normalen“ Kapellmeisterlaufbahn genommen: Studium in Wien, dann Darmstadt, Elberfeld, Düsseldorf und 1923, mit 33 Jahren, GMD an der Berliner Staatsoper.
Anders der Sohn. 1930 in Berlin geboren, mußte er während der langen Wanderjahre der Eltern nach 1933 viel Zeit in Internaten zubringen und litt recht sehr darunter. Seine musikalische Begabung zeigte
sich früh, er begann auch in Buenos Aires, wo der Vater am Teatro Colon wirkte, bereits mit dem Musikstudium, doch der Vater wollte die Zukunft des Sohnes durch einen „soliden“ Beruf gesichert sehen. Carlos beugte sich zwar der väterlichen Autorität und begann sich an der Technischen Hochschule in Zürich mit Chemie zu beschäftigen, doch er resignierte nicht. Nach kurzer Zeit schon setzte er durch, die Stelle eines Korrepetitors am Münchner Gärtnerplatztheater annehmen zu dürfen und gab als solcher auch ein kurzes Gastspiel an der Wiener Volksoper, an welches altgediente Kammersänger sich heute noch mit leisem Schauder, aber auch mit Bewunderung erinnern, weil er sie mit seinem unerbittlichen Präzisionswillen manchmal zur Verzweiflung gebracht hatte.
1954, endlich, durfte der Sohn vor dem gestrengsten aller Kritiker ein Probestück ablegen: im Potsdamer Theater in Berlin dirigierte er eine Operette und erhielt das väterliche Placet zur Dirigentenlaufbahn. 1956, im Todesjahr des Vaters, ging Carlos Kleiber nach Düsseldorf, es folgten Zürich, Stuttgart, München.
Künstler, die noch mit Erich Kleiber gearbeitet haben, erinnern sich
an ihn als einen absoluten Herrscher im Orchestergraben (eine Despotie allerdings, die der Lieblosigkeit nicht fähig war), einen Mann unbedingter Werktreue, der den Intellekt vor das Gefühl zu setzen pflegte, einen glänzenden Probierer und kühlen Sarkastiker, dem es aber nicht gegeben war, in einer Auffüh-
rung den berühmten Funken zu zünden. Erich Kleibers Aufführungen waren hervorragend, aber niemals sensationell. Die des Sohnes sind es. Schon äußerlich dem Vater unähn-
lich (Erich Kleiber war untersetzt, trug auf breiten Schultern einen massigen, kahlen Kopf — der Sohn ist groß, überschlank, ganz sensibler Nervenmensch), hat er auch als Dirigent eine Dimension mehr, die ans Dämonische streift, versteht er es, das mit äußerster Konzentration und Präzision erarbeitete Werk ekstatisch zu durchglühen und den Hörer in jenen Zustand zu versetzen, den man mit „Faszination“ zu umschreiben pflegt.
Das Besondere daran ist jedoch, daß diese Faszination keineswegs von der Person Carlos Kleibers ausgeht, sondern einzig der von ihm interpretierten Musik entströmt. Pultpantomime, Zurschaustellung, Äußerlichkeiten sind ihm verhaßt, genauso wie jegliche Art von Publicity (deswegen auch keine Interviews). Es geht ihm einzig um das Werk, das er zu interpretieren hat, mit dem er in oft überlanger Vorbereitungszeit ringt, das ihn in Skrupel und Gewissensängste stürzt, so lange, bis er glaubt oder auch nur hofft, „ins reine gekommen“ zu sein.
Hier liegt die Wurzel seines Rufes, ein „Schwieriger“ zu sein. Er resultiert aus seiner absoluten Kompro-mißlosigkeit in künstlerischen Dingen, seiner Kampfbereitschaft gegenüber jeglicher Schlamperei, seiner Forderung nach höchster Konzentration aller Beteiligten auf die gemeinsame Arbeit. Damit hat er sich und anderen schon oft genug
das (Proben-)Leben zur Hölle gemacht, doch das Ergebnis sprach immer für ihn. Ob „Tristan“ oder „Carmen“ in Stuttgart, „Wozzeck“, „Othello“ oder „Rosenkavalier“ in München, alle Aufführungen, die seinen Stempel, sein Gütezeichen trugen, erhoben sich turmhoch über den Opernalltag.
Diese Einstellung zur künstlerischen Arbeit hat ihn bisher auch, keine feste „Stellung“ annehmen lassen, die ihn unweigerlich auch mit alltäglichen Routinefragen und Problemen belasten würde, die er haßt, und sie hält ihn ebenso davon ab, dem „Zuviel“ zu verfallen, wie so viele seiner Kollegen, die von einer Produktion zur anderen rasen und in der ewigen Hetze um den Erdball ihr künstlerisches Verantwortungsgefühl längst eingebüßt haben.
Für Carlos Kleiber würde dies die Selbstaufgabe bedeuten. Er läßt sich in seiner „Schwierigkeit“, die man vielleicht treffender Besessenheit nennen sollte, nicht beirren, in seinem unbedingten Qualitätsanspruch nicht erschüttern. Die Begeisterungsstürme, die seine Aufführungen entfesseln, mögen ihm weniger Lohn sein (den er sicher gar nicht sucht) als Bestätigung, den rechten Weg eingeschlagen zu haben, der zwar für alle Beteiligten ein mühsamer ist, aber doch jenem einzigen erstrebenswerten Ziel zuführt: der vollendeten künstlerischen Leistung.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!