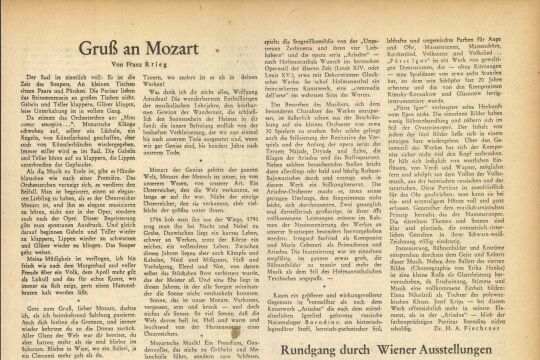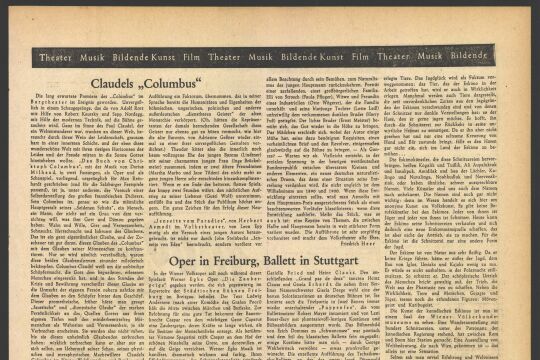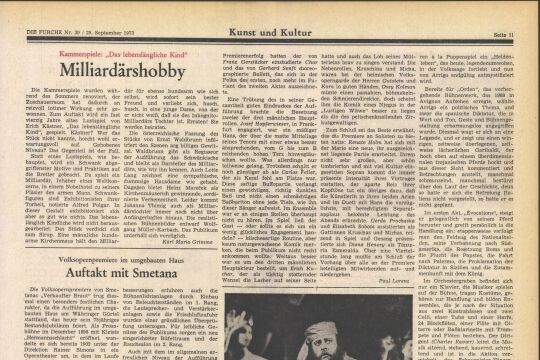Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Aischylos und der zweite Weltkrieg
Im Grazer Schauspielhaus wurde kürzlich ein Werk des aus Köln stammenden und in Salzburg lebenden Mattias Braun gezeigt. Es nennt sich „Die Perser“ und stellt eine sehr freie Neugestaltung des aischy- leischen Triumphspiels auf die Schlacht bei Salamis dar. Aischylos hatte bekanntlich in den „Persern“ die Wirkung des griechischen Sieges auf die Feinde dargestellt und das Stück in einer großen Wehklage des von der Hybris getriebenen Xerxes enden lassen. Mattias Braun (Jahrgang 1933) war eine gewisse Parallelität der Berliner Situation im Jahre 1945 mit jener der bei Salamis geschlagenen Perser aufgefallen. Ähnlichkeiten sind ja auch tatsächlich vorhanden; um aber eine wirkliche Deckung der beiden Ereignisse zu erreichen, mußte Braun die Vorlage gründlich umarbeiten, denn er wollte offensichtlich eine glatte Formel und eine leicht durchschaubare Verschlüsselung. Er änderte nicht nur den Charakter einiger Personen, sondern auch die Tendenz des Originals, führte neue Figuren ein, erfand einen anderen Schluß und wendete sich in einem Epilog an kommende Generationen. Mit den Aktualisierungen antiker Stoffe, wie wir sie von modernen Autoren kennen, hat das nichts zu tun. Braun möchte sichtlich den Aischylos beibehalten, sieht aber keinen anderen Ausweg, als ihn in sein Korsett zu zwängen.
Mit Hilfe einer leicht lesbaren Verschlüsselung sollen also die Perser dazu beitragen, die unbewäitigte Vergangenheit der Deutschen zu bewältigen. Ein Volk von Kriegern und Eroberern stellt hier eine Art Gewissenserforschung an. Das Ergebnis ist: das ganze Volk trägt Schuld, da es sich seinen „Führer“ Xerxes eigens zum Siegen aufgezogen hat.
Der Text dieser Neudichtung klingt nicht einmal so übel. Untersucht man ihn aber genauer, so finden sich eigenwillige, packende Formulierungen neben blassen, abgegriffenen Wendungen, fade Klischees und knorriges Landserdeutsch neben gesucht archaischen Fügungen. Die Grazer Aufführung unter Rolf Hasselbrink war auf ordentliche, klare Übersichtlichkeit bedacht; der Eindruck, den das Werk auf den Beschauer machte, blieb jedenfalls in künstlerischer Hinsicht zwiespältig. Das großartig suggestive Öühnenhild’ stammte von Wolfram Skalicki.
Nach langen Jahren der Dürre gab es dm Grazer Opernhaus wieder einen Ballettabend von beachtlichem Niveau, der Fred Marteny als Choreographen und Bailetterzieher ein hervorragendes Zeugnis ausstellte.
Nach einem hübschen ornamentalen Beginn mit Glasunows „Jahreszeiten“ folgte als bedeutendster Teil des Abends die österreichische Erstaufführung des Balletts „Der Golem“ des in Wien lebenden Engländers Francis Burt, eines Schülers von Boris Blacher. Das Libretto stammt von Erika Hanlca und bringt eine freie Bearbeitung der alten jüdischen Legende von der zum Leben erweckten Lehmfigur, der das heilige Zeichen des „Sehern“ unüberwindliche Kraft verleiht. Burts Musik stellt eine faszinierende Basis für ein packendes Handlungsballett dar. Losgelöst von bestimmten „modernen“ Systemen, wirkt sie in ihrer Konzentriertheit, ihrer starken Expression und ihren rhythmischen Impulsen geradezu als Idealfall einer Ballettpartitur. Neben diesem Werk fiel Marcel Delannoys „Phantastische Hochzeit“ mit ihrer leichtgewichtigen Musik ein wenig ab. Um der einfallsreichen, geschmackvollen Choreographie Fred Martenys und der phantastischen, sur- realen Dekorationen Skalickis willen nahm man dies kleine Manko jedoch gerne hin.
Das große Ereignis der Saison aber kam von außen, etwas unerwartet und mit hohen Preisen. Die Folge: das Opernhaus war nicht bis auf den letzten Platz gefüllt, wie es dem Rang des musiktheatralischen Ereignisses gebührt hätte. Andre Diehls gefällige Inszenierung der „Ariadne auf Naxos“ — vor zwei Jahren die Attraktion der Schau- spielhauiseröffnung — war für einen Abend ins Opernhaus verlegt worden. Das war der ganzen Aufführung nicht sonderlich gut bekommen, obwohl der musikalische Anteil von Berislav Klobucar aufs sorgfältigste betreut wurde. Dennoch konnte sich neben manch ansprechender hauseigener Sängerleistung und trotz eines unzulänglichen Bacchus das erwähnte Ereignis aufs prächtigste entfalten: Reri Grist sang nämlich die Zerbinetta und Hildegard Hillebrecht die Ariadne. Reri Grist, heute wohl die beste Zerbinetta, gelingt die vollkommene Deckung mit ihrer Rolle: darstellerisch hin reißend in ihrem graziösen Charme und als Sängerin bezwingend im mühelosen Gebrauch einer technisch perfekten Stimme vpll schönsten Wohllauts. Angenehm auch die Begegnung mit Frau Hillebrecht, einer imponierenden Ariadne mit schönem, aber etwas gleichförmigem Stimmtimbre. Salzburger Festspielglanz als Aufputz der Grazer Saison: das Publikum jubelte wie seit vielen Jahren nicht mehr in diesem Haus.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!