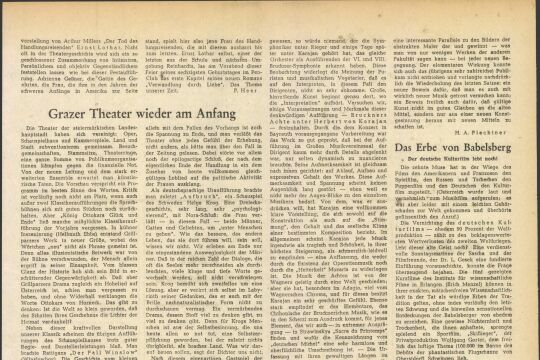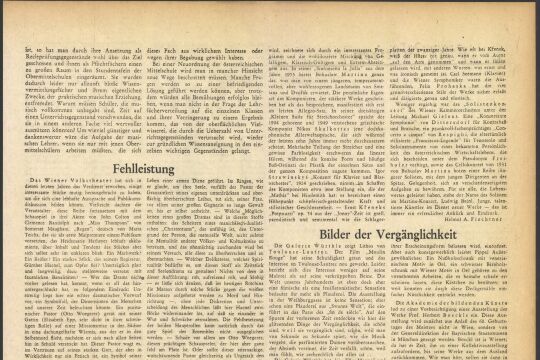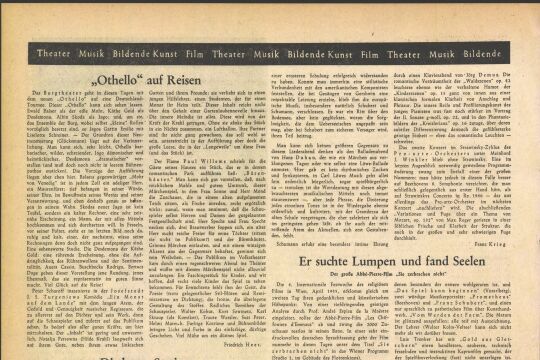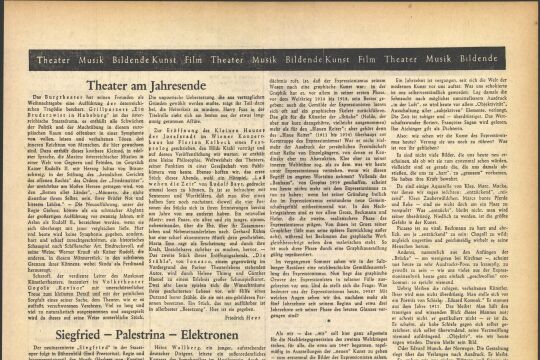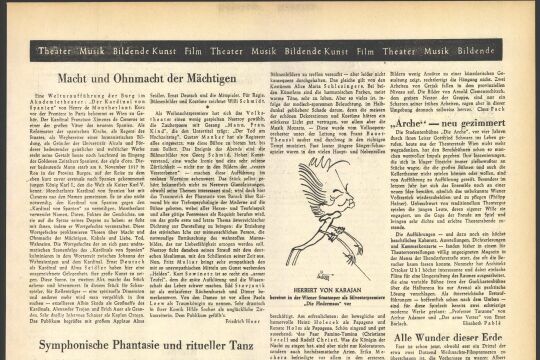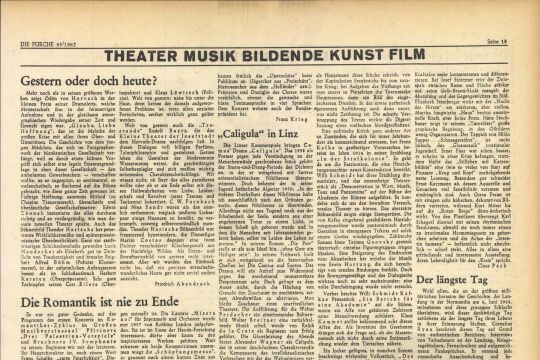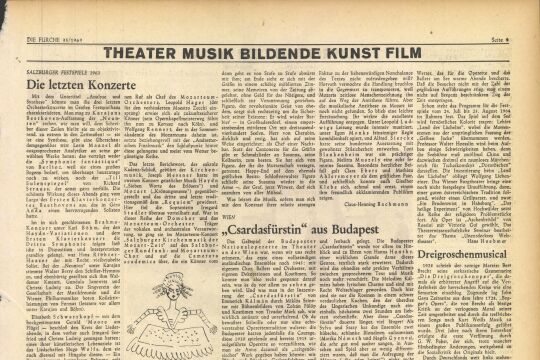Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Musikalische Kommentare
Die Wiener Komponisten können sich nicht beklagen, daß sie nicht zu Wort kommen. Wenigstens jene nicht, die darauf verzichten, das Publikum zu schrecken, deren Aufführung für“ die Veranstalter kein Risiko bedeutet, da ihre Werke „antik“, klassisch oder romantisch stilisiert sind, kurz: jene, die „in modo commodo“ schreiben. In unserem letzten Musikreferat berichteten wir über zwei Aufführungen dieser Art. Nun kam Hans Knappertsbusch und machte uns im 5. Abonnement-Konzert der Philharmoniker mit dem Violinkonzert von Franz Salmhof e r bekannt. — Der Autor wurde in einem Radiogespräch als der Komponist Wiens vorgestellt und hat sich selbst als den dritten komponierenden Wiener Operndirektor bezeichnet |(Mahler war der erste, Richard Strauß der zweite). Von seinem Kommentator wurde Salmhofer der ,,meistaufgeführteste und mcistgeliebteste“ (sie!) Wiener Komponist genannt. Und der Solist, der zum erstenmal den Solopart exekutierte (Willi Boskovsky), bezeichnete das Konzert als eines der schönsten Stücke, die er gespielt hat; es enthalte breite lyrische Stellen, liege hoch (meist auf der E-Saite) und biete alles, was sich ein Solist nur von einem Violinkonzert wünschen könne, zum Beispiel gleich zwei Kadenzen im ersten Satz. — Wird der Leser unter diesen Umständen dem an dieser Stelle amtierenden Musikreferenten gestatten, mit seinem eigenen Urteil bescheiden zurückzutreten? Auch soll man Familienfeste. nicht durch Kritik stören. — Das „Siegfried-Idyll“ und Schumanns Vierte gehören zu den Spezialitäten von Hans Knappertsbusch und gelangen am Sonntag-yormittag besonders schön.
Im Rot-Weiß-Rot-Konzert unter Ch. F. Adler hörten wir, wahrscheinlich als österreichische Erstaufführung, die II. Symphonie von Charles I v e s, der nach A. Copland (in seinem Buch „Musik von heute“) „weit originaler begabt war, als jeder andere seiner Generation“. Noch vor Bartök, Strawinsky und Milhaud habe Ives poly-tonal geschrieben und die verwegensten Dinge getrieben. Deshalb werde er so wenig aufgeführt und sei so gut wie unbekannt. Diesem Kommentar haben wir immer schon mißtraut. Die II. Symphonie, im Stil eine Mischung von Jensen und Dvofak, farblos und unoriginell, mit gefälligem folkloristischem und synkopischem Aufputz, hat unsere böse Ahnung leider bestätigt. Wir stimmen daher eher dem Urteil Elliot Carters zu, daß Ives Werk seinen Absichten nicht voll gerecht wird. Denn wenn wahr wäre, daß Ives Geschichte die des Genies in der Wüste ist, wie Copland schreibt, — wie muß da erst die Wüste aussehen!
Erst vor einer Woche haben wir das Loblied der Philharmoniker gesungen. Eigentlich müßte jetzt die zweite Strophe folgen. Und zwar anläßlich eines Konzerts, bei dem sie gar nicht mitgewirkt haben. Als nämlich das tüchtige und ambitionierte T onkünstlerorchester unter Volkmar A n-d r c a e die VIII. S y m-pho^ie von Bruckner spielte: da bemerkten wir, wie ungeheuer schwierig in dieser Partitur manches zum Klingen zu bringen ist und welche Rolle alle jene agogischen und klanglichen Differenzierungen spielen, die wir bei den Philharmonikern gewissermaßen als Selbstverständlichkeiten hinnehmen.
Das letzte Konzert des Barockzyklus unter Fritz Lehmann war sehr interessant und hatte fast didaktischen Charakter. Dem Concerto grosso in h-moll für vier Soloviolinen von Antonio Vivaldi wurde Bachs Bearbeitung des gleichen Werkes (Concerto in a-moll) für vier Cembali und Streichorchester gegenübergestellt. Der Effekt mag für Ausführende und Hörer gleicherweise überraschend gewesen sein: Vivaldi fiel nicht nur nicht ab, sondern erwies sich als der klanglich wirkungsvollere, plastischer Erfaßbare. Die Feinheiten im leise rauschenden Zusammenspiel der Cembali, die geistvoll-klare Interpretation des 3. Brandenburgischen Konzerts von Bach und die Klangpracht der zwei Concerti von Händel: das ergab einen historisch-festlichen Abend mit großer Musik.
Maestro Z e c c h i, der feine Lyriker und Miniaturist, konnte die gewaltige Mondlandschaft der „Symphonie fantastique“ von Hector Berlioz nicht beseelen und erwärmen. Denn in dieser Partitur steht alles vollkommen deutlich und ohne Ausdruck da. —• Sehr fein und poetisch, mit etwas zu wenig Brillanz, spielte Jörg Demus die Symphonischen Variationen seines Lieblingskomponisten Cesar Franc k. — Jede gute Aufführung von „Romeo und Julia“ rückt das Genie von T s c ha i k o w s k y in das hellste Licht, wo es — so möchte man meinen —■ auch der Farbenblinde erkannt haben sollte. Was der unfehlbare Hanslick nach der Wiener Erstaufführung am 28. November 1876 durch die Philharmoniker unter Hans Richter darüber schrieb, mögen seine Nachbeter und Nachtreter in dem neuen Tschaikowsky-Buch von Franz Zagiba auf Seite 137 nachlesen. Aber Hanslick hatte wenigstens noch seinen Brahms. Unsere Hanslicks dagegen haben — siehe oben! Das ist der Unterschied.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!