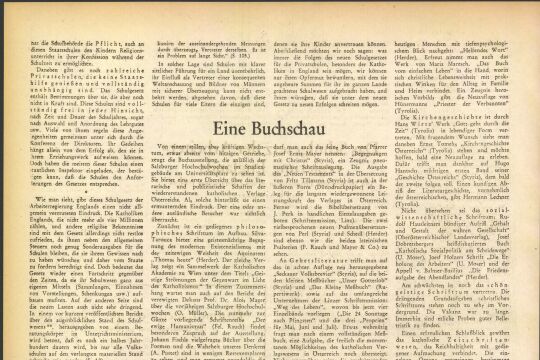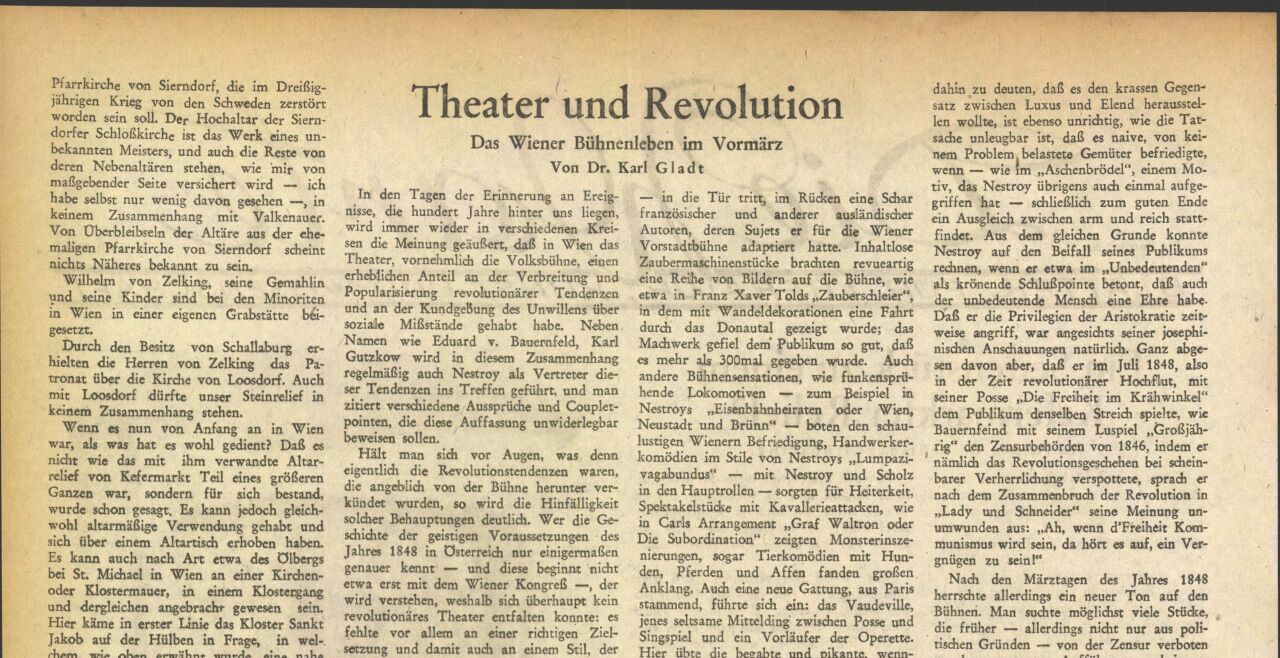
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Theater und Revolution
In den Tagen der Erinnerung an Ereignisse, die hundert Jahre hinter uns liegen, wird immer wieder in verschiedenen Kreisen die Meinung geäußert, daß in Wien das Theater, vornehmlich die Volksbühne, einen erheblichen Anteil an der Verbreitung und Popularisierung revolutionärer Tendenzen und an der Kundgebung des Unwillens über soziaile Mißstände gehabt habe. Neben Namen wie Eduard v. Bauemfeld, Karl Gutzkow wird in diesem Zusammenhang regelmäßig auch Nestroy als Vertreter dieser Tendenzen ins Treffen geführt, und man zitiert verschiedene Aussprüche und Coupletpointen, die diese Auffassung unwiderlegbar beweisen sollen.
Hält man sich vor Augen, was denn eigentlich die Revolutionstendenzen waren, die angeblich von der Bühne herunter verkündet wurden, so wird die Hinfälligkeit solcher Behauptungen deutlich. Wer die Geschichte der geistigen Voraussetzungen des Jahres 1848 in Österreich nur einigermaßen genauer kennt — und diese beginnt nicht etwa erst mit dem Wiener Kongreß —, der wird verstehen, weshalb sich überhaupt kein revolutionäres Theater entfalten konnte: es fehlte vor allem an einer richtigen Zielsetzung und damit auch an einem Stil, der hiezu nicht allein in der dramatischen Dichtung notwendig gewesen wäre.
Eduard v. Bauernfeld zum Beispiel hatte sich zwar eine Ausdrucksart zurechtgelegt, deren sdieinbare Harmlosigkeit bei entsprechender Betonung und Unterstreichung durch die Geste eine bedeutungsvolle Wandlung erfuhr, und es war ihm meisterhaft gelungen, das scharfe Auge der Zensur so zu täuschen, das fürs erste die verfängliche Tendenz gar ‘nicht zum Vorschein kam. So brachte er mit seinem Lustspiel „Großjährig“ ein Stüde durch alle zensierenden Stellen bis auf die Bretter des Burgtheaters, das sich als Kritik am Kaiser, an seinem unbeliebten Regierungschef und am Beamtensystem erwies. Milieu und Sprache waren jedoch durchaus nicht revolutionär.
Die Literaten, die sich in offiziösen und inoffiziösen Zirkeln zusammenschlossen, ertrugen es schwer, daß verschiedene Grundsätze rein ideeller Natur, die vor einem halben Jahrhundert ungeahndet in die Literatur eingegangen waren, nun einer staatlichen Bevormundung unterworfen wurden, und daß damit der Erreichung eines Erziehungszieles, das auf die Zeit Josephs II. zurückging, durch eine Staatsraison Einhaltung geboten wurde, deren Machtmittel auf derselben Auffassungsgrundlage basierten. In dem ( Paradelustspiel „revolutionärer Dramatik“,
. dem obenerwähnten Lustspiel Bauernfelds, läßt der Dichter sogar einen Vertreter des parodierten Staatssystems bekennen: „Als junger Mensch sprach ich frei — jetzt begnüg’ ich mich, frei zu denken.“ Die Geisteshaltung des Josephinismus war die Basis aller liberaler Strömungen, ihre Träger hatten jedoch darauf vergessen, daß der josephini- sche Staat dem Wohlfahrtsgedanken einen besonderen Platz eingeräumt hatte und starke Ansätze zu sozialen Reformen zeigte. Sebastian Brunner hat in seiner Selbstbiographie „Woher, wohin“ diesen Mangel an sozialem Denken an den Neujosephinern scharf kritisiert. Das ,„Odi profanum vul- gus et arceo“ der josephinisch-liberalen Oberschicht ließ demnach eine sozialistische Zielsetzung gar nicht zu, weder auf der Bühne, noch sonstwo. Außerdem war die Einstellung des intellektuellen Bürgertums, das als Führerschaft der liberalen Bewegung immer wieder genannt wird, durchaus dynastisch, wie schon Grillparzers Haltung beweist. Man verabscheute alles, was auf eine Zerstörung der Staatsform, auf eine Zertrümmerung der Monarchie abzielte. „Die Anarchie stand mir klar und deutlich vor Augen — meiner Empfindung nach das scheußlichste Ungeheuer, das sich denken läßt“, i sdireibt Bauernfeld, nachdem er am
15. März 1848 das revolutionäre Treiben am Michaelerplatz beobachtet hatte.
Aber auch die Volksbühne war an sich frei von allen Elementen eines „revolutionären Theaters“. Ein Bild des Aquarellisten und Zeichners Schoeller aus dem Jahre 1840 zeigt in satirischer Weise die „Lokalposse“, die. im Sterben liegend, vom „Arzte“ Saphir mit Medikamenten wie „Postbüchl- Reminiszenz“ und „alten Anekdoten“ versorgt wird, während einerseits das Vörstadt- publikum der alten, überlebten Spielgattung endgültig den Rest geben will, andererseits Nestroy als satanischer Bertram — eine Gestalt aus seiner Parodie „Robert, der Teuxel“
— in die Tür tritt, im Rücken eine Schar französischer und anderer ausländischer Autoren, deren Sujets er für die Wiener Vorstadtbühne adaptiert hatte. Inhaltlose Zaubermaschinenstücke brachten revueartig eine Reihe von Bildern auf die Bühne, wie etwa in Franz Xaver Tolds „Zauberschleier“, in dem mit Wandeldekorationen eine Fahrt durch das Donautal gezeigt wurde; das Machwerk gefiel dem Publikum so gut, daß es mehr als 300mal gegeben wurde. Auch andere Bühnensensationen, wie funkensprühende Lokomotiven — zum Beispiel in Nestroys „Eisenbahnheiraten oder Wien, Neustadt und Brünn“ — boten den schaulustigen Wienern Befriedigung, Handwerkerkomödien im Stile von Nestroys „Lumpazivagabundus“ — mit Nestroy und Scholz in den Hauptrollen — sorgten für Heiterkeit, Spektakelstücke mit Kavallerieattacken, wie in Carls Arrangement „Graf Waltron oder Die Subordination“ zeigten Monsterinszenierungen, sogar Tierkomödien mit Hunden, Pferden und Affen fanden großen Anklang. Auch eine neue Gattung, aus Paris stammend, führte sich ein: das Vaudeville, jenes seltsame Mittelding zwischen Posse und Singspiel und ein Vorläufer der Operette. Hier übte die begabte und pikante, wenngleich nicht immer dezente Ida Schuselka- Brüning auf den Bühnen Direktor Carls eine ebenso starke Anziehungskraft aus wie Jenny Lind oder Fanny Elßler am Kärntnerthor- Theater. Mit einem Wort: man suchte durch Äußerlichkeiten zu ersetzen, was der Zeit an Innerlichkeit verlorengegangen war. „Tendenziös“ waren diese Erzeugnisse natürlich in keiner Weise, nicht einmal leise gesellschaftskritisch. Sie boten Unterhaltung, so wie die zwischendurch auch in den Vorstadttheatern gepflegte Oper musikalischen Genuß bot, und sie wollten auch gar nichts anderes bieten.
Bleibt für diese Betrachtung somit nur mehr das Lokalstück Nestroys, dem jedoch ebenfalls zu viel revolutionäre Tendenz zugesprochen wird. Wohl fand der Satiriker zahllose Anhaltspunkte für gesellschaftskritische Betrachtungen und führte einen zähen Kampf mit der Zensur, die seinem Darstellertalent mit seiner ausgeprägten Drastik bisweilen eine zu enge Schranke setzen wollte. Aber eine planmäßige Tendenz verfolgte der Josephiner Nestroy ebensowenig wie die übrigen zeitgenössischen Bühnendichter. Er war, nach einem Wort aus dem „Mädl aus der Vorstadt“, „nach einigen Desperationsparoxysmen in eine ruhige Sarkasmuslanguisance“ verfallen, wo man „über alles räsoniert und andererseits wieder alles akzeptabel find’t". Das Lokalstück „Zu ebener Erde und im ersten Stock“
dahin zu deuten, daß es den krassen Gegensatz zwischen Luxus und Elend herausstel- len wollte, ist ebenso unrichtig, wie die Tatsache unleugbar ist, daß es naive, von keinem Problem belastete Gemüter befriedigte, wenn — wie im „Aschenbrödel“, einem Motiv, das Nestroy übrigens auch einmal aufgegriffen hat — schließlich zum guten Ende ein Ausgleich zwischen arm und reich stattfindet. Aus dem gleichen Grunde konnte Nestroy auf den Beifall seines Publikums rechnen, wenn er etwa im „Unbedeutenden" ab krönende Schlußpointe betont, daß audi der unbedeutende Mensch eine Ehre habe. Daß er die Privilegien der Aristokratie zeitweise angriff, war angesichts seiner josephi- nischen Anschauungen natürlich. Ganz abge- sen davon aber, daß er im Juli 1848, also in der Zeit revolutionärer Hochflut, mit seiner Posse „Die Freiheit im Krähwinkel“ dem Publikum denselben Streich spielte, wie Bauernfeind mit seinem Luspiel „Großjährig“ den Zensurbehörden von 1846, indem er nämlich das Revolutionsgeschehen bei scheinbarer Verherrlichung verspottete, sprach er nach dem Zusammenbruch der Revolution in „Lady und Schneider“ seine Meinung unumwunden aus: „Ah, wenn d’Freiheit Kommunismus wird sein, da hört es auf, ein Vergnügen zu sein!“
Nach den Märztagen des Jahres 1848 herrschte allerdings ein neuer Ton auf den Bühnen. Man suchte möglichst viele Stücke, die früher — allerdings nicht nur aus politischen Gründen — von der Zensur verboten worden waren, zur Aufführung zu bringen. Sogar der stets maßvolle Friedrich Halm brachte am 29. März in seinem Lustspiel „Verbot und Befehl“ die zeitgemäßen Verse- „Zu viel Regieren sei von Übel eben“, und „Gewalt erreiche und vermöge nichts“. Neben Gutzkows „Zopf und Schwert“, „Uriel Acosta", HebbeLs „Maria Magdalena" und Laubes „Karbschüler“ wurden der Reihe nach im Nationaltheater — wie das Theater a. d. Wien ab 16. April genannt wurde — verschiedene andere, vom Zeitgeist inspirierte Stücke inszeniert; so Elmars „Wie die Reaktionäre dumm sind“, Schubarts „Keine Jesuiten mehr“ oder das reichlich hohle Lustspiel von Roderich Benedix „Das bemooste Haupt oder Der lange Israel“, das als Verherrlichung des Korporationsstudententums die Wiener über das Wesen der — Katzenmusik belehrte. Diese Form studentischen Mißfallens übrigens wurde begierig aufgenommen und in der Zeit, die so oft Bühne und Leben wechselte, auch sofort einen Tag später vor dem Pąlab des Fürstbischofs Milde zur Anwendung gebracht. Im allgemeinen war jedoch, wie diese Beispiele zeigen, das Epigonentum obenauf, und von den raschgeschriebenen Dutzendstücken bt keines von literarischem Wert. Keines auch stand bewußt im Zeichen eines durchdachten revolutionären Programms oder war beispielgebend für eine neue Stilgestaltung und somit gab es auch nach den Märztagen kein „revolutionäres Theater“.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!