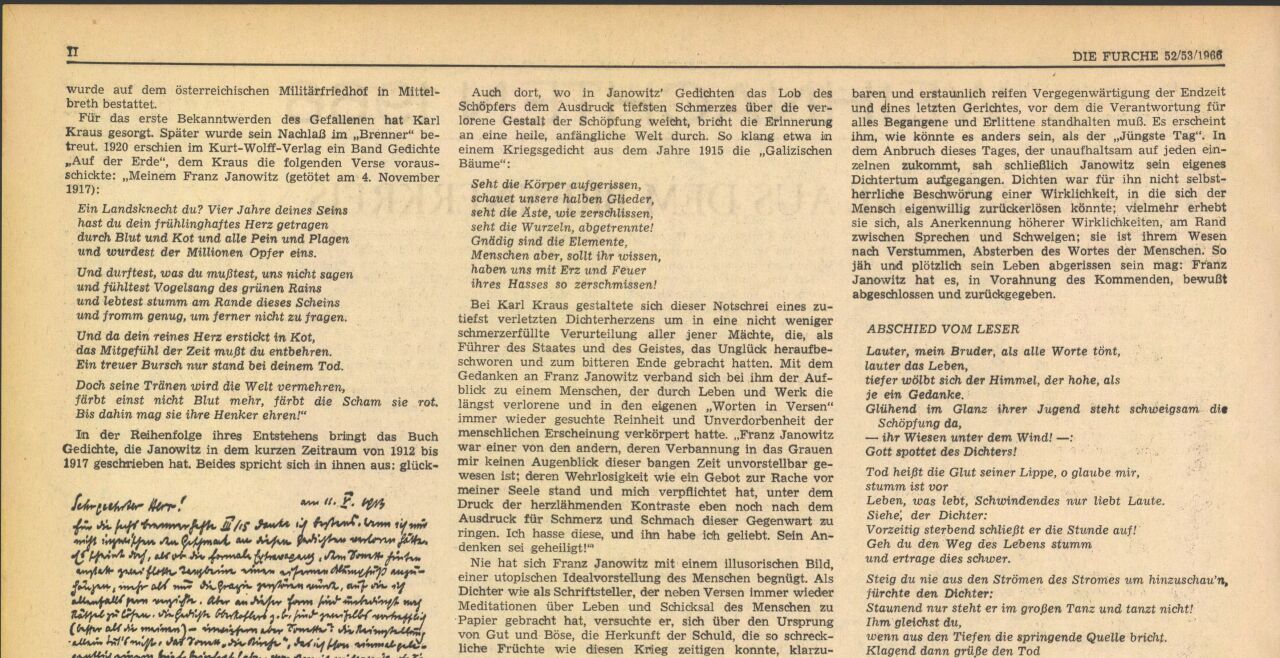
Zweifachen Anlaß bot uns dieses abgelaufene Jahr 1966, des Lebens und Werkes eines großen Österreichers zu gedenken, der wohl in das Bewußtsein der Gebildetsten der Alten und Neuen Welt einigegangen ist, der aber dem Großteil der Bücherleser noch immer so unbekannt sein dürfte wie im Jahre 1938, da Hermann Broch mit knapper Müh und Not einem unmenschlichen System mit seinen Schergen und „Fahrdienstleitern des Todes“ entrann, um über England in die Vereinigten Staaten zu emigrieren.
Vor fünfzehn Jahren ist der Dichter und Denker im Exil gestorben, vor achtzig Jahren, am 1. November 1886, wurde er dem Textilfabrikanten Joseph Broch, der als vierzehntes Kind einer einfachen jüdischen Familie aus Olmütz es in Wien zu Ansehen und Reichtum gebracht hatte, von seiner Gattin Johanna, die dem Patriziat der Hauptstadt entstammte, in die Wiege gelegt. Während die Spindeln und Webstühle der väterlichen Fabrik für den Textilienbedarf des Viedvölkerreiches der Doppelmonarchie spannen und woben, begannen die Parzen oder Nornen — man lebte ja damals noch im mythischen Bannkreis Richard Wagners! — den Lebensfaden eines Menschenkindes zu spinnen. Sie verwoben ihn in das Unheilsgeflecht einer Zeit, die der um zwölf Jahre ältere Karl Kraus einige Jahrzehnte später als die „Letzten Tage der Menschheit“ beschreiben sollte, in denen Gottes Ebenbild zerstört worden ist. Die Parzen oder Nornen woben mit den Unheilsmächten der Zeit die Todesmuster in den Teppich des Lebens eines Großreiches und seiner vielbesungenen Hauptstadt, die selbst ihren bevorstehenden Untergang noch in „fröhlichen Apokalypsen“ feierte und mitten im „Wertvakuum“ der Zeit, der müden „Fin-de- siecle“-Strmmung eines unverbindlichen Ästhetizismus einerseits und dem ödesten Operettenkitsch anderseits frönte. Man lebte ja noch in der Scheinsicherheit des ausklingenden Wirtschaftswunders der Gründerzeit, man glaubte an den unbedingten Fortschritt von Wissenschaft und Kunst und man tanzte eben Walzer auf dem Vulkan, dessen Beben nur von den hellsten und wachsamsten Geistern der Zeit vorausgespürt worden war.
Auch die Eltern des kleinen Hermann waren in den wirtschaftswunderlichen Denkkategorien des späten 19. Jahrhunderts befangen und kannten nur einen Zauber, den „Bilanzenzauber“, und nur einen Wahr- und Wahlspruch: „Geschäft ist Geschäft.“ Im Unterschied zu seinem ebenfalls um zwölf Jahre älteren Zeitgenossen Hugo von Hofmannsthal wuchs der kleine Hermann, dem nach drei Jahren noch der Bruder Friedrich folgen sollte, der heute noch in den Vereinigten Staaten lebt, weder in einer intellektuell beweglichen noch künstlerisch interessierten Familie auf, und der im Grunde scheue Knabe mußte gar bald seine innersten geistigen Neigungen, seine wahren Probleme vor seiner recht verständnislosen Umwelt verbergen. Die Familie, der er dann tatsächlich bis zur Erschöpfung diente, wollte ihn, ganz im Geiste des „Bilanzenzaubers“, lediglich zum erfahrenen Kaufmann und Textilfabrikanten erziehen, der das väterliche Millionenvermögen für seine eigenen Söhne dereinst vermehren sollte. Sie hatte keinen Sinn und kein Verständnis für seinen Wunsch, Mathematik und Philosophie zu studieren, sondern schickte ihn 1903 nach seiner Realschulmatura zunächst auf die Wiener Webschule. Daneben studierte er kurze Zeit an der Technik Versicherungsmathematik. Im gleichen Jahre 1903 noch wurde er zur Fortsetzung seines Studiums der Textiltechnologie nach Mühlhausen geschickt, um ihn zum Textilingenieur und Leiter der Fabrik auszubilden. 1906 erwarb er dort auch sein Ingenieurdiplom. Die Familie hatte also mit ihren Bestrebungen durchaus Erfolg und die beiden ersten Drittel im Leben Hermann Brochs gehörten ganz seinem Beruf im Leben der Wirtschaft, denn in ihm waltete schon frühzeitig jenes protestantisch-kantia- nische Pflichtbewußtsein, das seit den Tagen Josephs II. viele der besten Österreicher beseelte. Es wurde noch verstärkt durch die in seinem Blute liegende jüdische Verant- wörtungsethik, und wenn wir im dritten Bande seiner „Schlafwandler“-Trilogie die Sätze über sein Volk lesen:
„Der Jude, kraft der abstrakten Strenge seiner Unendlichkeit, der moderne, der fortgeschrittene‘ Mensch kat’exochen:
er ist es, der sich mit absoluter Radikalität dem einmal gewählten Wert- und Berufsgebiet hingibt, er ist es, der den ,Beruf, den Erwerbsberuf, in den er zufällig geraten ist, zu einer bisher unbekannten Absolutheit steigert, er ist es, der, ohne Bindung an ein anderes Wertgebiet und in unbedingter Strenge hingegeben an sein Tun, zur höchsten geistigen Leistung sich verklärt...“, wenn wir diese Sätze also lesen, so klingen sie fast wie ein analytisches Selbstporträt ihres Autors.
Drei Komponenten, die man sich als Seiten eines gleichseitigen Dreiecks vorstellen kann, bestimmen und bilden sein schöpferisches Wesen: Dichten — Erkennen — ethisches Handeln. Die Spannungen, in denen diese drei Komponenten zueinander standen, hatte er Seit jenem Augenblick auszutragen, da den zwanzigjährigen Studenten im Jahr 1906 der „Absolutheitsverlust“ und der damit verbundene „Zerfall der Werte“ zu quälen begann. Es war das denkwürdige Jahr 1906, in dem des nür um sechs Jahre älteren Zeitgenossen Robert Musils Novelle „Die Verwirrungen des Zöglings Törless“ erschienen war, in der schon alle Grausamkeiten der späteren Entwicklung vorweggenommen sind, die den Ethiker und Massenpsychologen Hermann Broch bis zu seinem plötzlichen Tod beschäftigen sollten.
Das Dichten und Denken dieses Mannes war immer nur auf eines gerichtet: auf Erkenntnis, die sich in ethisches, mitmenschliches Handeln umsetzen mußte. Er hat seine Ethik selbst beispielhaft vorgelebt. Er, der die Paradoxien und Antinomien dieses Daseins, dieser „unvorstellbaren Zeit“, wie sie Rudolf Felmayer genannt hat, bis zum letzten durchlebt hatte wie kein anderer seiner bedeutenden Zeitgenossen, strebte eben darum nach einer harmonischen Vereinigung der Gegensätze?, nach der coincidentia opposdtorum — mitten im Wertzerfall der Zeit!
Wenn wir uns daran erinnern, daß der große Brixener Kardinal Nikolaus von Cues mit eben dem gleichen Begriff der „coincidentia oppositorum“ die auseinanderstrebenden Teile der zerfallenden Lebens- und Wertewelt des Mittelalters zu einer neuen Einheit binden wollte, und wenn wir den Positivismus unseres Zeitalters, in dessen geistigem Klima Hermann Broch, als er neben seiner aufreibenden Tätigkeit als Leiter der Fabrik doch noch Mathematik und Psychologie an der Wiener Universität studierte, so gar nicht heimisch werden konnte, wenn wir den Positivismus also als ein Spätprodukt des Nominalismus begreifen, dann gewinnen seine Bemühungen um die Koinzidenz der Gegensätze erst ihre ganze historische Tiefendimension und enthüllen gleichzeitig einen seiner wesentlich österreichischen Züge, hat doch Österreich durch die Jahrhunderte seines Bestehens mehr oder minder glücklich immer um den Ausgleich der Gegensätze gerungen.
Es begann also mit der Erkenntnis des Absolutheitsschwundes und dem damit verbundenen Zerfall der Werte, den Brochs erstes Romanwerk, „Die Schlafwandler“, das er mit 42 Jahren zu schreiben begann, von der Romantik über die Anarchie bis zur Sachlichkeit darstellt. Als geistiger Kontrapunkt und Kommentar begleiten sie die in den dritten Band eingestreuten Diskurse und Exkurse einer geschichtsphilosophisch untermauerten Werttheorie, die am hierarchisch aufgebauten Wert- und Weltbild des Mittelalters orientiert ist.
Wir wissen alle, daß dieses Weltbild im Laufe des letzten Halbjahrtausends für den Großteil der Menschen immer mehr an Gültigkeit verloren hat, daß an Stelle des Glaubens an Gott, des übergeordneten absoluten Wertes, die Tedlwert- gebiete mit ihrer autonomen inneren Logik getreten sind. Das mußte zu einer totalen Wertanarchie und schließlich zum Nihilismus führen, dessen Heraufkommen ja schon Nietzsche prophezeit hatte. Broch wird in seinem letzten vollendeten, 1949 erschienenen Roman „Die Schuldlosen“ diese Thematik des Wertzerfalls wieder aufnehmen und bis an die Schwelle des totalen Einbruchs der niederen Dämonen im Jahre 1933 fortführen.
Er selbst kommentierte dieses Werk mit den Worten:
„Mit den ,,Schuldlosen' hat der Dichter des ,Tod des Vergil' die Linie der Romantrilogie ,Die Schlafwandler‘ wieder aufgenommen: da wie dort ist ein Stück deutscher Geschichte von innen her erfaßt, dort die zum ersten Weltkrieg hinführende und in ihm endende wilhelminische Epoche, hier der noch unheilschwangere Abschnitt, der bis Hitlers Machtergreifung führte ... Die ,Schlafwandler' hatten mit der Gestalt des Huguenau den neuen Typus Mensch bereits vorskizziert und gezeigt, daß er ein Produkt des zunehmenden Wertzerfalls ist. Von hier aus wird verständlich, daß heute,
Kartenbrief von Hermann Brosch aus Wien vom 8. November 1937 an Professor Dr. Ernst Schönwiese, der den Dichter stets gefördert und einen Teil seiner Werke herausgegeben und kommentiert hat.
da nunmehr die alten Werthaltungen mit all ihren sozialen und sonstigen Bindungen — in Deutschland infolge der Niederlage 1918 schärfer als anderswo — schier zur Gänze ausgetilgt sind, der Mensch mit einemmal radikal auf sich gestellt ist, verdammt zur Einsamkeit... Eben aus der Vereinsamung ergibt sich das fürchterliche Phänomen des modernen Lebens, die ,Schuld' des neuen Menschen, seine Kainshaftigkeit: bis zur Selbstauflösung gegen sich selber gleichgültig, ist er ohne weiteres bereit, den Nebenmenschen auszulöschen.“
Schon am Beginn seiner werttheoretischen Überlegungen der späten zwanziger Jahre faßt Broch jene Fragen zusammen, die ihm als Leiter eines Lazaretts im ersten Weltkrieg besonders deutlich vor Augen gestanden haben müssen wie seinem unglücklichen Kameraden Georg Trakl nach der Schlacht von Grodek und allen jenen noch verantwortungsbewußten Geistern der Zeit, die die Todesmuster der Parzen im Teppich des Lebens voll Entsetzen wahrnahmen. Die seither nie zur Ruhe gekommenen Fragen:
„Wie kann das Individuum, dessen Ideologie sonst wahrlich auf andere Dinge gerichtet war, die Ideologie und Wirklichkeit des Sterbens begreifen und sich ihr fügen? Wie kann der Mensch die Ideologie des Krieges ,begreifen', widerspruchslos sie empfangen und billigen? Wie konnte er das Gewehr zur Hand nehmen, wie konnte er in den Schützengraben ziehen, um darin umzukommen oder daraus wieder zu seiner gewohnten Arbeit zurückzukehren, ohne wahnsinnig zu werden? Sind sie wahnsinnig, weil sie nicht wahnsinnig wurden?“
Schon hier tritt uns das Zentralproblem Brochs, die Frage nach dem Tode, entgegen, denn der höchste Sinn aller Erkenntnis, so läßt er seinen todkranken Vergil dem Kaiser Augustus entgegnen, ist die Erkenntnis des Todes. Gleich seinem Freunde Elias Canetti kreist auch Broch ein Leben lang um das Phänomen des Todes und seine unauslotbare Problematik. Er steht damit in der uralten Tradition der „ars moriendi“ neben Rilke, Trakl und Kafka als einer der hervorragendsten und tiefsten Bedenker des Todes.
Weil Dichtung nach Brochs stets wachsender Überzeugung in dieser Zeit kaum mehr möglich war, eben weil sie nicht zur Erkenntnis des Todes führte, sondern im bloß Ästhetischen, in der manipulierbaren Schönheit stecken bleibt, die zum Kitsch wird, zum „Bösen im Wertsystem der Kunst“, dessen Vertreter er in allen jenen erblickte, die auf die Stimmigkeit ihrer autonomen Wertsysteme stolz und um ihretwillen auch zum Mord bereit waren, darum hat der Dichter, der sich am Beginn seiner schöpferischen Arbeit noch nach einem neuen totalitätstiftenden Mythos, ja Sogar nach einem neuen religiösen Roman sehnte, der Dichtung immer mehr mißtraut. Obwohl selbst Schöpfer mythischer Figuren wie die des Knaben Lysandas und der Plotia im „Tod des Vergil“, der großartigen „Mutter Gisson“ in „Versucher“ und des riesenhaften singenden Imkers in den „Schuldlosen“, obwohl selbst Schöpfer solch religiöser Romane, wie sie eben der „Tod des Vergil“ und „Der Versucher“ sind, wußte er doch sehr genau, daß man mit Dichtung weder einen neuen Mythos schaffen kann, noch eine neue Religion stiften darf. Und so verzweifelte er an den Möglichkeiten der Dichtung und wurde, weil er trotzdem noch weiterschreiben mußte, zum „Dichter wider Willen“. „Daß Hermann Broch ein Dichter war“, sagt Hannah Arendt, „und Dichter nicht sein wollte, war der Grundzug seines Wesens, inspirierte die dramatische Handlung seines größter. Werkes und wurde der Grundkonflikt seines Lebens.“
Und so wandte er sich in der zweiten Hälfte seiner schöpferischen Jahre immer mehr seinen erkenntnistheore tischen und massenpsychologischen Arbeiten zu, die dem vom Massenwahn bedrohten Mitmenschen helfen und die Gleichgültigkeit gegenüber seinem Leid bekämpfen wollen.
Aber selbst von den im buchstäblichen Wettlauf mit der Zeit und dem Tode vollendeten und zu ihrem größeren Teil unvollendet gebliebenen Arbeiten des Denkers und Ethikers darf man in einem gewissen Sinne behaupten, daß auch sie „wider Willen“ geschaffen worden sind, denn Brochs gesamtes Dichten, Denken und Handeln standen unter dem metaphysisch-mystischen Diktat von Müssen und Nicht-anders- Können. Er folgte einer Berufung und keinem Beruf. Ja, sein innerer und äußerer Lebenskampf stand lange unter dem Zwiespalt von Beruf und Berufung!
Als Erkenntnistheoretiker schuf er sich in mühseligen, komplizierten Denkprozessen den vielleicht für das Denken kommender Zeiten noch sehr wichtig werdenden Begriff des „Irdisch-Absoluten“, das die Ebenbildhaftigkeit neu zu stiften vermöchte, eine „Ebenbildhaftigkedt an sich“, die es selbst dann noch gäbe, wenn Gott etwa gar nicht mehr existierte.
Broch wollte eigentlich mit seiner Erkenntnistheorie hinter den Rücken Gottes gelangen, um Ihn von dort aus zu beobachten. Das und seine merkwürdige Sprachphilosophie verbinden ihn in eigenartiger Weise mit Heinrich von Kleist, der auf Kafka stark gewirkt hatte, auf Kafka, den Broch bewunderte und an dessen Werk er — trotz aller Bewunderung für James Joyce — heimlich die Literatur seiner Zeit maß.
Auch die Lehre vom „Irdisch-Absoluten“ war mit seinen Spekulationen über das Phänomen des Todes, der sich vom äußersten Unwert eben zum Grenzwert des einzig Absoluten im irdischen Dasein wandelte, zutiefst verbunden, ebenso wie seine Wertlehre und seine psychologischen Untersuchungen zum Massenwahn, deren Ergebnisse eine Wiederkehr des Faschismus verhindern helfen sollten.
Wer den Tod bedenkt, wie es Hermann Broch getan, wer den orpheischen Abstieg in das Reich der Schatten so schonungslos vollzogen und in seinem Vergil-Roman so eindringlich und unvergeßlich dargestellt, wer wie er die Rückverwandlung der Schöpfung bis zum völligen Ent-Werden und Ent-Tun geistig antizipiert hat, der kommt notwendig zum mystischen Erlebnis. Ja, er hat uralter mystischer Er fahrung eine neue Wendung und Tragweite gegeben. Aus allgemein christlicher Sicht mag seine Mystik in einem seltsamen Zwielicht erscheinen. Sie ist zwar noch keine Mystik ohne Gott wie bei Camus etwa, zu dem wohl manche Parallelen in Brochs Denken hinzuführen scheinen, aber eben eine Mystik des „schweigenden Gottes“. Da es mit diesem „schweigenden Gott“ — es ist der alte „deus abscon- ditus“ der Juden, zu dem der seinerzeit zum katholischen Glauben konvertierte Hermann Broch in seinen letzten Lebensjahren offensichtlich wieder hinstrebte — da es mit diesem „verborgenen, unendlich fernen Gott“ keine „unio mystica“ gab, verblieb hier der Mensch in der „mystischen Nacht“. Aber eben in dieser völligen Nacht der kosmischen Rückverwandlung erhielt Broch-Vergil den Befehl, der da Verbot für Orpheus aufhob, den Befehl, sich umzuwenden, hinzuwenden zu einer neuen Schöpfung, die uns am Schlüsse der Apokalypse des Apostels Johannes prophezeit ist. Wenn er auch den unendlich fernen Gott in seiner „mystischen Nacht“, dem alten Immanenzraum der kantianischen und nachkantianischen Philosophie, noch nicht sieht, er ahnt doch schon ein neues Schöpfungswort, eben jenes von allen Dichtem vergeblich gesuchte Wort, das jenseits aller Worte ist, das im Schweigen wohnt. Etwas von dieser tiefen Ahnung zittert in den Anfangszeilen des herrlichen Gedichtes „Vergil in des Orpheus Nachfolge“, das Broch nach Vollendung seines Romans geschrieben hat:
„Wer nur weiß, was er weiß, kann es nicht aussprechen; erst wenn Wissen über sich selbst hinausreicht, wird es zum Wort,
erst im Unaussprechlichen wird Sprache geboren.“
Herman Broch hat bis in die tiefsten Geheimnisse des Schattenreiches hinabgerührt, aber er hat sich immer wieder losgerissen, denn:
„ ... die Gestaltung der Irdischkeit ist jenen auf getragen, die im Dunkel gewesen sind und dennoch sich losgerissen haben orphisch zu schmerzlicher Rückkehr.“
Am 30. Mai 1951 ist Hermann Broch aus dem irdischen Dunkel in das ewige Licht abberufen worden, aus dem er nicht wiederkehren muß. Er hat uns ein Werk hinterlassen, das wahrlich den Nobelpreis, für den er vorgeschlagen worden war, und die höchste Auszeichnung der Heimat verdient hätte, ein Werk, das für immer von seinem Hiersein zeugen wird.



































































































