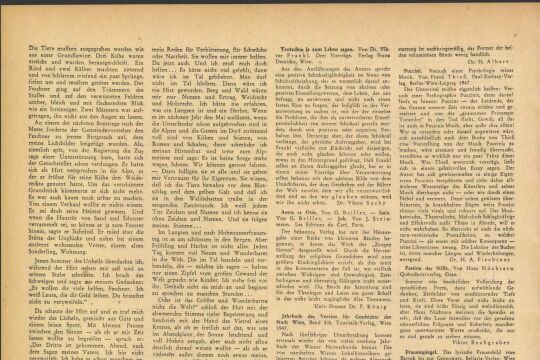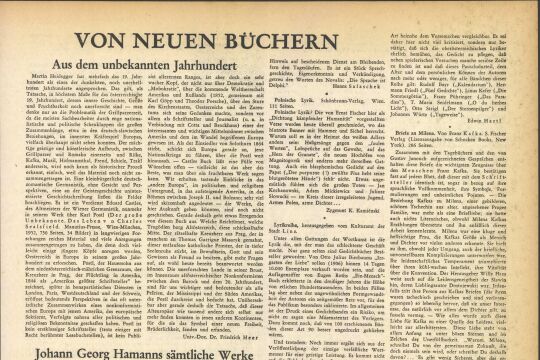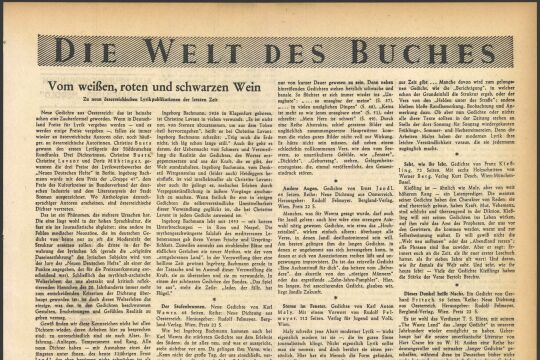Jüngst ist in der Reihe „Limes Nova“ des Limes-Verlages in Wiesbaden, der sich seit 1945 der modernen Lyrik und Prosa annimmt — er betreut das Gesamtwerts von Arp, Barth, Benn, Einstein und Stramm —, ein neuer, schmaler Gedichtband des österreichischen Lyrikers, Essayisten und Herausgebers Ernst Schönwiese erschienen: „Odysseus und der Alchimist." Vor vier Jahren brachte der gleiche Verlag des Dichters Versband „Geheimnisvolles Ballspiel“ und vor sechs Jahren jenen Gedichtband, der eine deutliche Ausdruckszäsur im Schaffen Schönwieses markiert: „Baum und Träne“. Vergleicht man diese drei Bände mit den davor liegenden, in den strengen Formen und Metren der Tradition beheimateten Büchern des Dichters, so sieht man ihn darin wahrhaftig als einen verinnerlichten Odysseus, der nicht nur auf der Suche nach dem eigenen Selbst, das schon Grillparzer so teuer war, sondern auch auf dem Wege zu mystisch-religiösen Erkenntnissen ist, die ihm das immer tiefere Eindringen in die Erleuchtungen abendländischer und fernöstlicher Weisheiten (von Ekkehard über die Veden bis zu den Meistern des Zen-Buddhismus) vermittelten. Seine Suche geht nach dem „unbekannten“, wohlbekannten Gott, der sich ihm zuweilen als „großer Alchimist“ zeigt und schon im gleichen Augenblick auch wieder entzieht, weil Verwandlung von Traum und Tag sein Wesen ist.
Daß für den Dichter das Traumgesicht als Antlitz der „wahren“ Welt lange von Bedeutung war, das bezeugen schon die frühen Bücher, deren erstes — „Der siebenfarbige Bogen“ — vor rund drei Jahrzehnten noch im Manuskript mit dem Julius-Reich-Preis ausgezeichnet wurde, aber erst nach seiner Rückkehr aus der Emigration vor zwei Jahrzehnten in München erscheinen konnte (1947). Aus dem gleichen Jahre 1947 stammt der im Erwin-Müller-Verlag, dessen Cheflektor niemand Geringerer als Leopold Liegler war, erschienene Versband „Ausfahrt und Wiederkehr“, dessen erstes Gedicht noch jenen Reim preist, auf den der Dichter im Laufe der letzten Jahre zwar nicht völlig, doch mehr und mehr verzichtete, um sich den offenen, freirhythmischen, vor allem aber den immer knapperen und dichteren Gebilden lyrischer Aussage zuzuwenden, die bei ihm allerdings nie zu bloßen „Texten“ entarten werden. Der Einfluß fernöstlicher Meister ist hier unverkennbar.
Aber Schönwiese, dem wir auch kostbare Erstübertragungen fernöstlicher Lyrik danken, setzt den Osten völlig in unser Empfinden und Denken um, so erst das Verständnis für die ferne, fremde Quelle weckend! Darin liegt der besondere Wert seiner meisterlichen Übertragungen religiöser Dichtungen und Gesänge aus dem Osten (Indien-China- Japan). Daß er damit in einer alten geistesgeschichtlichen Tradition von Hammer-Purgstall über Rückert bis zu Kla- bund und Hermann Hesse steht und ein kostbares Erbe mehren half, soll nicht übersehen werden. Auch für den Dichter und Nachdichter Schönwiese gilt sowohl Rückerts Wort: „Die Poesie in allen ihren Zungen, ist dem Geweihten eine Sprache nur" als auch der von Hamann an Herder und die Romantik vermittelte Gedanke von der Dichtung als Muttersprache des Menschengeschlechts. Ja, der Dichter nimmt diesen Gedanken in seinen bisher nur auszugsweise veröffen'Uch- ten „Tagebuchaufzeichnungen zu einem poetologischen Weltbild“ bewußt auf und vertieft ihn durch das „dialogische Prinzip“ eines Martin Buber oder Ferdinand Ebner, die ihrerseits wieder über Kierkegaard auf Hamann zurückweisen. Da heißt es in den erwähnten Aufzeichnungen Schönwieses:
„Die Muttersprache der Menschheit ist die Poesie insoferne, als sie eben jenes Urerlebnis der Ich-Du-Beziehung, richtiger der Ich-Du-Identität, der Einswerdung mit dem Du vermittelt und die Einverwandlungs- und Identifikationsfähigkeit, die eigentlich erst wahrhaft humane, den Menschen erst zum Menschen machende Erlebnisfähigkeit wach erhält. Die Dichter sind — mit den anderen Künstlern — diejenigen, die verhindern, daß die Menschen gänzlich versteinen...“
Wenn der Dichter, worauf Joseph Střelka in seinen Arbeiten über Schönwiese schon hingewiesen hat, aus der Vereinsamung des lyrischen Ich, aus der Vereinzelung des individualistischen Denkens den rettenden Weg zum menschlichen und göttlichen Du sucht, dann zeigt ihn sein jüngster Band — die vorangegangenen markieren die Strecke seines inneren Weges („Nacht und Verheißung“, 1947, „Das Bleibende“, 1950, „Das unverlorene Paradies“, 1951, „Ein Requiem in Versen“, 1953, „Stufen des Herzens“, 1956, „Der alte und der junge Chronos“, 1957, „Traum und Verwandlung“, 1961, sowie die bereits genannten Limes-Bände) — auf einer Stufe der Verinnerlichung und Selbsterkenntnis, die man in der zeitgenössischen Lyrik wohl nicht so schnell wieder antreffen wird. Das Signum dieses jüngsten Bandes, der die „innere Odyssee“ des Menschen zu Gott — fast möchte man sagen, im Sinne der Augustinischen „Unruhe des Herzens“ — danstellt, ist die völlige Preisgabe des Ichs, um es im menschlichen und göttlichen Du wiederzufinden. Davon mögen einige Beispiele aus Schönwieses letztem Gedichtband Zeugnis ablegen:
„Du wolltest nicht länger warten, denn Du dürstetest nach Wein: so warfst Du mich in die Kelter.
Was in mir stürmte und trüb war, hat sich zu Ende geklärt.
Möge ich Dir süß sein im Mund der Geliebten!“
Oder die Anrufung des „großen Alchimisten“:
„Wie du bindest und löst in Deinen Feuern, verwandelst und wieder bindest, großer Alchimist der Seelen!
Laß Deinen Versuch nicht scheitern!
Und wenn es ein Staubkorn nur wäre: für sie, die ich liebe, laß es ein Goldkom sein!“
Die dem Haiku entsprechende Verknappung, fast mit chine- slisčhbm oŠeřjapaniSaiSíď-lPfiřserhííSgySffiihtr"”
„Der flatternde Vogel über der Blume:
das Leben!“
Als Beispiel der völligen Ich-Du-Identifikation das Gedicht:
„Meine Penelope,
vergiß nicht, —
den Bogen Deiner Seele:
nur ich,
ich allein,
vermag ihn zu spannen.
Es hilft nichts,
wenn du ihn mir verweigerst.
Ich bin der Bogen.“
Und zum Schluß die mystische Erkenntis aller Gottesnähe:
„Wenn du ihn erst suchen mußt, findest du ihn niemals.
Erst wenn du nichts anderes mehr siehst als ihn,
hast du gefunden.“
Wer aber IHN gefunden hat, der hat auch das „vergessene Wort“ vernommen, das der Dichter immer wieder suchen muß, das „Wort jenseits aller Worte“, das Schöpfungswort, nach dem Hermann Broch zeitlebens gefahndet und das er im Schlußkapitel seines „Tod des Vergil“ den sterbenden Dichter fast vernehmen, zumindest erahnen ließ. Auch hierin berührt sich Ernst Schönwiese mit seinem Freunde Hermann Broch, dessen geschichts- und wertphilosophischen Gedanken er schon sehr früh aufgenommen hatte, wie uns dies sein 1933 erschienener Essay „Neuer Glaube — Neue Menschen“ (im „Kompaß für morgen“) beweist.
Mit dem großen Namen Hermann Broch, dem der Publizist, Essayist und Herausgeber Ernst Schönwiese bis heute dient, wird die Erinnerung an andere große Zeitgenossen wach, mit denen sich Schönwieses vielfältiger Dienst am Worte verband: an Franz Kafka, Robert Musil, Franz Blei, Albert Paris Gütersloh und Georges Saiko, an Rainer Maria Rilke, Rudolf Alexander Schröder, Hugo von Hofmannsthal, Franz Werfel und Stefan Zweig, an Josef Roth und Elias Canetti, an Heinrich, Thomas und Klaus Mann, Berthold Viertel und Bert Brecht, an Martin Buber und René Guénon, an die großen Franzosen Mallarmé, Valéry, Gide, Proust und Bernanos, an James Joyce und Virginia Woolf, an die großen Amerikaner William Faulkner, Thornton Wilder und Thomas Wolfe und viele andere bedeutende Namen der deutschen und fremdsprachigen Literaturen. Sie alle hat der Herausgeber der Zeitschrift „das silberboot“ von 1935 bis 1951 in seinem Organ versammelt. Die 28 Hefte dieser lieterarischen Revue waren wahrhaftig ein „Forum der Weltliteratur“, wie sie Hans Jürgen Fröhlich in einem Artikel in „Die Welt der Literatur“ genannt hat.
Zuvor hatte Schönwiese — ebenfalls 1935 — eine der bedeutendsten Lyrik-Anthologien der Zeit, „Patmos“, herausgebracht, in der sich mancher Name schon findet, der heute großen Klang hat, neben den Großen wie Broch und Musil. Die literarische Zeitschrift wurde also im Oktober 1935 als Gegengewicht gegen die braune Kulturbarbarei mit ihren Bücherverbrennungen ins Leben gerufen und vermochte sogar noch eine Zeitlang im Nazi-Deutschland zu erscheinen und damit der völkischen Blu-Bo-Visage das wahre Antlitz eines weltliterarischen Humanismus entgegenzuhalten. Im Jahre 1937 war es damit zu Ende. Neun Jahre später konnte der aus der Emigration ziurückgekehrte Herausgeber sein wichtiges kulturpolitisches Unternehmen wieder aufnehmen und durch den neugegründeten Verlag „das silberboot“ wirksam unterstützen — mitten in der geistigen , und materiellen Trümmerwelt, die deř braune Faschismus hinterlassen batte Im ersten Heft des zweiten Jahrganges der Zeitschrift war dann jene programmatische Erklärung zu lesen, die 1935 das Erscheinen der Zeitschrift schon ab ovo unmöglich gemacht hätte:
„,Das Silberboot’... wollte ein überparteiliches Forum antinationalsozialistischer Dichter sein. Es wollte mithelfen, daß ihre Stimme gehört, und zwar gerade von denen weiter vernommen würde, denen man sie vor allen Dingen vorenthalten wollte, von denen, die hinter der Stacheldrahtabsperrung leben mußten... Heute, nahezu neun Jahre nach dem Versand seines letzten Heftes, kann JDas Silberboot’ seinen zweiten Jahrgang beginnen. Wie damals will es auch heute der echten Dichtung und der wahren humanen Geistigkeit dienen.“
Mit Recht zählt Fröhlich den ersten Jahrgang dieser Revue zu den wichtigsten Exilzeitschriften der Zeit und beklagt, daß sie über so vielen „Reprisen“ aus der dunklen Zeit nicht wieder nachgedruckt worden ist, ja, daß man sie anscheinend völlig vergessen hat. Ein „österreichisches Schicksal“ könnte man bitter sagen. Die Kompositionskunst, mit der der Herausgeber jede einzelne der 28 Nummern gestaltet hat, die Umsicht in der Aufbereitung des unter schwierigsten Umständen gesammelten Materials, die Art wie lyrische, erzählende und essayistische Texte, Glossen und Nachrichten miteinander korrespondieren, wäre der Darstellung und Untersuchung in mehr als einer zeitungswissenschaftlichen Dissertation wert! Man sehe sich zum Beispiel nur die erste Nummer des vierten Jahrganges an: wie sich hier ein innerer Bogen von dem einleitenden Hofmannsthal-Zitat über Goethes Wort „Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis“ zu den verwandten Äußerungen Martin Bubers am Schluß des Heftes spannt, das ist kompositionstechnisch unübertrefflich! — Der Dienst, den diese Zeitschrift der Selbstfindung und Ortsbestimmung der österreichischen Literatur durch die ständige Konfrontation mit den großen Geistern der Welt geleistet hat, ist gar nicht hoch genug einzuschätzen.
Den gleichen Dienst erwies der unermüdliche Essayist und Rundfunkmann dem dichterischen Wort durch seine Essays über Broch, Wolfskehl, D. H. Lawrence, Grab, über die jungen österreichischen Dichter von Ingeborg Bachmann bis zu Juliane Windhager und durch seine Hörspielfassungen großer Dichtung sowie seine programmatischen Aufträge im österreichischen Rundfunk. Der da ,;auf der Suche nach dem vergessenen Wort“ ist, findet und entdeckt immer wieder und allerorten das lebendige, schöpferische Wort der Dichtung und ist einer seiner vornehmsten Diener im weltliterarischen Verkehr, ein Mittler und Vermittler jener Werte, die wir in unserer wirtschaftswundertichen, technokratischen Zeit so bitter nötig haben wie einst der Arme einen Bissen Brot. Zu seinem 60. Geburtstag im Jahre 1965 wurde dem vielfältigen Diener am Wort für seinen treuen Dienst als Dank seiner Freunde und Verehrer die Anthologie „Aufruf zur Wende” gewidmet. Ein Zeichen, daß wenigstens ein kleiner Kreis den Aufruf zur Metanoia aus dem Werke und Wirken Ernst Schönwieses vernommen und verstanden hat.