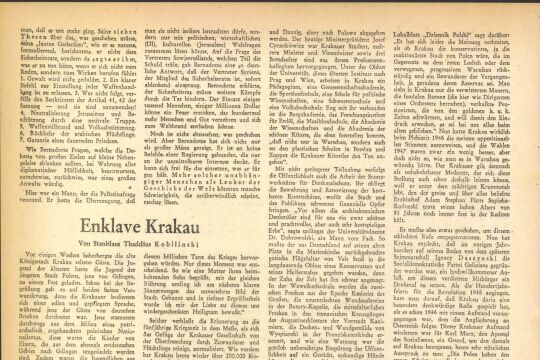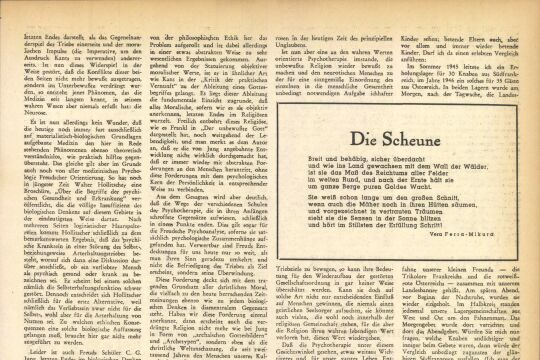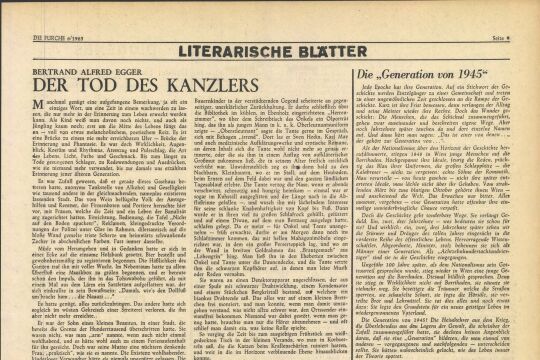Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Das Unbegreifliche
Er war Soldat im „Dritten Reich“. Jung. Trotzdem mit 24 schon der „Alte“. Doch ein Teufel mit perfekten Gehilfen pervertierte Anständigkeit in Verbrechenshilfe.
Er war Soldat im „Dritten Reich“. Jung. Trotzdem mit 24 schon der „Alte“. Doch ein Teufel mit perfekten Gehilfen pervertierte Anständigkeit in Verbrechenshilfe.
Ich bin ein ziemlich repräsentativer Vertreter einer Generation, die in hohem Maße an dem geschichtswirklichen Alptraum der sieben Jahre 1938 bis 1945 schuldig war und das nicht und nicht begreifen kann. Nicht zu begreifen vermag, weil sie in ihrer überwältigenden Mehrheit nicht bösen Willens war. So bin ich persönlich bewußtseinsgespalten, heute wissend und erinnernd, beiderseits der Todeslinie und soll und will beitragen zum Anliegen „Friede für Österreich“.
Friede aber kann nicht als Einbahnstraße wirksam werden. Die eine Seite, die der Opfer dieser grausigen Zeit, hat alle Argumente aufgedeckter Verbrechen für sich. Und das „Wir“, für das ich stehe? Nichts. Wirklich nichts?
Es ist im steigenden Maße, je weiter weg vom eigenen Miterleben, desto unbekümmerter, Mode geworden, eine ganze Generation von Österreichern zu verurteilen, auch wenn sie nicht braun, sondern feldgrau getragen haben. Mode kann töricht und ein Kollektivschuldurteil kann nicht moralisch sein.
Wer an den Gedenktafeln der Toten dieses Krieges vorbeigeht, der wird in jedem Dorf, in jeder Stadt die doppelte Anzahl und mehr Namen finden, als nach dem Ersten Weltkrieg. Wer diese Denkmäler wegwünscht, kann nicht die Wahrheit wollen, er verdrängt den Tod von fast 300.000. In praktisch jeder Familie ein Vater, ein Großvater, ein nächster Verwandter. Tod und Todesnot hat für die Menschen, die das zu tragen hatten, keine Vorzeichen. Daß auch dieser tausendfache Tod Opfer war, müssen wir ganz einfach bedenken, wenn wir eine für alle gemeinsame Zukunft wollen.
Ich habe das Gestern erlebt und den Tod gesehen. Wenn ich im folgenden meinen Anteil an der Geschichte dieser schrecklichen Jahre darstelle, so möchte ich nicht als Strafverteidiger einer ganzen Generation verstanden werden. Dafür fehlt mir Auftrag und Kompetenz. Aber als Stimme aus dieser Generation, und zwar als die eines Mannes, der glaubt, vor seinem Gewissen bestehen zu können, möchte ich gehört werden. Ich möchte einen Beitrag leisten zum Verständnis zwischen dem Wissen von heute und dem Erleben von damals.
Wie habe ich das gesehen und gelebt? Im Jahre 1938 war ich plötzlich deutscher Leutnant. Plötzlich? Mein Bundesheer von damals war gehorsam und diszipliniert. Monate, Jahre vor dem März 1938 stand jeder von uns wenigstens einmal in vier Wochen mit Stahlhelm und scharfer Munition im Bereitschaftsdienst auf Abruf. Gegen wen? Gegen die braune Straße.
Kein Wort, kein Flüstern bereitete einen Ungehorsam vor. Als junger und schon voll austrainierter Offiziersanwärter wurde ich auf einen Truppenübungsplatz zu einem burgenländischen Regiment eingeteilt, das dort übte. Zum Einsatz. Jeder glaubte zu wissen, wogegen. Das Regiment stand und schwieg. Niemand sagte uns etwas. Und dann war es auf einmal aus mit Österreich — ganz plötzlich.
Ich war am Heldenplatz dabei: Nicht in Formation, hinkommandiert zur Füllung. Viele schrien um uns, keiner von uns. Auch nicht diejenigen meiner Kameraden, die „Nazis“ waren, ohne daß zum Beispiel ich es wußte.
Da standen wir nun als Bürger eines Staates, der von allen Staaten, die uns heute Mores lehren, sitzen gelassen war, obwohl wir als einziges Land der Welt in den vorgelaufenen Jahren mit Blut und Tränen gegen die braune Welle gekämpft hatten. Und als Soldaten einer Armee, die eine eigene Regierung im Regen stehen ließ. Ein weinerliches „Gott schütze Österreich“ war alles, was wir zu hören bekamen. Nicht einmal die Chance haben, die riskiert, uns zeigen zu lassen, wes österreichischen Geistes Kind wir waren.
Heute zu behaupten, das österreichische Bundesheer — wir — hätten nicht geschossen, weü wir nationalsozialistisch unterwandert gewesen wären, ist eine jämmerliche Ausrede der politischen Versager von damals. Nicht einmal fünf Prozent des damaligen Heeres waren Angehörige des „Nazi-Soldatenringes“. Das ist dokumentiert.
Genau zu diesem Zeitpunkt bei der Parade der deutschen Bataillone nach der Hysterie am Heldenplatz lief ich als alleingelassener und sehr besorgter junger Mensch innerlich über zu dieser Wehrmacht. Ich empfand sie als Refugium von Recht und Ordnung in der braunen Flut.
Mit Recht besorgt? Zu diesem Zeitpunkt „saßen“ bereits mein Vater und mein Bruder im Polizeigefängnis. Refugium? Mein Bruder ging sofort nach seiner Entlassung zur Wehrmacht in Deckung und blieb dort und war dort „sicher“ bis 1945. Wer nach Motivation fragt, sollte auch dieses - sicher nicht Einzelerlebnis— bedenken.
Dann kam der Krieg. Ich habe ihn erlebt: ausschließlich an der Front. Vom 1. September 1939 bis Mai 1945. Als Leutnant und als Major. Als Kavallerist, als Panzermann, als Infanterist und als Generalstäbler. Vor Lemberg, bis zur spanischen Grenze, vor Moskau, in Stalingrad, in Cassino und in den Ardennen. Ich bin verwundet in Lazaretten gelegen und habe kümmerliche Urlaube erlebt. Das war alles. Wirklich alles?
Warum denn um Gottes willen? Die Antwort ist so einfach, daß sie die heutige Generation wohl kaum verstehen kann. Wir waren jung, sehr jung, und haben nicht oder sehr selten politisch gedacht. Der Alltag in der Kompanie, an der Front, füllte uns Soldaten aus. Und die Motivation? Die ebenso strapazierte wie mißverstandene Pflichterfüllung? Die Bindung an den Eid, an das Hitler-Regime, was ahnungslose Ankläger heute unterstellen, war es bei weitem nicht.
Sehr wohl aber der Heimatbegriff — auch ganz anders, als das heute vermutet wird. Das hatte mit Großdeutschland gar nichts zu tun. Bei mir aber mit Lambach und Oberösterreich, mit Eltern und Freunden meiner Kindheit.
Daß der Krieg von Berlin aus vom Zaun gebrochen war, das war mir sehr bewußt — aber was sollte es, wir waren drin. Daß wir kein
Teil Deutschlands wären, diese Idee hatten uns die späten Sieger schon 1938 ausgetrieben. Und mit ihnen die ganze Welt. Mit allen Konsequenzen, bis hin zur Internierung als feindliche Ausländer. Das, was wir an der Front erlebten, wollten wir von zu Hause fernhalten. Besonders nach den Frontjahren in Rußland, was eine ganz starke Motivation war. Das und nur das war mein Heimatbegriff; nicht einmal Vorarlberg und Eisenstadt, schon gar nicht
Berlin oder Mecklenburg.
Pflicht — schon mehr als Verpflichtung. Hier kann ich nur für mich sprechen. Ich war als gut ausgebildeter Offizier die natürliche, nicht die formale Nummer eins in meiner Einheit. Später, bald der nur allzu Erfahrene. Die jungen Soldaten haben mir ganz automatisch ihr Schicksal, einfacher, ihr Leben, anvertraut. Mit 24 Jahren war ich als Kompaniekommandant der „Alte“. Diese jungen Menschen, so gut ich konnte, heil nach Hause zu bringen, empfand ich als meine Pflicht Sie zu verlassen aus politischen übergeordneten Gründen kam mir nie in den Sinn. Und je auswegloser die militärische Lage wurde, desto wirklicher empfand ich diese Pflicht.
Bis zu den ersten Tagen des Mai 1945. Als letzter Generalstabsoffizier der Wiener Panzerdivision habe ich gegen jeden Befehl und in offener Konfrontation mit dem Divisionskommandanten alle Österreicher der Division zusammengezogen und in bewaffnetem Marsch quer durch die längst revoltierende CSR sicher nach Oberösterreich hineingeführt. 1.700 Mann. Pflicht?
Was soll dieses Epos? Entschuldigen, das Schreckliche herunterspielen? Ganz im Gegenteil. Das Furchtbare, das Unbegreifliche dieser Jahre ist es ja, daß ein Teufel mit perfekten Gehilfen so viel Anständigkeit in Verbrechenshilfe pervertieren konnte. Unsere Tapferkeit und Heimatliebe an der Front, der Heroismus unserer Mütter und Frauen in den brennenden Städten wurden zum Instrumentarium des Satans.
Und wir haben das bis zum bitteren Ende nicht begriffen: Das ist und bleibt die schwere, die historische Schuld meiner Generation.
Begreifen kann man nicht abstrakt. Ich will es für mich heute personifizieren mit den Enkeln, die blond und helläugig sind. Wenn sie nur deswegen ermordet würden, wie Hunderttausende kleiner jüdischer Kinder, weil sie braune Augen und dunkle Locken hatten, könnte ich nie vergessen und kaum verzeihen. Nur so kann man verstehen lernen, was für eine Todeskrankheit Antisemitismus ist und was die fühlen, in deren Familien diese Pest den Tod getragen hat.
Frieden! Wir können unsere Hand nicht ausstrecken zu den Opfern dieses Grauens. Heute weiß ich es — wir haben mit unseren besten Eigenschaften die Mauer getragen, hinter der das Verbrechen Wirklichkeit wurde. So bleibt uns — gerade denen, die vor ihrem Gewissen bestehen können — nur das Entsetzen und die Beschämung.
Und die andere Seite, die der Millionen Opfer? Wenn sie nicht vergißt, uns nicht verzeiht, so ist das ihr menschliches Recht, das niemand, schon gar nicht wir, in Frage stellen darf. Aber in eine Zukunft, die irgendwann einmal zum Miteinander kommen soll, kann das nicht führen.
Auf „meiner Seite“ gab es zu viele Anständige, Saubere, Tapfere, die den Herrgott und die Geschichte bitten dürfen, ihnen nach dem Bibelwort zu verzeihen, „daß sie wirklich nicht wußten, was mit ihnen getan wurde“.
Der Autor, General a. D., war Armeekommandant des Bundesheeres. Der Beitrag zitiert auszugsweise seine am 25. Oktober 1987 bei der Gedenkstunde „Schalom für Osterreich — Wege in die Zukunft“ in Wien vorgetragenen Erinnerungen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!