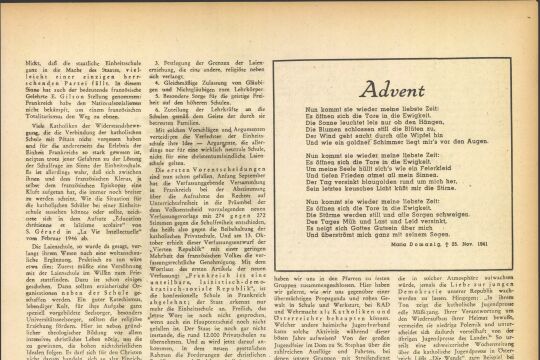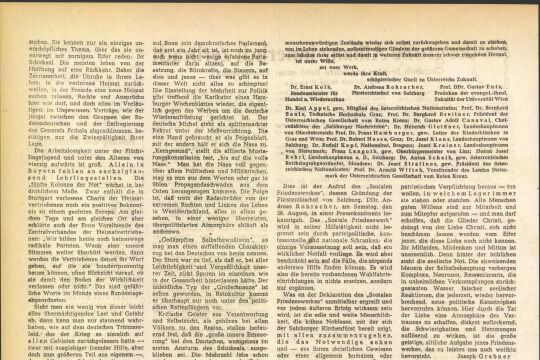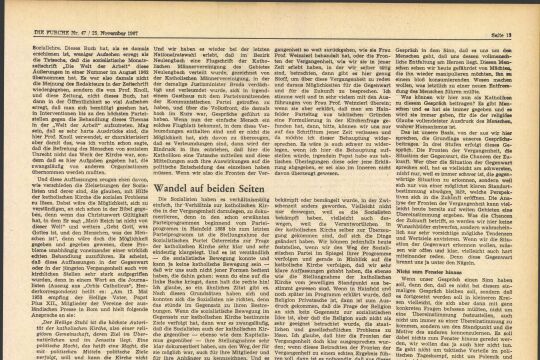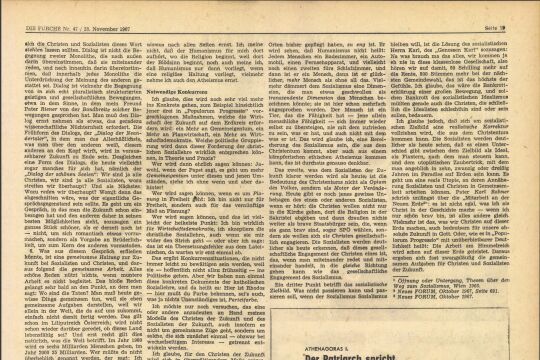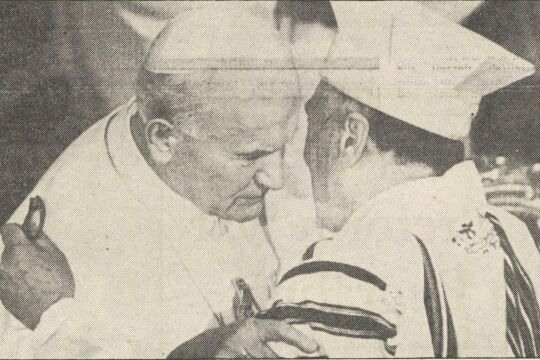Norbert Greinacher: Ich glaube, daß wir im Gespräch von der unabdingbaren Voraussetzung ausgehen, daß Möglichkeiten der Versöhnung zwischen Polen und Deutschen gesucht und gefunden werden müssen. Diesem Bemühen aber stellen sich sowohl in deinem wie in meinem Volk zunächst einmal sehr erhebliche Schwierigkeiten in den Weg. Wenn ich von der Situation in meinem Lande ausgehen darf, dann wird es wohl vor allem der Standpunkt des Rechtsdenkens sein, der viele Probleme aufwirft und das ganze Bemühen in eine falsche Richtung drängt. Denn es wird mir immer klarer, daß das Pochen auf einen formalen Rechtsstandpunkt, selbst wenn es so etwas wie ein formales Recht auf Heimat gäbe, angesichts der jüngsten Geschichte, wie sie sich zwischen unseren beiden Völkern ereignet hat, vollständig inadäquat ist. Dieses Pochen auf das Recht auf Heimat versperrt einfach zunächst einmal für weite Kreise in meinem Volk den Gedanken an einen echten Ausgleich oder, besser gesagt, an eine echte Versöhnung. Allerdings wird man sagen und feststellen können, daß die Fragwürdigkeit dieses Rechtsdenkens sich gerade in letzter Zeit doch recht deutlich herausgestellt hat. Ich darf in diesem Zusammenhang an die Stellungnahme der Evangelischen Kirche in Deutschland erinnern, die zwar sicher nicht ohne Kritik geblieben ist, sogar nicht einmal ohne Kritik aus den eigenen Reihen der Evangelischen Kirche, die aber doch auch weitgehende Beachtung und Zustimmung über die Evangelische Kirche hinaus gefunden hat. Es bahnt sich also hier, wenn ich richtig sehe, doch so etwas wie eine gewisse Entkrampfung, eine gewisse flexiblere Denkart an. Es würde mich nun interessieren, wie es denn bei dir steht, in deinem Land, wie sich dort die Situation darbietet, ob es nicht auch dort bestimmte psychologische Schwierigkeiten, bestimmte ideologische Standpunkte gibt, die sich einer solchen Versöhnung zunächst einmal in den Weg legen.
Stanislaus Kluz: Ich glaube, wir müssen von der Tatsache ausgehen, daß wir, obwohl schon 20 Jahre vergangen sind, noch keinen Schritt zur Versöhnung getan haben. Im Gegenteil — wir nähern uns seelisch eher der Situation der dreißiger Jahre. Und diese Situation ist verhängnisvoll für die Völker der Gegenwart wie für die kommenden Generationen.
Man kann nicht ungestraft diesen inneren Sprengstoff der Feindschaft, des Hasses lange in sich tragen und als Erbe den kommenden Generationen überliefern. Ich bin dir dafür dankbar, daß du meinen Gedanken entgegenkommst, und ich werde mich bemühen, daß aus unserem Gespräch etwas entsteht. Das Spezifische unserer Situation liegt darin, daß wir beide irgendwie unsere Völker repräsentieren, daß wir hier ähnliche Aufgaben haben und daß wir beide in der Fremde sind. Wir haben also die notwendige Distanz zu den Problemen. Zunächst wollen wir uberlegen, welche politischen Hindernisse sich der Versöhnung unserer Völker entgegenstellen: das ist vor allem dieses Rechtsdenken, das Denken vom Recht auf Heimat, das Problem von der Wiedergewinnung der Gebiete jenseits der Oder-Neiße-Grenze. Das Gespräch zwischen dem „Spiegel“-Korrespondenten und dem Präsidenten des Vertriebenenbundes, Jaksch, ist ein Phänomen dafür. Unter dem Titel „Polen aus Schlesien nach Frankreich“ wird jenen in Schlesien angesiedelten Polen der Vorschlag gemacht, in den nordfranzösischen Kohlengruben Arbeit zu suchen. Ebenso grotesk finde ich die Reaktion Philipp von Bismarcks auf die Denkschrift der Evangelischen Kirche in der Wochenzeitung „Die Zeit“. Ich glaube, beide Auffassungen sind nicht typisch, sie sind eher grotesk. Aber in einem Land, in dem es keine einzige Familie gibt, die nicht jemanden im Grauen des zweiten Weltkrieges verloren hat, in einem Land, das jahrelang die Verachtung, die Vernichtung und den Tod erlebte, rufen solche Äußerungen die Geister der Nacht. Ich staune, wie deutsche Staatsmänner vor den Wahlen mit der Vergangenheit spielten, indem sie die Wiedergewinnung jener Gebiete jenseits von Oder und Neiße dem deutschen Wähler schließlich in Aussicht stellten. Diese unbekümmerte Stellung deutscher Politiker der Vergangenheit gegenüber ist für den Polen wie eine Drohung, sie ist das Hindernis.
G.: Darf ich dazu gleich etwas sagen? Ich glaube tatsächlich, daß man die in diesem „SpiageT'-Interview dargelegten Gedanken nicht als repräsentativ für die öffentliche Meinung in der Bundesrepublik bezeichnen darf. Sicher werden sie von einigen Kreisen, vor allem von Funktionärskreisen aus bestimmten Vertriebenen-organisationen, geteilt, aber man kann sie, glaube ich, nicht als typische Meinung des deutschen Volkes ansehen, was ja unter anderem auch die Leserbriefe an den „Spiegel“ zu diesem Interview gezeigt haben.
K.: Wesentlich ist für mich, wenn wir den Tatsachen ins Auge schauen. Du und alle Deutschen, die guten Willens sind, sollen wissen, daß es nicht der Haß ist, der unser Verhältnis zu Deutschland bestimmt. Es bestehen zwar gewisse stereotype Formeln bei uns, wie etwa: „Deutsche sind lauter Aggressoren“, oder: „Die Deutschen sind als böses Prinzip vom Himmel gefallen“ usw., aber davon distanziere ich mich und viele andere.
Wir beide indenti/izteren uns irgendwie mit der Vergangenheit unserer Völker. Wir teilen ihren Ruhm, aber wir tragen auch ihre Schande. Es werden oft Zahlen verglichen, man hört oft, daß mehr als eine Million Deutscher — die Schuld wird auch den Polen aufgelastet — im Zug der Vertreibung auf der Flucht ermordet worden sind.
Mag sein, ich schäme mich der Bestialität. Aber es besteht ein Unterschied zwischen dem — wie du sagst — Unrecht, das dem deutschen Volke zugefügt wurde, und dem Unrecht, das mein Volk getroffen hat: diese Millionen Menschen sind auf der Flucht zugrunde gegangen, das Kriegsgeschehen war noch im Gang. Der jahrelang verachtete Mensch meines Volkes handelte aus dem Trieb der Vergeltung. Es war der Fluch der bösen Tat. Der Mensch war für Augenblicke dem Dämon verfallen. Demgegenüber waren die Menschen meines Volkes zum Tode verurteilt allein wegen ihrer Geburt, deshalb, weil sie Polen waren. Ihre einzige Schuld war es, daß sie Polen waren. Kann man das vergleichen?
Man erkennt diese Tatsache in der Bundesrepublik Deutschland zwar an, aber auf eine eigentümliche Weise: Es wären die bösen Nazis gewesen, die SS, die Gestapo. Und man ist äußerst bemüht, sie zu erfassen und zu bestrafen. Die Verbrecher erhalten Strafen, die eher einem Verkehrssünder unter Alkoholeinfluß angemessen sind, wenn sie nicht überhaupt freigesprochen werden. Man bewältigt die Vergangenheit mit der Justiz, aber die Vergangenheit läßt sich nicht so bewältigen. Sie liegt in anderen Dimensionen. Stand denn nicht das ganze Volk irgendwie hinter den Verbrechern? Zu der Ausrottung von sechs Millionen Landsleuten war doch ein Riesenapparat notwendig. Die kleinen Leute waren nötig für den Massenmord. An der Massenvernichtung beteiligten sich die Wehrmacht, die Organisation Todt, die Reichsbahn, die IG-Farben, die Großindustriellen, die Akademiker, die Jugend, die deutsche Frau. In der Schule sollte das polnische Kind nicht über 500 zählen lernen.
G.: Was du jetzt gesagt hast, beeindruckt mich sehr. Aber ich hoffe, daß du es richtig verstehst, wenn ich dir sage, daß ich mich im strengen Sinn des Wortes an diesen ungeheuren Greueltaten, die im Namen des deutschen Volkes durch das deutsche Volk begangen wurden, im eigentlichen Sinne nicht schuldig fühle. Ich selbst war 13 Jahre alt, als das Naziregime zusammenbrach. Ich konnte keinen Einfluß nehmen. Aber was ich unbedingt empfinde, das ist das, was Bundespräsident Theodor Heuß einmal gesagt hat: daß wir eine Kollektivscham empfinden müßten. Und in diesem Sinne bedrückt mich die Schuld des deutschen Volkes am polnischen Volke zutiefst. Es ist genauso, wie wenn mein Vater ein schweres Verbrechen begangen hätte und...
K.: Darf ich dich unterbrechen? Wir sind beide einig. Du brauchst mir das nicht zu sagen. Ich schäme mich auch dieser Verbrechen, die an deinen Brüdern vorgenommen wurden während der Flucht. Ich glaube, wir müssen darüber nicht reden.
G: Ja, aber dennoch muß es einmal gesagt sein. Man kann das nicht auslöschen.
K.: Verstehst du, auch die Schuld ist nicht etwas Absolutes. Oft gab es nur, ich meine im Dritten Reich, die Alternative zwischen Bestialität und Heldentum, und man muß sich eher fragen, wie es dazu kam. Das wäre fruchtbarer als die Deskription des Geschehenen. Die Schuld liegt vielmehr in dem Zulassen. Die Schuld liegt weit in der Vergangenheit zurück, und diese Schuld der Vergangenheit ist größer, glaube ich, als die Schuld der einzelnen Henker.
G.: Ja, aber dennoch liegt die Schuld sozusagen als Wirklichkeit immer wieder vor uns. K.: Ja, sie lastet auf uns. G.: Als Wirklichkeit. Und wir müssen um diese grauenvolle Möglichkeit wissen, die auch in Zukunft über uns hängt, und wir müssen beide daran arbeiten, daß diese Möglichkeit auf keinen Fall wieder realisiert wird.
K.: Ich erinnere mich an die Begegnung mit einer Gruppe der „Pax Romana“, die vor fünf Jahren zu mir kam und die unbedingt Auschwitz besuchen wollte. Es war eine englische Studentin, eine Jüdin, ein Student aus Bonn, ein Franzose und ein Afrikaner. Die jüdische Studentin brach in Auschwitz zusammen. Ich hatte damals gesagt: „Man muß dieses Verbrechen anderswo lokalisieren, es muß zurückgeführt werden auf das, wozu der Mensch die Möglichkeit hat, man kann es nicht in einem Volk lokalisieren.“ G.: Aber vielleicht müssen wir jetzt tatsächlich unsere Blicke mehr in die Gegenwart beziehungsweise in die nahe Zukunft lenken. Was können wir tun? Wie sieht die Situation aus? Wie denkt die Jugend unserer beiden Völker? Über die Versöhnung, über die Möglichkeit einer Zusammenarbeit?
K.: Leider hatte ich bis jetzt keine Gelegenheit, mit der deutschen Jugend in ein ehrliches Gespräch zu kommen, dafür um so mehr mit der österreichischen Jugend. Doch hier beginnen meine Zweifel. Einerseits begegne ich einer Jugend, einer unschuldigen Jugend im tiefsten Sinne des Wortes, die ihr Herz förmlich auf der Hand trägt. Anderseits mußte ich eine Jugend kennenlernen ... Ich erinnere mich an die Ereignisse aus Anlaß des Falles Borodajkewycz. Es wurde mir schwarz vor den Augen. Es war mir, als ob ich erwachte, als ich die Schreie „Hoch Auschwitz“ auf der Wiener Ringstraße hörte.
G.: Darf ich hier eine Lanze brechen für die Jugend meines Volkes?
K.: Ja, ich glaube dir, ich hoffe auf diese Jugend!
G.: Vielleicht kann ich deine Hoffnungen noch etwas bestärken. Darf ich zunächst ganz kurz an den analogen Fall der Aussöhnung zwischen Frankreich und Deutschland erinnern. Ich glaube, daß das ungeheuer hoffnungsvoll ist. Noch meine Generation ist aufgewachsen, ich will nicht sagen, in einem Haß, aber in einer gewissen Feindschaft gegenüber dem französischen Volk. Heute ist es so, daß die Jugend beider Länder, wenn ich das richtig sehe, eine doch relativ große Sympathie zueinander empfindet. Man erkennt, daß man anders ist, aber gerade dieses andere sucht man und empfindet es als angenehm. Müßte so etwas nicht auch möglich sein in dem Verhältnis der deutschen Jugend zur polnischen Jugend? Und wenn ich dann noch hinzufügen darf: ich habe den Eindruck, daß die ältere Schuljugend und die studierende Jugend, auch meine Generation, mit einem sehr wachen Interesse die Auschwitzprozesse verfolgt hat, sich informieren will über das Ausmaß der Judenverfolgung unter dem Naziregime, daß sie sich wirklich auseinandersetzt mit der Frage, wie so etwas wie der Nationalsozialismus in Deutschland entstehen konnte. Und wenn ich jetzt richtig sehe, ist das nicht nur eine Neugier, eine Sensationslust, sondern es ist ein echtes Fragen, ein banges Fragen... Ich glaube, daß aus einer solchen Beschäftigung — ich denke übrigens auch an das neue Schauspiel „Die Ermittlung“ und das Echo, das es gefunden hat — etwas Gutes erwachsen kann. Aufs Ganze gesehen würde ich dieses Bemühen als sehr positiv deuten. Ich glaube, daß hier ein Ansatz für eine Auseinandersetzung gegeben ist, eine Auseinandersetzung, aus der eine erhöhte Verantwortung für diese Aussöhnung zwischen unseren beiden Völkern erwachsen könnte und, so glaube ich, auch schon im Ansatz gegeben ist.
K.: Von mir aus sehe ich die einzige Möglichkeit zu einer Versöhnung, den einzigen Weg, zu einer neuen Zukunft zu kommen, im persönlichen Gespräch, in der ganz persönlichen Freundschaft. Für mich als Priester führt dieser Weg über die Liebe und über den Dienst an der deutschen Jugend. Diesen Weg versuche ich zu gehen, erst das wird sie überzeugen. Ich sehe aber auch, daß deutscherseits Erfreuliches geschieht. Hier meine ich die Denkschrift der Evangelischen Kirche, die ich sehr begrüße. Es ist nur sehr bedauerlich, daß zur Zeit von der katholischen Kirche keine derartige Stellungnahme erschienen ist, es fehlte nicht an Gelegenheiten.
G.: Das ist eine Sorge, die uns, glaube ich, gemeinsam ist. Ich empfinde genauso wie du. Sosehr ich diese Denkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland auch begrüßt habe, sosehr habe ich mich bei der Lektüre dieser Denkschrift gefragt, ob es eigentlich nicht zuerst eine Angelegenheit der katholischen Kirche gewesen wäre, dazu Stellung zu nehmen; Stellung zu nehmen in einem Geiste echter, christlicher
Brüderlichkeit, die nicht beharrt — entschuldige, wenn ich das sage, im Hinblick auf gewisse Äußerungen der polnischen Hierarchie — die nicht beharrt auf dem Standpunkt irgendeiner Nationalkirche, sondern im Geiste echter christlicher Bruderliebe versucht, eine Brücke zu schlagen in dem Bewußtsein, daß man zu einer gemeinsamen Kirche gehört und daß die Kirche eine ungeheure Verantworung hat, sozusagen die erste Brücke zu bauen, die erste Hand hinzureichen — ohne Rücksicht zu nehmen auf irgendwelche Prestigeansprüche, irgendein nationales Denken oder was sonst noch hier im Spiele sein könnte.
K.: Das wäre meiner Meinung nach die Verwirklichung dessen, was wir Ökumenismus nennen, wenn unsere Kirche in ein ehrliches Gespräch über dieses Thema käme.
G.: Vielleicht ist es so — wenn ich das einschieben darf —, daß sich die Laien über diese Fragen besser und leichter verständigen können, als dies manchmal zwischen den hierarchischen Würdenträgern der Fall zu sein scheint.
K.: Bis zu diesem Moment habe ich in meinem eigenen Namen gesprochen, und ich frage mich hier, inwieweit ich im Auftrag meines Volkes reden darf. Denn es gibt vieles, für das ich nicht zuständig bin. Ich darf nicht im Auftrag derer reden, deren Asche die Felder von Auschwitz und Majdanek düngen. Ich kann nicht im Auftrag derer reden, deren Haar bis heute noch in Bergen dort liegt, denn aus den Haaren der Frauen meines Landes fabrizierte eine deutsche Firma Matratzen für die deutsche Wehrmacht. Auch für jene Kinder fehlt mir die Zuständigkeit, die — außerhalb jedes politischen Geschehens — zum Opfer des Hasses und der Bestialität wurden, deren Spielzeuge man noch heute hoch aufgetürmt besichtigen kann.
Überdenkt man das alles, so dürfte es doch keine allzugroße Mühe kosten, die deutsche Jugend zu einem neuen Verhältnis zur jungen Generation Polens zu gewinnen.
G.: Ich glaube auch, die einzige Konsequenz, die wir aus allen diesen unwahrscheinlichen Greueln, aus der unwahrscheinlichen Schuld, die auf unseren Völkern lastet, ziehen können, ist die, daß wir nach vorne schauen und alles, aber auch wirklich alles einsetzen, damit die Zukunft sich anders gestalte als die Vergangenheit. Wir sind aufeinander angewiesen. Wir sitzen tatsächlich in einem Boot. Wir können nicht aussteigen. Wir sind gleichsam in dem Zimmer, in der geschlossenen Gesellschaft, von der Sartre gesprochen hat. Wir können nicht hinausgehen. Das, was wir machen können, ist, daß wir Leben und Zukunft unserer beiden Völker auf die Basis des Vertrauens und der Brüderlichkeit stellen. Wir müssen sozusagen unsere Zuflucht zur Zukunft nehmen, und es gibt eigentlich keine andere Lösung als diese Flucht nach vorne in die Brüderlichkeit.
K.: Ich möchte mich noch korrigieren. Ich sagte: deine Jugend. Ich möchte jetzt sagen: unsere Jugend. Unserer Jugend möchtest du von mir meine Bereitschaft überbringen und meine Bitte.