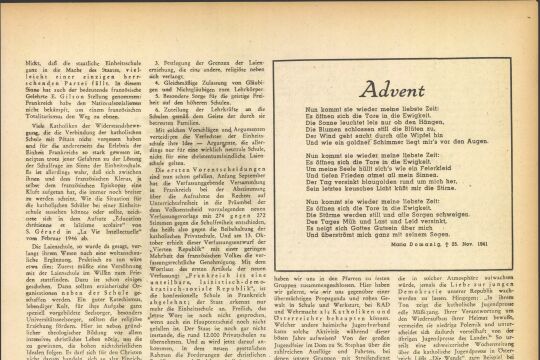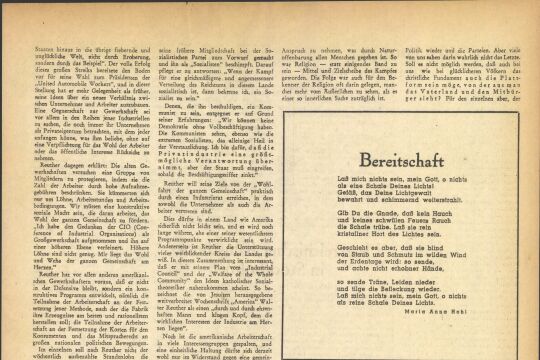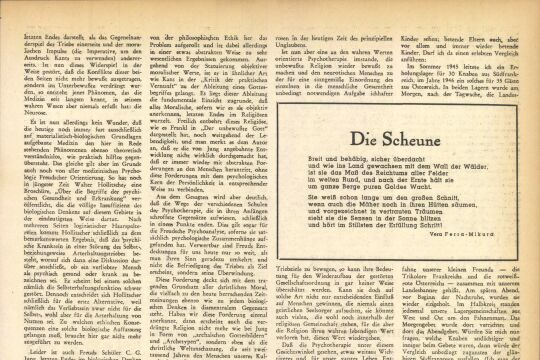Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Was nun…?
Frau Professor Dr. Klara-Marie Faßbinder, die rheinische Romanistin, ist in früheren Jahrzehnten vor allem durch ihre Bemühungen um eine Begegnung zwischen deutschem Geist und dem Westen bekannt geworden. Ueber ihre freundschaftlichen Begegnungen mit Paul Claudel und vielen anderen Persönlichkeiten, zumal des französischen Geisteslebens, hat sie in ihren Arbeiten und Essays mehrfach berichtet. Nach dem zweiten Weltkrieg wandte sich Frau Professor Faßbinder dem Osten zu und gehört als Teilnehmerin von Konferenzen und Tagungen der östlichen Welt zu den bekämpftesten Persönlichkeiten des westdeutschen Katholizismus. Die „Furche“ will ihren Lesern diese ihr zugekommene Stellungnahme nicht verschweigen: mit ebensoviel Distanz von ihrer politischen Position wie aufrichtigem Respekt vor dem Wagemut dieser Frau. Die Redaktion
Frau Professor Dr. Klara-Marie Faßbinder, die rheinische Romanistin, ist in früheren Jahrzehnten vor allem durch ihre Bemühungen um eine Begegnung zwischen deutschem Geist und dem Westen bekannt geworden. Ueber ihre freundschaftlichen Begegnungen mit Paul Claudel und vielen anderen Persönlichkeiten, zumal des französischen Geisteslebens, hat sie in ihren Arbeiten und Essays mehrfach berichtet. Nach dem zweiten Weltkrieg wandte sich Frau Professor Faßbinder dem Osten zu und gehört als Teilnehmerin von Konferenzen und Tagungen der östlichen Welt zu den bekämpftesten Persönlichkeiten des westdeutschen Katholizismus. Die „Furche“ will ihren Lesern diese ihr zugekommene Stellungnahme nicht verschweigen: mit ebensoviel Distanz von ihrer politischen Position wie aufrichtigem Respekt vor dem Wagemut dieser Frau. Die Redaktion
Sehr geehrter, lieber Friedrich Heer!
Natürlich habe ich Ihren Artikel „Willkommen in Wien, lieber Genosse!“ mit Interesse gelesen. Gleich zweimal, damit mir nicht etwa die Feinheiten entgingen. — Beim Lesen fiel mir die Sorgfalt auf, die Sie, lieber Friedrich Heer, darauf verwendet haben, nur eine Gruppe unserer Teilnehmer zu begrüßen, die aus der Sowjetunion. Sie erscheinen Ihnen als die wichtigsten. Ich komme gerade von einer „Sozialen Woche der Katholiken Frankreichs" über das Problem der „unterentwickelten Länder“, die man dort richtiger als die „unterindustrialisierten oder untertechnisierten“ bezeichnete! Es waren viele Afrikaner da. Ich glaube nicht, daß man dort Ihre Rangordnung hätte gelten lassen. Ich glaube auch nicht, daß unsere jungen sowjetischen Freunde sie gelten lassen werden.
Es fiel mir aber auf bei Ihren freundlichen Worten an deren Adresse, die so abstechen gegen den Ton, den Sie gegen deren Gesinnungsgenossen in Oesterreich anschlagen, die gar nichts anderes wollen als die in der Sowjetunion auch. Es fiel mir aber noch etwas anderes ein, das ich am gleichen Morgen gelesen hatte, der „Gruß an die Jugend der Welt“ im „Kurier“, in dem man — diesmal auch in der von Ihnen sonst, mit Recht vermißten russischen Sprache — den Festivalteilnehmern in äußerst freundlicher Weise — ich möchte sagen mit Wiener Gemütlichkeit — entgegenkam und sie wegen etwaiger Steinwürfe beruhigt.
Sowenig mich der viersprachige Artikel im „Kurier“ verwundert hat, höchstens insofern er trotz allem den verabredeten Bann des Schweigens gegenüber dem Festival gebrochen hat, so sehr wunderte mich Ihr Artikel und schmerzte mich. Ihr Blatt hat damals zu Beginn der Vorbereitungen meiner Leserzuschrift Raum gegeben, in der ich für die Teilnahme der Katholischen Jugend Oesterreichs bei dieser Veranstaltung warb.
Warum hat die österreichische Jugend nicht diesen Pfad beschritten? Dann brauchten Sie nicht darauf hinzuweisen, daß Ihr Towarischtsch natürlich keine Zeit fände, die Selbstdarstellung Ihrer Jugend sich anzusehen. Diese würdt zweifellos auch russische Beschriftung zeigen und — sie würde einen Bestandteil des Festivalprogramms bedeuten, die im Heft unter den anderen Ausstellungen stände. — Nach meinen Erfahrungen in Warschau und den flüchtigen in Moskau üben die Ausstellungen zwar nie die Anziehungskraft der sportlichen und künstlerischen Veranstaltungen aus, ja nicht einmal die der Auseinandersetzungen, zu denen übrigens durchaus nicht nur die „Kaders“ kommen, wie Sie anzunehmen scheinen. Aber immerhin, es wäre einfacher als jetzt, wo sicher auch der eine oder andere der Festivalteilnehmer hingehen wird, so wie schon einige in Ihren „Informationsstellen waren. — Aber nicht die Menge. Aber glauben Sie wirklich, mit diesen Mitteln käme man dem Ziel näher, das Ihnen als ein besonders wichtiges erscheint: der Verständigung mit der Sowjetunion, den Jungen und den Alten dort? Gerade Ihr eigenes Beispiel, wie in langer, mühevoller Arbeit der österreichische Staatsvertrag zustande kam, gibt doch ein Gegenbeispiel. Ihre Landsleute haben das anfängliche Mißtrauen der Sowjets sicher nicht durch solche massiven oder versteckten Beleidigungen zu lösen angefangen, noch beendet, wie sie die österreichischen Artikel und Handlungen zum Festival bieten. Ganz im Gegenteil. Lesen Sie einmal die kleine Schrift über die Staatsvertragswoche in Moskau. — Eine Woche, lieber Friedrich Heer, die der damalige Dolmetscher davon gibt. (Unionsverlag Wien.)
Da herrscht ein anderer Ton. Halten Sie uns und die Jugend doch nicht für so töricht, daß wir glauben, mit einer solchen Woche die gegenwärtig drängenden politischen Probleme zu lösen. Genf würde uns an einer solchen Naivität hindern. — Daß allerdings die westliche Jugend heimkehrt in ihre Länder mit dem neugefaßten oder bestärkten Entschluß, eine andere Politik als ihre Väter zu machen, das hoffen wir sehr! Ich wünschte, Sie, lieber Friedrch Heer, wären auf der schon genannten Sematne Sociale in Angers gewesen. Mit welcher Klarheit wurde da von verschiedenen der ausgesuchten Redner erklärt, daß die Probleme der noch
„Furche“ Nr. 30 2.. Juli 1959.
in der Entwicklung begriffenen Völker, daß vor allem das Problem des Hungers in der Welt mit dem gegenwärtigen Wirtschafts- und Gesellschaftssystem nicht zu lösen sei!
Warum haben Sie solche Furcht vor dieser Umwandlung? Es kommt darauf an, daß diese Umwandlung, in der wir stehen, so wenig unnötige Opfer fordert wie möglich. Das sollte unsere, der Christen, Aufgabe sein. — „Feuer bin ich gekommen, auf die Erde zu werfen. Was will ich anders, als daß es brenne!“
Aber Ihre eigentliche Sorge, Ihre eigentlichste ist vielleicht nicht die Verständigung zwischen Oesterreich und der Sowjetunion, sondern die Sorge um das, was Sie „verfolgte Kirche“ nennen. Ich kann mich zu diesem Ausdruck in bezug auf die osteuropäischen Länder nicht entschließen, die anderen kenne ich nicht genug. Es gibt dort eine bedrängte Kirche, eine eingeengte, der man helfen möchte, ihr und den Staaten, in denen sie lebt. Jedesmal unter anderen Umständen, in einem anders geformten Staat. Die Gründe dafür sind mannigfach, durchaus nicht nur beim Staat — aber wenig ist ihr mit Reden, geholfen. Und — Hand aufs Herz: Was t u n wir westlichen Katholiken wirklich für diese Kirche? — Wenn wir sie wirklich für gefangen halten, so wäre unsere erste Pflicht, sie zu besuchen — siehe die Seligpreisungen. Aber wir bleiben zu Hause und überlassen solche Be suche unseren protestantischen Glaubensbrüdern. Wir verschmähen die Möglichkeiten, Kontakte aufzunehmen, auch wenn sie uns vor die Tür gelegt werden. Jawohl, verehrter Friedrich Heer und die ganze „Furche“ dazu! Gerade dieses Festival hätte die Anbahnung von Besuchen, von Gesprächen, die Möglichkeit auch der Aussprachen mit den staatlichen Stellen dieser Länder gefördert, wie ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen kann. — Haben Sie nie daran gedacht? Ihrer kirchlichen Behörde habe ich diese Gedanken, auch jene, die sich auf die Teilnahme der afrikanischen Jugend bezogen, geschrieben. Aber was hilft das schon? — Ich fürchte, Ihr Towarischtsch wird Ihnen antworten: „Schön und gut, daß Sie mit uns ins Gespräch kommen wollen, auch über heikle Fragen. Aber warum verschmähen Sie dann meine ausgestreckte Hand?“
Was wollen Sie darauf erwidern?
Es wäre noch sehr viel zu Ihrem Artikel zi sagen, auch zu dem, was Sie über Begegnungen an den Grenzen sagen. Wissen Sie eigentlich nicht, daß ungarische Jugend hier ist und daß Ihre Jugend sich mit dieser selbst hätte unterhalten können? Meinen Sie nicht, Ihre Anspielung auf die Ereignisse in Ungarn würde Jakob Burckhardt ein wenig unter die der „terribles simplificateurs“ rechnen? Ich hatte zufällig damals Gelegenheit, ausländische Berichte, zum Beispiel der „Times“ von Wien aus über die Ereignisse zu lesen, auch mit Wienern, die im Jänner 1957 mit mir nach den USA fuhren, über diese Dinge zu sprechen. Das klang ganz anders, ganz abgesehen von den zahlreichen vertraulichen Gesprächen mit namhaften Katholiken, die ich im Februar 1958 in Budapest hatte. S o, verehrter Friedrich Heer, sollte man mit einem so vielgesichtigen Ereignis nicht umgehen! Und vor allem sollte man der Jugend, die hierhin kommt, nicht die Politik ihrer Väter anrechnen. Das verschiebt die Ebenen und kann zu nichts Gutem führen.
Aber der gestrige Sonntag hat mir noch einen anderen Gedanken nahegebracht, den ich Ihnen nicht verschweigen möchte. Nämlich die Anwendung des Sonntagsevangeliums auf unseren ganz konkreten Fall: das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Ich weiß, daß Sie mit mir der Ueberzeugung sind, daß jene Gleichnisse für jede Zeit gegeben wurden. Würde man nach dem Verhalten der österreichischen Jugend und leider auch Ihres Artikels die Worte des Pha risäers nicht dahin abwandeln: „O Gott, ich danke Dir, daß ich nicht bin wie die Räuber, Mörder, Ehebrecher oder auch wie diese Festivalteilnehmer — oder zum wenigsten die Verantwortlichen für dieses Festival.“
Das weitere überlasse ich Ihnen. Meinen Sie nicht, wenn die christliche Welt der nichtchristlichen, oder richtiger, der nicht mehr christlichen Welt gegenüber sich etwas mehr auf das Grundgesetz ihres Glaubens besänne, d i e Liebe, Caritas, Agape, daß wir dann weiter wären, als wir heute sind?
Sie, verehrter Friedrich Heer, haben über diese Beziehungen, über den „Umgang mit dem Feinde“ tiefe und aufrüttelnde Worte gefunden. Ich bitte Sie herzlich, die Gelegenheit des Festivals zur Anwendung Ihrer eigenen Grundsätze nicht zu vergessen. Wir wären Ihnen alle t dankbar dafür.
Und nun hoffe ich, daß diese Antwort in der .Furche“ als Leserzuschrift veröffentlicht wird.
Ihre
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!