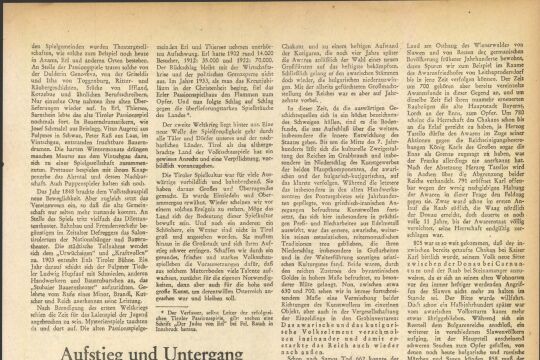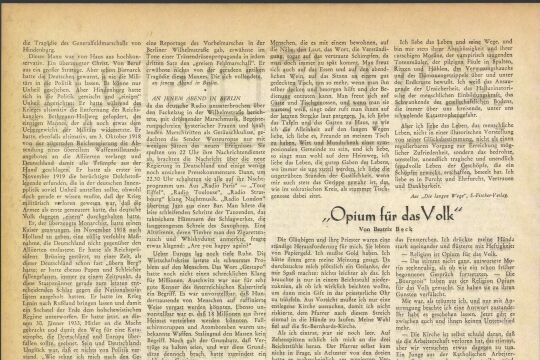Vertrauensvoll HINGEGEBEN
Das umspannende Prinzip des Lebens in all seinen Facetten ist Hingabe und Vertrauen in das immer Werdende. Ein Versuch des Nachspürens.
Das umspannende Prinzip des Lebens in all seinen Facetten ist Hingabe und Vertrauen in das immer Werdende. Ein Versuch des Nachspürens.
"Stronzo", sagt mein Freund Luciano zu mir, und ich weiß, ich bin endlich angekommen. Luciano sieht mich an, streng, amüsiert und dankbar. "Stronzo", wiederholt er noch einmal, hilflos, zärtlich. Die Worte sind mein Triumph. Eine plötzliche Welle von Dankbarkeit hüllt mich ein. Ich bin da, lebendig, mitten in der Wirklichkeit. Jetzt, am abgewetzten Metall des Tresens in der Bar Sport in Varese Ligure. Ich habe Luciano den Gefallen getan, ihn zu einem Sandwich einzuladen, nichts weiter. Zu einem Espresso hinterher. Nach drei Monaten, die ich schon in Italien lebe. Drei Monate, in denen ich mir an Luciano die Zähne ausgebissen habe.
Bei Szenen wie dieser: "Ich lade dich ein.""Nein, kommt überhaupt nicht in Frage." Schon liegt das Geld auf dem Bartisch. Ich bin zu spät. Zu langsam. Und dieser: "Lass uns wenigstens halbe-halbe machen." Ein abwesendes Lächeln. In der Hand des Kellners klimpern schon die Euros. Oder dieser: Ich gehe auf die Toilette, die Gläser, denke ich, sind eben erst bestellt, quasi voll. Es kann also nichts passieren. Ich werde nachher meine Chance haben, zum Zuge zu kommen. Als ich dann, vor dem Abschied, bogenschnell gespannt wie ein Jäger beim Angriff, vor Luciano zum Tresen eile, siegesgewiss, ist die Zeche schon bezahlt. Es ist ein sardonisches Spiel, das ich immer verliere, immer. Meine Geldbörse behält ihre Füllung und meine Scham wächst.
"Stronzo." Diesmal habe ich vorausgedacht. Ich habe Walter, den Wirt, instruiert. Eine elegante Falle. Ich habe Walter carte blanche gegeben: "Was auch immer wir essen und trinken, ich bezahle es dir hinterher. Du behauptest in jedem Fall Luciano gegenüber, wie sehr er auch insistieren sollte, die Rechnung sei schon beglichen." Klar hat Walter mitgemacht, ein unschuldiges Lächeln auf dem Gesicht.
Luciano hat mir das Geschenk gemacht, dass ich ihm etwas geben durfte. Ich hingegen bin reich. Ich habe ein Opfer gebracht und: Ich lebe. Im Geben lag eine tiefe Befriedigung, ein Glück, das zur sirrenden Sonne passte, zur Leichtigkeit der warmen Luft am Mittag, zur schwerelosen Freude, welche die ligurischen Hügel an schönen Frühsommertagen ausstrahlten, wenn alles geschenkt war und mir die ganze Welt gehörte.
Der Schmerz der Gabe
Die Lehre der Großzügigkeit besteht darin, dass es mich lebendiger macht, wenn ich etwas fortgebe, was mir später wirklich fehlt. Es macht glücklich, dass mich die Freude des anderen etwas gekostet hat. Um Leben zu spenden, ist es nötig, dass das, was ich, ein Teil von meinem eigenen Leben sein muss. Etwas, dessen Fehlen ich spüre, dessen Verlust meine eigene Freiheit beschränkt. Geben ist der äußerste Akt des Vertrauens.
Solche Überlegungen fallen im sommerlichen Italien leichter als in nördlicheren Gefilden. Es ist einfacher, wenn man im flirrenden Licht lebt. Dann ist es eine unmittelbare Erfahrung der Sinne, dass Großzügigkeit, ja Verschwendung die richtige Haltung zum Leben ist. Beschenkt zu sein ist die überwältigende Erkenntnis der Haut, wenn das Licht an einem Sommermorgen den Körper badet.
Für Albert Camus, geboren in Algier, hatte seine Philosophie ihren Ursprung in der Sonne des Südens und ihrer Freigiebigkeit. Sie war für ihn nicht nur Entschädigung für die Härten einer Kindheit in Armut, sondern verkörperte das Prinzip, unter dem eine Versöhnung mit diesen Härten denkbar ist.
Das Licht ist geschenkt. Das Licht ist der Inbegriff dessen, was gratis und ohne Hintergedanken verteilt wird. Die Sonne spendet ihre Wärme und verschwendet dabei sich selbst. Darum war Camus, nachdem er aus Algerien in Paris eintraf, schockiert. Ihm kam es vor, als würde er, der selbst aus denkbar schlichten Verhältnissen stammte, erst jetzt wahre Armut kennen lernen, hier, eingesperrt unter einem grauen und regenschweren Himmel. Die Armen des Südens seien immerhin Beschenkte des Lichts und so mit der Kraft des Existierens verbunden.
In der Natur ist alles Geschenk. Von der Sonnenwärme bis zur Nahrung, die sie uns gibt, von den Möglichkeiten tieferen Selbstverständnisses bis hin zur Freude, die sie uns schenkt, verströmt sie sich als eine voraussetzungslose Gabe. "Wer gibt", sagt der US-Philosoph Lewis Hyde, "ist willens die Kontrolle aufzugeben und einen Kreislauf zu befördern, der das Leben unterstützt". Beispiele für eine Kultur der Gabe fand Hyde bei archaischen Gesellschaften. Die Kultur der Gabe basiert stets darauf, dass die Natur als die Quelle eines grundlos verteilten Geschenks verstanden wird. Leben ist Geschenk - und nicht, wie bei uns spätestens nach dem Siegeszug des Vulgärdarwinismus -im Krieg aller gegen alle erkämpftes Verdienst.
Ein archaisches Prinzip
Viele Völker, die in einer Balance mit der Natur leben, fühlen sich beschenkt -und stehen umgegekehrt ihr gegenüber in Schuld. Das ist Kern des archaischen Rezepts für die Schonung natürlicher "Ressourcen". Was zum Leben dient, wird als Gabe verstanden, nicht als Güter für den eigenen Vorteil. Viele archaische Völker haben es sich folglich auferlegt, der Wildnis, deren Bewohner die Menschen mit ihrem eigenen Leib speisen, real etwas zurückzugeben.
Hyde berichtet von einem Maori-Volksstamm, dessen Angehörige regelmäßig Teile ihrer Jagdbeute und Feldernte in den Wald tragen, um dessen produktive Kraft auf eine symbolische Weise zu nähren. Dort zerfallen die Speisen, werden von Tieren verzehrt und von Pilzen verwandelt - und gehen tatsächlich wieder in den Kreislauf des Werdens und Verschwendens ein.
Die Mitglieder einer solchen Kultur wissen, dass der "Kreis der Gabe" nicht unterbrochen werden darf, wenn nicht die nährenden Kräfte der Natur versiegen sollen. Hyde sieht, dass ein solches Handeln keine nette kulturelle Folklore ist, sondern einer tieferen ökologischen Einsicht folgt.
Der Mainstream im Evolutionsdenken geht davon aus, dass alle Strukturen und Verhaltensweisen im Lebensreich das Ergebnis der Kosten-Nutzen-Beziehung sein müssten. Leistungswettbewerb ist bislang unangefochtenes Dogma auch im biologischen Denken. Der Evolutions-Mainstream passt seine Analysen dieser Prämisse an. Er stülpt der Wirklichkeit die Nöte einer Gesellschaft über, in der die Lebensfreude in einem Netz aus Geiz und Verdrängung zu ersticken droht. Aber ist es so?
Sommergeschichten
Es war Juni, und die Glühwürmchen tauchten auf. An einem stillen Abend stieg ich mit dem Hund den schmalen Weg durch die brusthohen Gräser auf den Wiesen hinauf in die Hügel. Die Halme vibrierten leise in der Nacht. Am Ende der Stiege beim Friedhof sah ich auf - die Glühwürmchen füllten die Luft über den Bäumen. Sie flogen wie kleine eifrig durch den Raum tanzende Sterne blinkend auf und ab. Ihr Licht mischte sich mit den Silberpunkten der Himmelskörper im dunklen Weltraum, so dass verschwamm, was Stern war und was Leuchtinsekt. Es wirkte, als würden die Sterne zwischen die Halme sinken und die glimmenden Tiere ins All emporsteigen. Für eine kurze Sekunde hatte ich meinen Kopf ins All hinausgestreckt.
Was ich sah, war ein Fest der Fortpflanzung und des Verschlungenwerdens. Ich blickte zwischen die Sterne -und nahm an einem Reigen teil, in dem die Teilnehmer ihre Leiber in Ekstase den anderen zur Verwertung zur Verfügung stellten. Die Leuchtinsekten tanzten durch die Nacht, um eine Genossin zur Paarung zu finden - und wurden dabei von späten Vögeln und dann Fledermäusen verschlungen. Alles verschenkte sich, ohne darüber nachzudenken, ohne darüber zu einem Gedanken auch nur fähig zu sein. Und es war kein Unfall, dass es so herging, kein bedauerlicherweise nicht erreichtes Optimum.
Allein im nächtlichen Tanz des Fressens und Gefressenwerdens konnte sich diese glitzernde Fülle realisieren. Die Gabe war notwendig, damit das Ganze existieren konnte. Das Geschenk, die selbstlose Verausgabung integriert das Individuum und das umgebende Ganze. Das empfangene Geschenk gehört mir ganz - aber es gehört mir nur ganz, um weiter gegeben zu werden. Es gehört mir umso mehr ganz, als ich es ganz weitergebe - so wie der Stoff meines Körpers mir gehört und für mich zugleich unverfügbar ist.
Wir müssen uns mit der Idee anfreunden, dass in der Natur das Gegenteil von Sparsamkeit herrscht: nämlich maßlose, sinnlose Verschwendung. Auch die Wesen, die gerne als "effiziente Jäger" bezeichnet werden, die großen Raubtiere wie Löwen, Pumas und Wölfe, sind erstaunlich ineffizient. Bei Warmblütern wie uns auch gehen mehr als neun Zehntel der Nahrungsenergie allein für die Körperwärme drauf - die Energiebilanz ist ähnlich desaströs wie die eines nicht wärmegedämmten Fertighauses.
So wie die großen Jäger beim Energieverbrauch nicht ein Muster der Effizienz darstellen, so sind sie auch in anderer Hinsicht nicht wirklich angepasst. Sie sind Anarchisten des Selbstausdrucks, Dandys unter den Tieren, die sich Extravaganz leisten können. Streifen und Flecken sind keine Tarnung - sondern ein Warnanstrich. Wer zwischen grünem Gesträuch gelb leuchtet und auch noch ein auffälliges Muster trägt, fällt auf. Ihre Erscheinung ist kein Werkzeug, sondern ein Surplus, ein Überschuss. Das Fellmuster der Raubkatze ist ein Geschenk des Lebens an sich selbst. Die Natur ist sachlich, nur wo sie muss. Wie können wir so ein abgrundtiefes Wunder wie die Eintagsfliege begreifen, heute am Gewässer nicht minder perfekt als der Wolf, vollkommen und endlos genau elaboriert, und nach wenigen Tagen eine leere Hülle? Und was soll uns das Leben des Maikäfers sagen, das ein paar Frühsommertage währt, nach endlosen fünf Jahren Daseinsfrist als Larve in der Erde? Es geht nicht darum, in irgendeiner Weise die Zeit auszunutzen. Es ist vielmehr nötig, durch die Wahl des Wesentlichen die Länge der Zeit, die verbleibt, bedeutungslos zu machen.
Der Sinn des Todes
Die Nahrungskette selbst ist das Extrem einer Beziehung-in-Berührung, einer Beziehung-in-Verwandlung. Aufgrund der höheren Einheit, die aus einer solchen Perspektive der Integrität des einzelnen vorangeht, stand in manchen archaischen Kulturen das Gefressenwerden symbolisch nicht für das Sterben - sondern für die sexuelle Vereinigung. Für die Vereinigung, die wiederum eine Verwandlung ist, deren Ergebnis sich in neuem Leben und einer neuen Individualität niederschlägt.
Die Nahrungskette ist Teil eines schöpferischen Prozesses, ohne den das Ökosystem zerfallen würde. Auch wir Menschen leben nur, weil wir Teil der planetarischen Nahrungskette sind. Und sie ist zugleich die klare Negation der eigenen Individualität. Die schöpferische Freiheit der Natur ist nur möglich, weil sie zugleich das, was anderswo produziert wird, verschlingt. Freiheit hat einen Preis. Und dieser Preis ist der Tod. Das Vertrauensprinzip, dass etwas werde, versucht nicht verzweifelt den je eigenen Tod abzuwenden, sondern gibt sich der Verwandlung hin - und nimmt den darin enthaltenen Schmerz ernst.
Das sollten wir nicht vergessen, wir, die Bewohner von Gesellschaften, die sich das Label "freiheitlich" an alle möglichen Stellen kleben und damit heute meinen: so frei wie ein Käufer mit aufgeladener Kreditkarte in einem Hyper-Markt. Nein, die Freiheit des Lebendigen ist kein Regen von Sterntalern. Sie zeigt sich im Vertrauen auf das Werden, ohne ein Ziel zu sehen. Sie äußert sich im Verhalten des frierenden Mädchens, das sein letztes Hemd herschenkt, um anderen Frierenden zu helfen, und die dafür mit dem Glitzern des Himmels gesegnet wird. Vertrauen ist das, was den Mut erfordert, lebendig zu sein.
Die größte Katastrophe besteht darin, dass wir uns derzeit selbst die Sicherheit nehmen, in einem Kosmos aufzuwachsen, in dem das Leben geschenkt ist. Es nicht so zu behandeln, entspricht einer Versklavung des Schöpferischen, mit der jede Kreation endet.
Begegnung als Kommunion
Vor der alten Eiche im Grunewald, nicht weit vom S-Bahnhof, verblassen die Vorurteile eines Zeitalters, das die Wirklichkeit falsch versteht, weil es sie nicht mehr mit den anderen Wesen teilt. Die Eiche ist bestimmt fünfhundert Jahre als. Braun und Rot schimmern die Rindenborken, grau und blau die Flechten, gelb und grün das Moos. Die erratisch von den Ästen abstehenden Zweige greifen gleichmütig nach der Zeit, während der Stamm nichts anderes ist als er selbst und das Verrinnen der Minuten, das Abtropfen des Guten und Schlechten an seiner schrundigen Oberfläche reglos hinnimmt.
Ich streichle den schrundigen Stamm der Eiche und frage mich, was sie wohl empfinden würde, wenn meine Haut sie berührt, könnte sie es in Worte fassen. Ich spüre Wärme, zurückhaltende samtige Härte, fein aufgelöste Struktur, Ruhe, Gleichmaß.
Und dann nehme ich fast erschreckt die Zärtlichkeit wahr, mit der etwas, jemand mir seine Aufmerksamkeit schenkt, wenn ich ihm meine Aufmerksamkeit leihe. Und mich durchflutet das Glück, das darin liegt, das jede Begegnung Kommunion ist, ein Tausch von Gaben. Jede Wahrnehmung ist uns gegeben. Darin liegt die tiefe Rührung und unbezähmbare Aufregung, die Dichter dazu bringt, den Dingen zu danken. Rainer Maria Rilke sah es darum als seine einzige Rolle zu preisen: Und das heißt, nichts anderes zu tun, als die Wirklichkeit so ins Leben zu rufen, wie ein Kind unter dem Weihnachtsbaum in ungläubigem Staunen seine Geschenke auspackt.