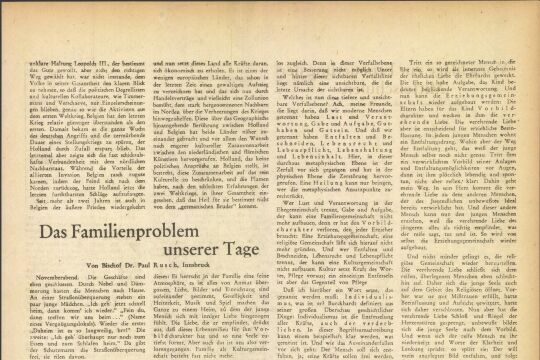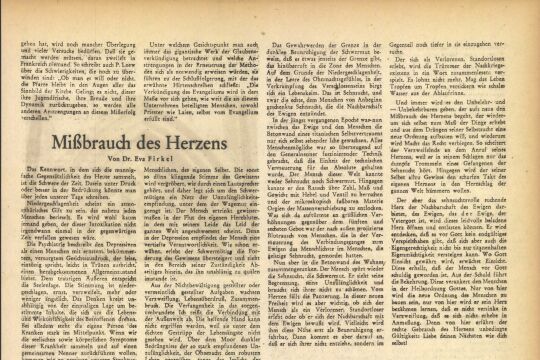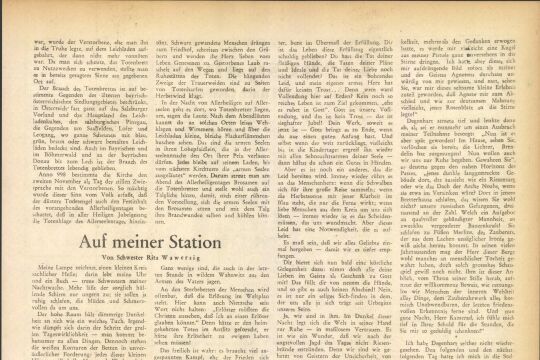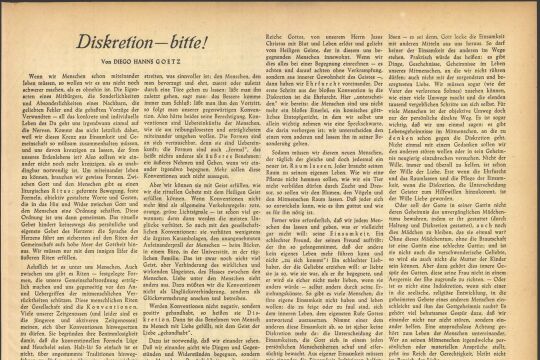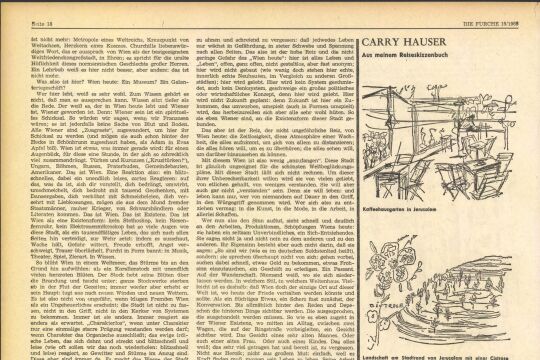Der Weg des Wassers
Der Mensch. Mann, Frau, Kind, du, ich, sie, er. Was verbindet uns? Woher wissen wir, dass wir Mensch sind? Ein Essay - entstanden im Rahmen des Schüler(innen)-Essay-Wettbewerbs "Theolympia".
Der Mensch. Mann, Frau, Kind, du, ich, sie, er. Was verbindet uns? Woher wissen wir, dass wir Mensch sind? Ein Essay - entstanden im Rahmen des Schüler(innen)-Essay-Wettbewerbs "Theolympia".
„Aber was der Mensch sei, werden wir nie wissen. Kein Bild des Menschen zeigt den Menschen selbst. Um Mensch zu werden, dürfen wir uns an kein Bild vom Menschen binden“ Karl Jaspers.
Können wir denn nicht sagen, was ein Mensch ist? Sind es nicht die Augen, Ohren, die Nase, die das Gesicht bilden und der Körper darunter mit den Händen und Armen, die sich mit anderen zusammenfinden? Oder ist es das Du, das Er, das Sie, das sich hinter den Augen verbirgt und niemals stirbt? Sind wir Mensch, solange wir mit Körper auf Erden weilen? Sind wir Mensch, weil wir eine Seele in uns bergen?

Liebe Leserin, lieber Leser,
Die FURCHE stellt den Theolympia-Gewinner(inne)n diese Plattform und Ihnen den Text kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)
Die FURCHE stellt den Theolympia-Gewinner(inne)n diese Plattform und Ihnen den Text kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)
Unerschöpflich bahnen sich Fragen an, sobald an der Oberfläche der ersten Frage gekratzt wird. Sie sprudeln und gurgeln wie der Bach, der sich durch die Wälder schlängelt und werden immer tiefer und breiter, immer schneller und packender. Wohin führt uns die erste glasklare Quelle? In welchem Fluss landen wir, wenn wir der Frage nach dem Menschsein folgen?
Der Mensch. Mann, Frau, Kind, du, ich, sie, er. Was verbindet uns? Woher wissen wir, dass wir Mensch sind? Wir wachsen unter den liebevollen Augen unserer Eltern auf, in dem Wissen, zu den Menschen zu gehören. Wir haben nicht wie die Tiere ein Fell auf unserem Rücken, gehen nur auf Füßen, nicht mit den Armen am Boden, ständig bückend. Sind kein Vogel mit Flügel, können mit unseren Armen weder fliegen noch uns im Winde wiegen. Als Mensch haben wir Augen, groß und klar. Mit unserem Mund lernen wir Worte zu formen, unsere Wünsche, Ziele, Ängste, um das auszudrücken, was gerade geschah. Unsere Arme lernen jemanden in eine Umarmung zu schließen.
Aber es gibt auch Menschen unter uns, die diese Dinge, die vielleicht im ersten Moment einen Menschen auszeichnen, nicht tun können. Als würde ein Hindernis sie beeinträchtigen, Mensch zu sein. Jemanden nicht in die Arme nehmen, nicht auf den eigenen Beinen stehen, nichts vor Augen sehen zu können, macht einen das weniger Mensch? Nein. Unsere Arme lernen jemanden in eine Umarmung zu schließen, ja, aber dank unserer Seele lernen wir dies auch zu genießen. So rinnt nun die Quelle zwischen Steinen und Moos gebettet hinab, zeigt uns einen Weg, trifft auf eine andere Quelle und gemeinsam bergen sie in sich das Geräusch, das immer lauter wird. Das Geräusch das uns gurgelnd mitteilt: Mensch ist nicht nur Körper mit Beinen, Armen und Gesicht, nichts ist nur so einfach oder schlicht.
Im Krieg wurden Menschen Armen abgehackt und dennoch fehlte nicht ein Teil des Ganzen. Im Schoß einer Mutter werden wir geboren, aber es ist nicht die Hülle, die uns zum Menschensein bewilligt.
So können wir nicht sagen, mit dem Körper bist du Mensch gemacht. Im Krieg wurden Menschen Armen abgehackt und dennoch fehlte nicht ein Teil des Ganzen. Im Schoß einer Mutter werden wir geboren, aber es ist nicht die Hülle, die uns zum Menschensein bewilligt. Ist es nicht die Trauer, die uns zeigt, dass ein Mensch nicht sein Körper ist. Eine kalte Faust um unser Herz, das Salz in den Augen und die Gewissheit, dass uns jemand verlassen hat. Der Leib liegt vielleicht noch vor uns, aber plötzlich fehlt alles andere. Der Geist, der die Hand hebt, der die Wörter formt und das Herz zum Schlagen bringt. Gott hat der Seele eine Hülle gegeben, in die sie sich legt, hinein bequemt und darin ihre Wege geht. Die Quelle rinnt weiter, immer weiter und weiter, wird plötzlich etwas breiter und plätschert über Kiesel, Ast, schnappt sich das nächste Blatt. Im Wasser wirbelts und zwirbelts und wir nennen die Quelle auch schon Bach. In der stillen Spiegelung eines Tümpels können wir erkennen, dass in unserem Körper, hinter unseren Augen, ein jemand haust.
Können wir so denn nicht sagen, dass es die Seele ist, die uns zum Menschen macht? Die Komplexität unserer Gefühle, die uns die einen hassen und die anderen lieben lässt? Wir sind also Mensch, weil wir nicht nur als Hülle, sondern auch aus Fülle bestehen. Aber das plätschernde Wasser hat noch nicht sein Ziel erreicht, des Wassers Weg schlängelt sich noch weiter durch Wälder und Täler. Schauen wir uns die Frage an, die in den Furchen der Steine zu sehen sind: Was meinen wir, wenn wir sagen, das ist menschlich?
Es sind liebevolle Gesten und gütige Handlungen, die wir als human bezeichnen. Ist es das Gute in uns, das uns menschlich macht? Gewalt, jemanden zu verletzen oder zu töten bezeichnen wir als unmenschlich. Woher nehmen wir dieses Wissen? Schauen wir zum Beginn. In den Augen des Kindes sind die Wunder zu lesen, wenn es immer mehr von dieser Welt erfasst und sich in all unsere Herzen schleicht. Im Kind sehen wir die Wahrheit. Das Lachen so froh und hell, die Liebe, die es am Leben hält. Das natürlichste der Welt ist die Liebe, die Kinder so einfach geben. Erst die Welt legt Sperren auf, Vorurteile, Hass, Angst. So brechet das Herze nicht, fragil und klein, wie es ist. Denn in ihm erblüht die Liebe der Welt und das ist was uns alle erhellt. Pflanzen wir das Gute fort, werden wir als menschlich bezeichnet, aber Mensch ist genauso der von Hass zerfressene. Es gibt zwei Sorten von Menschen, die die lieben und geliebt werden und die die geliebt werden aber die Liebe nicht zulassen. Am Ende lassen wir alle die Liebe zu.
Es gibt Tiere mit menschlichen Zügen. Wir schreiben ihnen diese zu, wenn sie sich um ihre Jungen sorgen, wenn der Albatros seinem Partner treu bleibt oder der Hund ein Baby zudeckt. Wenn wir die Anteilnahme der Tiere als menschlich bezeichnen, muss es auch in uns das Gute sein, dass uns menschlich macht. Aber machen nicht auch unsere Fehler uns menschlich? Sind es nicht auch die Ecken und Kanten, die Fehler und Pannen? Solange in uns die Liebe herrscht und wir sie nicht ausschließen, ist jedes Handeln das eines Menschen.
Nun ist es also die Liebe, die uns menschlich macht. Wir Menschen sind wie eine Dahlie. Wir sind der Stängel und das Innere der Blume. Im Stängel liegt unsere Kraft, unser Lebenssaft und unsere Liebe. Nach außen hin erblühen wir, umhüllen unsere Mitte und strecken uns der Sonne entgegen. Am Bach entlang säumen sich die Dahlien. Es plätschert ein weiteres Gerinne zum Bach hinzu, gemeinsam wirbeln sie zusammen und bilden eins. Sie werden zu einem rauschenden Fluss, der Wellen an das Ufer schlägt und sich um große Steinbrocken kräuselt.
Eine Hand streicht von Dahlie zu Dahlie, unterscheidet sie in Form und Farbe. Was macht uns zu der einzigartigen Dahlie, zu dem individuellen Geschöpf? Unsere Umgebung, die unsere Erinnerungen, Erfahrungen und Einstellungen geprägt hat. Unsere Dahlie ernährt sich von Liebe, sie bildet Jahr für Jahr mehr Blütenreihen rund um sich. Sie webt andere Menschen in ihr Leben mit ein, entscheidet sich für einen Weg und lebt diesen aus. Sie formt ihre Blütenblätter spitz oder breit, rosa, gelb, rot oder blau und groß oder klein. Der Mensch formt sein eigenes Glück, wir bestehen aus Blütenblättern, die im Laufe des Lebens größer oder durch neue ersetzt werden. Wir finden neue Liebe, lassen alte los, wir werden Tag für Tag mehr Mensch. Das Rauschen des Wassers nimmt ab, der Fluss hat sich seinen Weg gegraben, tief und breit, sodass kein Steinbrocken ihn mehr aufhalten kann. Auch wenn der Fluss nicht weitersieht als bis zur nächsten Kurve, hat der Fluss keine Sorgen mehr. Sein Weg steht ihm frei. Er weiß nicht genau was kommen mag, aber hat schon so viel hinter sich und weiß, dass alles gut wird.
Wenn wir jetzt vor dem Spiegel stehen, was sehen wir dann? Wir sehen unseren Körper und wissen doch, dass er uns nicht zum Menschen macht. Wir lesen in unseren Augen unsere Menschlichkeit, und wissen doch, dass jeder eine andere hat. Wir erkennen unsere Vergangenheit, unser jetzt und erblicken die Zukunft. Wir erfassen was uns ausmacht und sehen so viele Erinnerungen. Wir wundern uns: Was wären wir, wenn wir uns selbst nicht kennen würden? Das Jetzt ist, sobald es ausgesprochen wird, sobald daran gedacht wird, auch schon wieder vorbei und wir befinden uns in einem neuen Jetzt. Wir steigen in den gleichen Fluss, aber er ist nie wieder derselbe. Was macht uns also zu unserem Spiegelbild, und wie können wir uns darin wieder erkennen? Unsere Vergangenheit. „Denn Vergangensein ist auch noch eine Art von Sein, ja vielleicht die sicherste.“ (Viktor Frankl in Trotzdem Ja zum Leben sagen 1985, S. 133)
Der Weg des Wassers ist lang, schlussendlich landet alles im Meer. In einer unergründbaren blauen Tiefe. Worte werden auf der einen Seite des Ozeans geflüstert und tragen sich bis zu der anderen Seite weiter. Wellen schlagen gegen nichts und verlieren sich in sich selbst. Dahlien werden im Wasser anher geschwemmt. Der eine Mensch in der Lage im stillen Wasser sein Spiegelbild zu sehen, ohne etwas sagen zu können, der andere Mensch dazu in der Lage, das Wasser zu spüren, ohne etwas erkennen zu können. Der eine Mensch kennt jede Muschel am Strand und betrachtet sie sanft zwischen den Händen, der andere tritt sie mit Füßen, ohne darüber nachzudenken. Die Wellen schlagen an den Strand, wirbeln um den Sand und jeder sieht darin etwas anderes, die Gefahr, das Abenteuer, das Salz oder den Fluss mit all seinen Erfahrungen.
Es gibt also gar nicht den einen Menschen, die eine Menschlichkeit. Wir können nur Mensch werden, wenn wir uns kein Bild von ihm machen, wie Karl Jaspers sagt. Wieso sind wir nicht alle wie die Kinder? Ein Stängel voller Liebe mit einer Dahlie obendrauf, die nur so sprießt und selbst gar nicht weiß, dass die Form, die sie trägt und die Farbe, in der sie blüht, sie zum Menschen macht. Das Kind, die Dahlie in uns, sie weiß nur von der Liebe aus dem stärkenden Stängel und erblüht, vom Wasser der Fragen gestärkt, im Laufe ihrer Entwicklung und wird von Gott gepflückt, wenn er sie als reif empfindet.
Viktoria Sindelar hat mit diesem Text den 2. Platz beim zweiten "Theolympia"-Essaywettbewerb erreicht. Die 18-Jährige ist Schülerin der Don Bosco Schulen Vöcklabruck.

Hat Ihnen dieser Artikel gefallen?
Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf über 175.000 Artikel aus 40 Jahren Zeitgeschichte – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!
Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf über 175.000 Artikel aus 40 Jahren Zeitgeschichte – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!