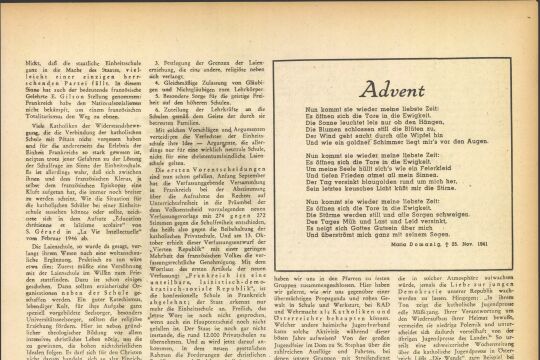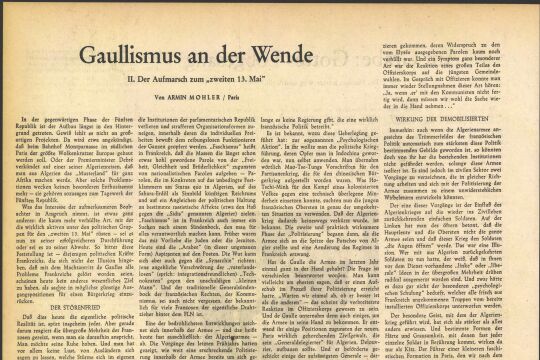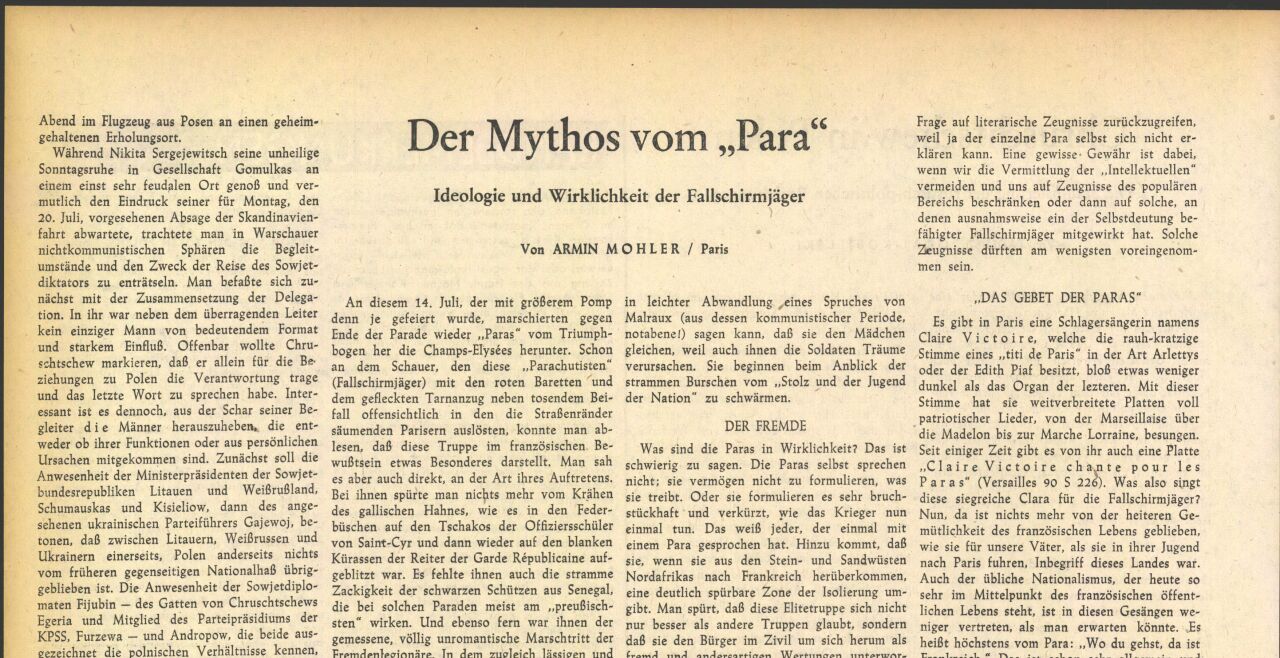
Frage auf literarische Zeugnisse zurückzugreifen, weil ja der einzelne Para selbst sich nicht erklären kann. Eine gewisse' Gewähr ist dabei, wenn wir die Vermittlung der „Intellektuellen“ vermeiden und uns auf Zeugnisse des populären Bereichs beschränken oder dann auf solche, an denen ausnahmsweise ein der Selbstdeutung befähigter Fallschirmjäger mitgewirkt hat. Solche Zeugnisse dürften am wenigsten voreingenommen sein.
An diesem 14. Juli, der mit größerem Pomp denn je gefeiert wurde, marschierten gegen Ende der Parade wieder „Paras“ vom Triumphbogen her die Champs-Elysees herunter. Schon an dem Schauer, den diese „Parachutisten“ (Fallschirmjäger) mit den roten Baretten und dem gefleckten Tarnanzug neben tosendem Beifall offensichtlich in den die Straßenränder säumenden Parisern auslösten, konnte man ablesen, daß diese Truppe im französischen Bewußtsein etwas Besonderes darstellt. Man sah es aber auch direkt, an der Art ihres Auftretens. Bei ihnen spürte man nichts mehr vom Krähen des gallischen Hahnes, wie es in den Federbüschen auf den Tschakos der Offiziersschüler von Saint-Cyr und dann wieder auf den blanken Kürassen der Reiter der Garde Republicaine aufgeblitzt war. Es fehlte ihnen auch die stramme Zackigkeit der schwarzen Schützen aus Senegal, die bei solchen Paraden meist am „preußischsten“ wirken. Und ebenso fern war ihnen der gemessene, völlig unromantische Marschtritt der Fremdenlegionäre. In dem zugleich lässigen und sicheren Abrollen der Gummistiefel der Paras prägte sich eine geschmeidige Präzision aus, die halb die Präzision einer Katze, halb die einer geräuschlos funktionierenden Maschine war.
Einen Monat früher war in den Zeitungen folgende Notiz zu lesen: „Eine .Vereinigung der Fallschirmjäger-Schriftsteller und -Journalisten' ist gegründet worden. Ihr Zweck ist die Verbreitung der ,Para-Idee in der Literatur und der Presse.“ Diese Meldung mochte überraschen, denn man kann wirklich nicht behaupten, daß sich „die Intellektuellen“ in den letzten Jahren nicht mit den Paras abgegeben hätten. Es gibt über sie schon eine ganze Literatur, die von der psychologisch-soziologischen Analyse bis zum rührseligen Dreigroschenroman reicht. Und auch in der Wertung ist eine weite Spanne festzustellen. An ihrem einen Pol stehen jene Linksintellektuellen, für die ein Para von vornherein ein blutrünstiger Landsknecht, ein Folterknecht und ein Feind der Republik ist. Und am andern Pol stehen jene Intellektuellen, voft dehėn man in leichter Abwandlung ,eines Spruches von Malraux (aus dessen kommunistischer Periode, notabene!) sagen kann, daß sie den Mädchen gleichen, weil auch ihnen die Soldaten Träume verursachen. Sie beginnen beim Anblick der strammen Burschen vom „Stolz und der Jugend der Nation“ zu schwärmen.
DER FREMDE
Was sind die Paras in Wirklichkeit? Das ist schwierig zu sagen. Die Paras selbst sprechen nicht; sie vermögen nicht zu formulieren, was sie treibt. Oder sie formulieren es sehr bruchstückhaft und verkürzt, wie das Krieger nun einmal tun. Das weiß jeder, der einmal mit einem Para gesprochen hat. Hinzu kommt, daß sie, wenn sie aus den Stein- und Sandwüsten Nordafrikas nach Frankreich herüberkommen, eine deutlich spürbare Zone der Isolierung umgibt. Man spürt, daß diese Elitetruppe sich nicht nur besser als andere Truppen glaubt, sondern daß sie den Bürger im Zivil um sich herum als fremd und andersartigen Wertungen unterworfen empfindet. Und dieser Bürger selbst empfindet diese Fremdartigkeit offensichtlich auch und hält Abstand. Das sah man deutlich an den Abenden vor dem 14. Juli: wo bei einem der „bals populaires“ auf den Straßen ein rotes Barett auftauchte, wurde es keineswegs von den Mädchen umringt.
Es wäre falsch, dieses Gefühl der Fremdheit auf die Unmenschlichkeiten des Algerienkrieges zurückzuführen. Erstens hat uns die Psychologie gelehrt, daß das Verhalten des Menschen gegenüber solchen Dingen keineswegs eindeutig ist. Und zweitens kann man jene Unmenschlichkeiten nicht einfach den Para-Einheiten aufs Konto schreiben; sie sind keineswegs bloß Angelegenheit einer Spezialtruppe. Es sind auch Einheiten der normalen Armee, der Polizei, der weißen Einwohnerwehren und der mohammedanischen Hilfstruppen in sie verwickelt. Was also ist es, was den Para von den anderen Uniformträgern und den Zivilisten unterscheidet?
Wir'Sind gezwungen, zur'Beantwortung dieser '
„DAS GEBET DER PARAS“
Es gibt in Paris eine Schlagersängerin namens Claire Victoire, welche die rauh-kratzige Stimme eines „titi de Paris“ in der Art Arlettys oder der Edith Piaf besitzt, bloß etwas weniger dunkel als das Organ der lezteren. Mit dieser Stimme hat sie weitverbreitete Platten voll patriotischer Lieder, von der Marseillaise über die Madelon bis zur Marche Lorraine, besungen. Seit einiger Zeit gibt es von ihr auch eine Platte „Claire Victoire c h a.n t e pour les Paras“ (Versailles 90 S 226). Was also singt diese siegreiche Clara für die Fallschirmjäger? Nun, da ist nichts mehr von der heiteren Gemütlichkeit des französischen Lebens geblieben, wie sie für unsere Väter, als sie in ihrer Jugend nach Paris fuhren, Inbegriff dieses Landes war. Auch der übliche Nationalismus, der heute so sehr im Mittelpunkt des französischen öffentlichen Lebens steht, ist in diesen Gesängen weniger vertreten, als man erwarten könnte. Es heißt höchstens vom Para: „Wo du gehst, da ist Frankreich.“ Das ist schon sehr allgemein und verdünnt.
Nicht zufällig heißt es in einem der Lieder: „Wir gucken auf euch herunter, wie ihr ganz, ganz klein seid.“ Die Formel des Lebensgefühls, das da nach Ausdruck sucht, lautet: „Unter dem Dom aus Nylon fliegen wir — mit klarer Seele — wir sind stolz — wir haben die Angst besiegt — es erscheint etwas verrückt auf dieser Erde, sich ganz sacht im Licht zu wiegen …“ Und daraus erwächst ein Sendungsbewußtsein, das mit dem landesüblichen Messianismus wenig mehr zu tun hat: „Wenn die Stunde der Aktion gekommen ist, springen wir — die gefallenen Kameraden sind gerächt — der Erzengel wird Krieger — kaum haben wir den Boden berührt, so sind wir die Hoffnung der ganzen Welt.“ Oder an anderer Stelle: „Wenn man ist Parachutist — lacht man über die Gefahr — muß man sein ein Fatalist.“
Daß in diesem Grundgefühl des „Allein-in- der-Atmosphäre“ halb religiöse, halb blasphemische Züge stecken, wird am deutlichsten im vierten der Para-Lieder von Claire Victoire. Es heißt: „Das Gebet des Para.“ Und sein litaneimäßig vorgetragener Text lautet, etwas zusammengezogen: „Ich wende mich, mein Gott, an Dich, weil Du gibst, was man nur von sich selbst erhalten kann — ich verlange von Dir nicht die Ruhe, weder der Seele noch des Körpers, ich verlange nicht den Reichtum, nicht den Erfolg und nicht einmal die Gesundheit — ich verlange nicht, was man so oft von Dir verlangt, daß es gar nicht mehr da ist — gib mir das, was übrig bleibt, weil niemand es will — ich will die Gefahr, die Unruhe, den Sturm und den Kampf — und gib mir das für immer, denn vielleicht habe ich nicht ständig den Mut, es zu verlangen — gib mir den Mut, die Kraft und den Glauben — denn Du, mein Gott, bist der einzige, der geben kann, was man nur von sich selbst erlangen kann.“ Das ist nichts anderes als das „vivere pericolosamente“. Aber man hat es in anderen Sprachen selten in dieser Konsequenz ausgesprochen gehört.
EIN BILDEREPOS VOM STERBEN
Nun mag das mancher für die Uebertreibung einer Chanteuse und ihrer Texter halten. Es gibt jedoch ein Zeugnis von Paras selbst, das etwas zurückhaltender und in nüchternerer Sprache genau dasselbe aussagt. Es handelt sich um ein erstaunliches Bilderbuch, das jeder kennen muß, der die Wandlungen Frankreichs in den letzten Jahren begreifen will. Sein Titel lautet: „Aucune bete au monde…“ (Kein Tier auf dieser Welt.. .), seine Verfasser sind der Feldwebel Flament (Photos) und der berühmte Oberst Bigeard (Text), und erschienen ist es in den Pariser „Editions de la Pensėe moderne“ (112 Boulevard Rochechouart).
Auch das ist typisch: daß es ein B i 1 d buch ist. In ganzseitigen, technisch ausgezeichneten Photos wird der Kampf einer Para-Einheit in den Felswüsten Kabyliens und in den Sanddünen der Sahara geschildert, und das Buch klingt aus in den erschütternden Photos vom Tod des schwerverwundet im Sande liegenden Feldwebels Sentenac, eines Veteranen von Dien-Bien-Phu. Die Bilder sprechen so für sich, daß die kurzen begleitenden Texte Bigeards — dieses Prototyps des mit seiner Mannschaft alle Gefahr und Anstrengung teilenden „jungen Obersten", der für die französische Armee mit dem Algerienkrieg so wesentlich geworden ist — an sich gar nicht nötig wären. Aber diese vom Pathos Barrės und Saint-Exuperys überhauchten Texte sind doch so gut formuliert, daß sie ihren Eigenwert neben den Bildern haben.
Der seltsame Titel ist einem Saint-Ex u- p ė r y - Zitat aus „Ter res des Hommes" entnommen: „Meine Kameraden glauben, daß ich marschiere. Sie haben alle Vertrauen in mich. Und ich wäre ein Lump, wenn ich nicht marschieren würde.. . Was ich getan habe, ich schwöre es, kein Tier auf dieser Welt hätte es getan …“ Mit diesem Zitat Saint-Exuperys, den man im deutschen Sprachbereich von Nebenwerken her meist zu niedlich sieht, ist der Ton des ganzen Buches angegeben. Die Bilder zeigen denn auch keine idealisierten Soldatengestalten. Diese von der Sonne verbrannten, unter der Anstrengung keuchenden jungen Männer sind ein „verlorener Haufe“ im Sinne eines Ernst von Salomon (dessen „Geächtete" ein Lieblingsbuch für viele Franzosen ist). Auch sonst fehlen die Parallelen zu einem gewissen deutschen Kriegertypus nach dem ersten Weltkrieg nicht. Es erinnert an des frühen Ernst Jüngers Meinung, daß ihm der Gegner brüderlicher verbunden sei als der Landsmann im Hinterland, wenn Bigeard neben die Aufnahme eines schwerverletzten FLN-Kriegers schreibt: „Wir waren ohne Haß, und diesen da haben wir gepflegt. Er hatte sein Gesetz und wir das unsere …“ Und unter dem Photo eines gefangenen anderen FLN-Kämpfers lesen wir: „In seinen ausgetretenen, von Schnüren zusammengehaltenen Schuhen, seiner verschmutzten Djellabah hatte er seine letzte Patrone auf uns abgeschossen und war uns dann, ohne ein Wort zu sagen, gefolgt. Unter seiner Mütze gleicht sein mageres Gesicht nun dem unsern.“ So etwas sticht ketzerisch von dem offiziellen Frankreich ab, das den FLN immer noch als eine Verbrecherbande abtun zu können glaubt.
HUNGER NACH ERMÜDUNG
Aber diese Parallelen sind nicht mehr als eben Parallelen. Es wäre verfehlt, nach direkten deutschen Einflüssen zu suchen. Da die meisten unserer „Frankreichkenner" von jeher die offizielle französische Selbstinterpretation mit der französischen Wirklichkeit verwechselt haben, ist ihnen auch entgangen, daß die Keime aller Epidemien unseres Jahrhunderts auch in diesem Lande vorhanden sind. So hatte Frankreich beispielsweise nach dem ersten Weltkrieg in Rene Quintons „Maximen über den Krieg“ eine Lehre vom absoluten Wert des Krieges und' der Krieger aufzuweiseh, welche die verwandten deutschen Lehren an Radikalität weit übertraf. Von der heutigen „Para-Ideologie“ kann man vielleicht sagen, daß mit ihr Frankreich zeitlich verspätet ein Fieber durchmache, das Nachbarländer längst hinter sich hätten. Auf jeden Fall ist das Thema des europäischen Nihilismus auf eigene Weise neu formuliert, wenn Oberst Bigeard Aufnahmen seiner durch die Djebels ziehenden Truppe mit den Worten begleitet: „Nein, kein Tier auf dieser Welt wäre zu dem erschöpfenden Marsch durch Sonne und Regen, Schnee und Staub fähig gewesen. Dieses Tier hätte sich eines Tages in einen Winkel zurückgezogen, um vor Ueberdruß zu krepieren. Wir aber, gierig nach Ermüdung, sine weitergezogen. Die Kanten der Steine zerschnitten unsere Schuhe, und wir haben unser Tarnanzüge an den Dornen der Saumpfade zerrissen. Die Ermüdung wurde uns zu einer Gewohnheit, dann zu einer Droge, die uns da: Vergessen schenkte. Und wir hatten viel zt vergessen . .. Wir hatten Rendezvous, an jede: Ecke der Piste, hinter jeder Düne, jeder Kuppe aber es waren Rendezvous mit unserem Tod Und man mußte leiden, um das Recht aufs Sterben zu haben. Kein Tier auf dieser Welt hätte das begreifen können." Das ist die gleiche Melodie wie jene, die in unserem Jahrhundert schon andere Kriegerzüge durch die Kontinente hat ziehen lassen.
Es fehlt auch nicht die unterschwellige Buntheit zur ausgedörrten Leistungslandschaft, mit all ihrer bengalischen Leuchtkraft: „Manchmal führte unser Weg durch erstaunliche Landschaften. In der Schlucht von Miliana stießen wir auf monströse Lianen und Blumen von fremdartiger Schönheit.“ Die ausgleichende Welt det Frau ist dieser männerbündischen Welt fern: „Es schien uns, als ob wir in dieser Entäußerung und Einsamkeit, in Durst und Hunger den Feind erwischt hätten, den wir so lange schon verfolgten: uns selbst, unsere Angst und diesen Körper, der sich plötzlich erinnerte, um von uns saftige Früchte zu verlangen, einladende Mädchen, tiefe Betten und ein angenehmes Leben … An dem sumpfigen Tümpel füllten wir unsere Feldflaschen, Dieses Wasser hatte für uns die lichte Klarheit eines Bergsees, denn das Gesicht der Kameraden spiegelte sich drin neben dem unsern.“
Die Quintessenz des Buches ist wohl jene Seite, die — es kann kein Zufall sein — einen Para in biblisch felsiger Landschaft in der Pose des Guten Hirten zeigt: die Maschinenpistole lässig umgehängt, hat er sich ein friedlich blickendes weißes Schaf über die Schultern gelegt. Daneben liest man: „Um unsern Teil an der Zeche zu tragen, hätten wir dies verirrte Schaf auf den Tisch geschmissen …" Sind das Leute ohne Glauben? Das letzte Photo des sterbenden Sentenac begleitet der Text: Es bedurfte einer letzten Anstrengung zum Sterben. Er wußte wohl, daß er gewönnest hatte, und darum erschien uns sein ruhig gewordenes Gesicht so schön. Was er auf der andern Seite der Düne suchte, war nicht eine Handvoll Beduinen und ihre Gewehre, sondern diese unerreichbare Sache, die ihn so lange schon beschäftigte und die man nur im Opfe.r und im Tod findet. Sie allein erlaubt, mit dem Größten, dem Unerreichbarsten, was es gibt, eins zu werden. So hat Sentenac auf seine Weise Gott begriffen. Kein Tier auf dieser Welt wäre dazu imstande…"
Ein gefährliches Buch. Aber man muß es lesen und es sich ansehen, wenn man das Fieber begreifen will, das heute Frankreich schüttelt. Sind diese Männer Feinde jener Ordnung, die heute noch, wenn auch recht angeschlagen, in Frankreich besteht? Es ist vielleicht viel schlimmer: vielleicht wissen sie von ihr nicht einmal mehr. L