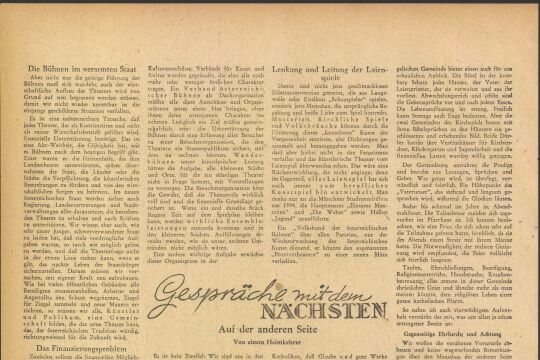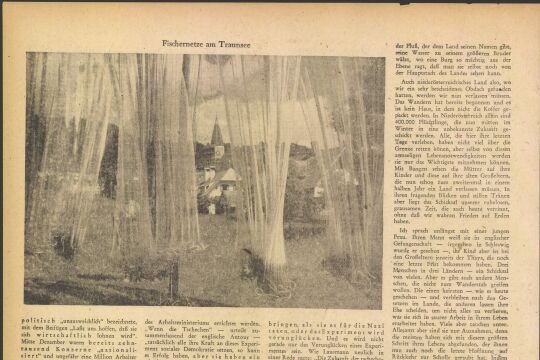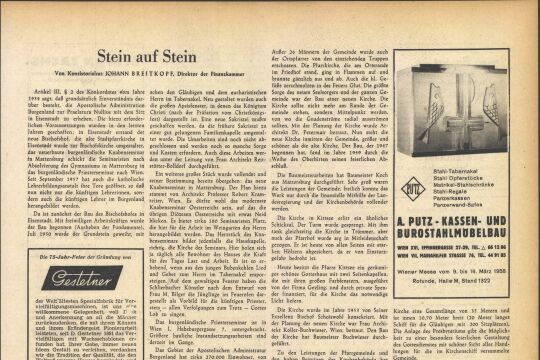Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Zwischen Rostock und Warnemünde ist die Stadt ohne Gott entstanden
Dorfkirchen in Mecklenburg. Wer sie einmal gesehen hat, vergißt ihre strenge Schönheit nicht mehr. Wehrhaft ragen die Backsteintürme in den Himmel Kätner oder Großbauern brachten ihre Kinder zu den riesigen Taufsteinen, sangen ihren Toten drinnen den letzten Choral. Ein störrisches Volk, aber Gott wohnte bei ihm und man baute ihm kraftvolle Häuser.
Eine der schönsten Kirchen Mecklenburgs steht im Dorf Lichtenhagen, zwischen Rostock und Warnemünde. Dem Taxifahrer am Bahnhof Rostock muß man das Ziel zweimal sagen: Lichtenhagen-Dorf, Betonung auf dem letzten Wort. Denn Lichtenhagen-Stadt steht seit einigen Jahren für eine Massenbehausung und Super-schlafstadt, wie man sie in Europa noch nicht kannte.
100.000 Menschen werden hier in wenigen Jahren die 15- und mehrstök-kigen Wohnmaschinen bevölkern. Die Werften von Warnemünde und Fabriken von Rostock locken Männer, Frauen und Halbwüchsige aus allen Teilen der DDR mit relativ hohen Löhnen. Tagsüber begegnet man in den freudlosen Straßen nur ein paar Alten, die auf den Bus warten, um im gemütlichen Warnemünde einige Stunden unter Menschen zu sein. Kaum ein Cafe, kaum ein Club, nur wenige Supermärkte, das Grün soll einmal kommen - und vielleicht auch einmal die Kirche. Die 100.000 werden vorerst von den Dörfern aus notdürftig betreut
Die einstige Scheune des geräumigen Pfarrhofes hat der junge Pastor mit einer Feierabendbrigade ein halbes Jahr lang bearbeitet und in eine behagliche Wohnung verwandelt. 50 Meter neben dem rotleuchtenden Kirchturm, 100 Meter von der Dorfstraße entfernt, auf der .Lastwagen ohne Unterbrechung Baumaterial transportieren.
Der Pastor wohnt auf dem weiten Gelände, das früher dem Pfarrer des 600-See,lendorfes eine behäbige Landwirtschaft ermöglichte, mit seiner Familie nicht allein. Die Kirchenleitung in Schwerin hat eine ganze Gruppe von Mitarbeitern hier angesiedelt, jeder mit eigener Funktion ausgestattet- dje dazugehörigen Gemeinde-
glieder aber konnte sie, nicht mitliefern. Kein Anmeldeschein weist das Bekenntnis der Neuzugezogenen aus, mühsam muß festgestellt werden, wer sich etwa von den reichlich 30.000 Bewohnern der Trabantenstadt Lütten-Klein noch als Christ bezeichnet. Knapp 8000 sind es immerhin, die sich evangelisch nennen, rund 2000 zählen sich zur katholischen Kirche. Alle übrigen könnten vielleicht in einer überschaubaren Gemeinde, die Kirchenräume, Kindergarten und diakonische Einrichtungen gleichzeitig mit den Neubauten präsent hält, noch angesprochen werden - in Lütten-Klein wie in Lichtenhagen-Stadt sind sie vorerst, wenn nicht für immer, abgeschrieben.
Aber auch die 8000 haben mit der Kirche im Dorf kaum mehr Fühlung. Schon die soziologischen Voraussetzungen sind schwierig: Schichtarbeit, Flucht ins Grüne am Wochenende, abgerissene Verbindung zum Dorf, das niemals das ihre war. Während der Dorfpfarrer sonntäglich noch eine stattliche Zahl von Bewohnern aus seiner Umgebung in der Kirche begrüßen kann, fehlen die Menschen aus den Hochhäusern fast gänzlich. Nicht einmal der Klang vom Glockenturm erreicht sie mehr. Die „Stadt ohne Gott“ ist in Reinkultur erstanden, auf dem Reißbrett geplant und gelungener, als die kühnsten Träume ihrer Erbauer ahnen ließen. So unmenschlich, unwirtlich und darum unbewohnbar diese Wohnmaschinen sind - eins haben sie erreicht: das Angebot der Kirche unhörbar und unsichtbar zu machen.
Die Menschen in den Trabantenstädten ringsum haben längst den Hunger verlernt. Die nicht-präsente Kirche tut ein übriges, um sie auch den Appetit auf die Wegzehrung, welche die Botschaft des Evangeliums anbietet, vergessen zu lassen. Dem nichtgehörten Wort Gottes entspricht die Inflation der großen und wortreichen Parolen,
mit denen die Menschen täglich konfrontiert werden und die ohnehin keiner mehr aufnimmt. Geistig und geistlich beraubt, werden sie zu Anbetern des Wohlstands, den das andere Deutschland ihnen frei Haus per Fernsehen liefert - wohin man blickt, sind sie unbehaust und ihre Wohntürme tun ein übriges, um ihnen die Geborgenheit zu verweigern.
„Ihr“ Pfarrer, vom Dorf mit dem Fahrrad angereist, gibt sich große Mühe, durch Hausbesuche die äußere und innere Distanz zu überwinden. Es steht eins zu 8000 und das Ergebnis ist leicht vorauszusehen. Helfen könnte hier allenfalls, was, von Amerika ausgehend, in den letzten Jahrzehnten im Westen praktiziert wird: stewardship, zu deutsch: nachbarschaftlicher Besuchsdienst. Wie Jesus seine Jünger paarweise aussandte, gehen sie zu zweit in die Häuser, Besucher und Besuchte möglichst gleichen Berufs, und nehmen die Lebenssituation einander ab. Die Vorbereitung dauert oft Jahre, aber sie lohnt sich Vielleicht schafft es der junge Pfarrer, einen solchen Besucherkreis zu gewinnen, dann würde er sich vervielfältigen und die nun immer drohende Frustration überwinden. Nur: wie und wann trifft man in diesen Trabantenstädten jemals zwei Menschen gemeinsam an, wo das eiserne Gesetz der Schichtarbeit regiert und die Familien zerreißt?
Vorerst muß er sich mit einer Minigemeinde zufrieden geben, die in der DDR aufkommende „Theologie der Bescheidung“ hilft ihm dabei. Aus der Riesengemeinde kommen noch keine 20 Kinder zum Katechetenunterricht, Taufen kann man pro Jahr an einer Hand herzählen, und für die Beerdigungen stehen nicht weniger als 30 ^weltliche“ Redner parat und machen ihn überflüssig. Die Stadt ohne Gott festigt sich.
Gilt der Missionsbefehl noch, wie er zu Himmelfahrt erklang, auch wenn der Himmel von Betonklötzen verdunkelt ist? Was ist das eigentlich für ein Ja, zu dem die Christen in der DDR in Sachen sozialistischer Staat permanent aufgefordert werden, wenn sie gleichzeitig ihren wichtigsten Auftrag
nicht erfüllen können und wohl auch bald nicht mehr wollen?
Die Frage ist umso mehr berechtigt, als die relativ kleine katholische Gemeinde, in Lütten-Klein etwa 2000 Menschen umfassend, nicht nur den Priester bereits in ihrer Mitte wohnen hat, überproportional an der Herrichtung der von ihr mitbenutzten evangelischen Gemeinderäume beteiligt ist und wöchentlich einen reichlich besuchten Abend für Heranwachsende veranstaltet, sondern auch das gleiche Gotteshaus, eben die Kirche im Dorf, abwechselnd mit ihren evangelischen Glaubensbrüdern benutzt. Neben dem eindrucksvollen Kruzifixus, links vom Altar, steht ein hochgotisches Sakramenthäuschen, in der Sakristei hängen die Ornate, und während der Messen füllt sich die Kirche. Beide Konfessionen hatten die gleichen Startbedingungen - die Katholiken sind weit vorn im Rennen. Liegt es auf Seiten der Evangelischen wirklich nur an der staatlich programmierten Stadt ohne Gott und nicht auch an einer Theologie, die allzu bereitwillig schon das Reden von Volkskirche für einen Akt der Restauration hält?
Behäbig und einladend liegt die Kirche im Dorf, im Kranz der Gräber und umgeben von einem Rest rotgedeckter Bauernhäuser. Nackt und schutzlos ragen von fern die Wohnsilos der Trabantenstädte hinein, in denen man sich nicht bergen kann. Wann wird die Kirche die Kraft und die Möglichkeit haben, vom Dorf aufzubrechen und mitten in der Stadt eine „Hütte Gottes unter den Menschen“ zu werden? Nowa Huta bei Krakau, doppelt so groß wie die drei Trabantenstädte zwischen Rostock und Warnemünde, hatte über zwei Jahrzehnte gleichfalls den Ruf, eine Stadt ohne Gott zu sein. Seit in ihrem Zentrum Altar und Kanzel zum Hören und zur Anbetung rufen, reichen ein halbes Dutzend Gottesdienste am Sonntag kaum mehr aus.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!