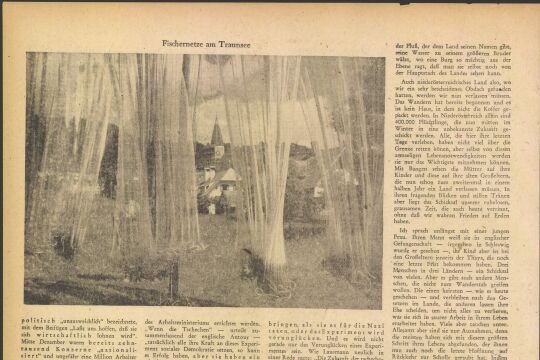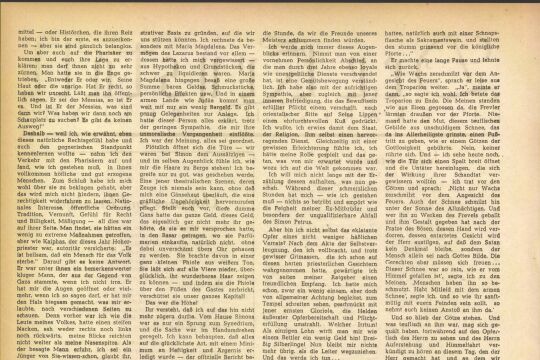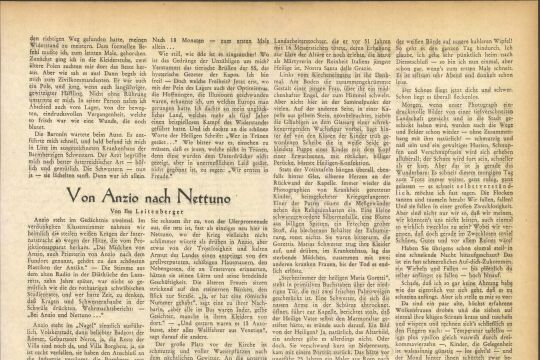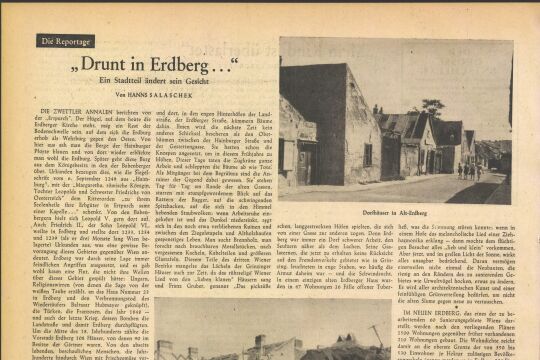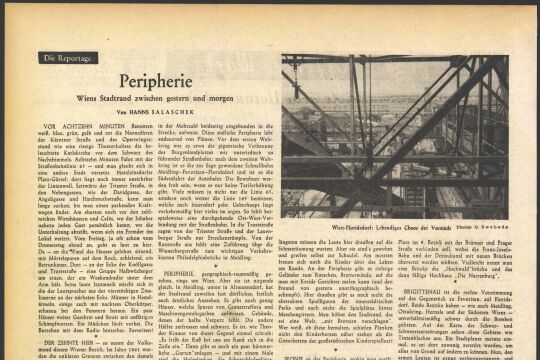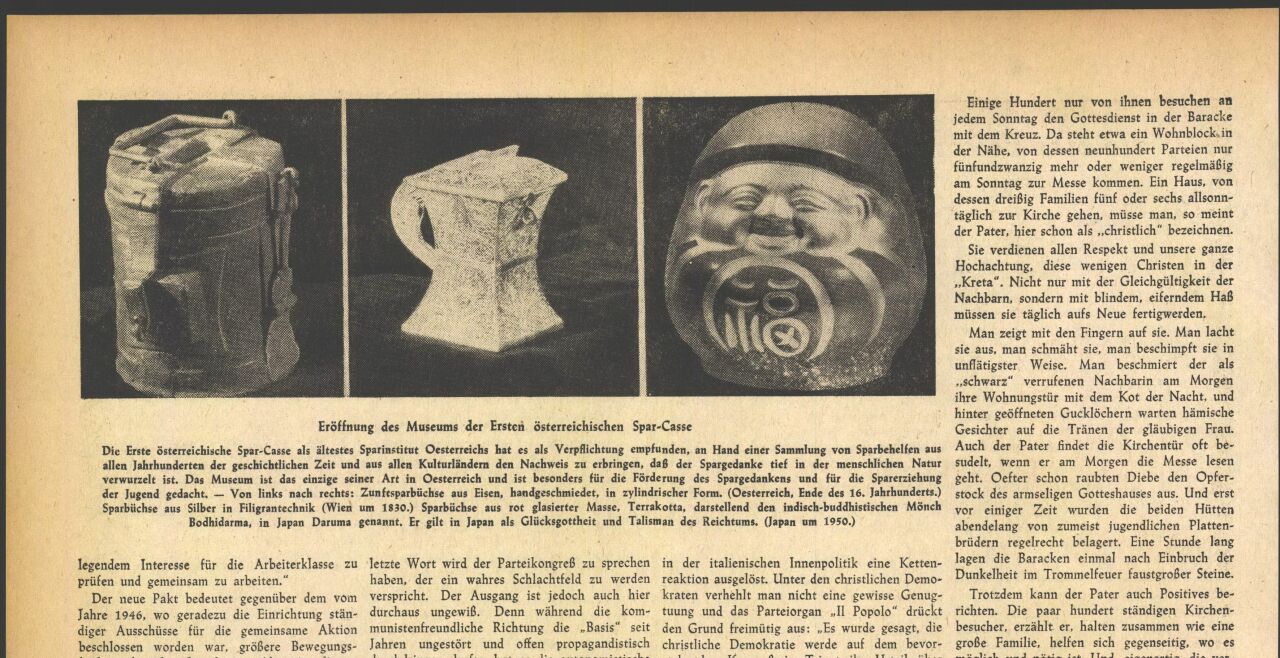
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ausgesetzt in der „Kreta“
Man möchte fast erschrecken, wenn man zum ersten Male vor der Notkirche zum heiligen Josef in der Quellenstraße steht. Denn man hat diese armselige Baracke mit dem Kreuz auf dem Giebel, diese Hütte, die der Pfarrhof ist, schon gesehen: so sind die Missionsstationen Südwestafrikas in Büchern abgebildet. Geißblattranken verbrämen die Stacheldrahtwehr der Planke, die diesen Vorposten der Kirche am östlichen Rand des zehnten Wiener Bezirkes umgibt. In einem Garten zieht der Priester seinen bescheidenen Bedarf an Kartoffeln und Gemüse und die bunten Blumen für den Altar. Zwei Götterbäume geben mit ihren Fiederblättern eine palmen-hafte Silhouette vor dem Himmel und dem baumlosen Rücken des Laaer Berges. Vor dem Eingang in das Gotteshaus verliert sich der Straßenasphalt im Sand.
Der Priester: Pater Josef Scharf, gebürtiger Bayer, dreiundsechzig Jahre alt, Mitglied der Kongregation der Missionäre von der Heiligen Familie. Die beiden Baracken hat er, Pioniersoldat des ersten Weltkrieges, im Sommer 1945 so gut wie allein aus den Trümmern wieder aufgebaut. Im Personalschematismus der Erzdiözese Wien scheint er als „Expositus“ auf. Als einer, der „ausgesetzt“ ist.
Auf der Höhe des Laaer Berges steht man zwischen Ost und West. Nicht nur symbolisch, sondern tatsächlich. Auf der einen Seite wandern die Augen vom Schneeberg, dem östlichsten Zweitausender der Alpen, bis zu den Ausläufern dieses gewaltigen Gebirges, das wie ein Wall Wien umgibt: die Stadt der vielen Kirchen. Wenn man aber mit dem Rücken zum Stephansturm steht, scheinen die Kleinen Karpaten gleich jenseits der Donau.
Und die Steppe des Ostens reicht mit ihren gelben, borstigen Gräsern bis hierher, bis zu den kümmerlichen Resten des einstigen Eichenwaldes, die nun als Laaer Wäldchen ein naturgeschütztes Dasein als Dauergartenanlage der Gemeinde Wien fristen. Noch unsere Großeltern haben diesen Wald als kleine Kinder gekannt. Spekulanten, deren geistiger Horizont vom Boden ihrer Geldbörsen begrenzt war, ver-anlaßten die Abholzung der uralten Eichen, stellten Zinskasernen und düstere Fabriken an den stadtseitigen Hang des Berges. Und wo noch keine Häuser stehen, hat sich die Steppe den Boden erobert, waren der Wind und die gelben Gräser bis jetzt stärker als die kleinen Triebe, mit denen man immer wieder in den letzten Jahrzehnten einen neuen Wald auf dem Laaer Berg züchten wollte.
Man kann sie als Parabel nehmen, diese Steppengräser, die den Platz der alten Bäume eingenommen haben.. Auch die Seelen der Menschen, die weiter unten in den Zinskasernen wohnten und wohnen, sind versteppt, wenn man so sagen kann. Hier, in der „Kreta“, wie das Gebiet zwischen Quellenstraße und Laaer Wäldchen von seinen Bewohnern genannt wird, wurden vor mehr als einem halben Jahrhundert die ersten kommunistischen Zellen Wiens gegründet, versammelten sich in dunklen Hinterzimmern die ersten Wiener Sozialisten. Und die Propagandaredner der neuen Lehre fanden offene Ohren bei den Arbeitern, die bei hohen Zinsen in menschenunwürdigen Wohnungen hausten und in rußigen Fabrikhallen bei heute unfaßbaren Bedingungen roboten mußten.
Erschütternd und erschreckend ist, was der Priester der Barackenkirche über die religiöse Situation seiner Gemeinde berichtet. Von den rund 6000 Bewohnern der „Kreta“ gehören kaum noch fünfzig Prozent wenigstens ihrem Taufschein nach einer Religionsgemeinschaft an.
Einige Hundert nur von ihnen besuchen an jedem Sonntag den Gottesdienst in der Baracke mit dem Kreuz. Da steht etwa ein Wohnblock.in der Nähe, von dessen neunhundert Parteien nur fünfundzwanzig mehr oder weniger regelmäßig am Sonntag zur Messe kommen. Ein Haus, von dessen dreißig Familien fünf oder sechs allsonntäglich zur Kirche gehen, müsse man, so meint der Pater, hier schon als „christlich“ bezeichnen.
Sie verdienen allen Respekt und unsere ganze Hochachtung, diese wenigen Christen in der „Kreta“. Nicht nur mit der Gleichgültigkeit der Nachbarn, sondern mit blindem, eiferndem Haß müssen sie täglich aufs Neue fertigwerden.
Man zeigt mit den Fingern auf sie. Man lacht sie aus, man schmäht sie, man beschimpft sie in unflätigster Weise. Man beschmiert der als „schwarz“ verrufenen Nachbarin am Morgen ihre Wohnungstür mit dem Kot der Nacht, und hinter geöffneten Gucklöchern warten hämische Gesichter auf die Tränen der gläubigen Frau. Auch der Pater findet die Kirchentür oft besudelt, wenn er am Morgen die Messe lesen geht. Oefter schon raubten Diebe den Opferstock des armseligen Gotteshauses aus. Und erst vor einiger Zeit wurden die beiden Hütten abendelang von zumeist jugendlichen Plattenbrüdern regelrecht belagert. Eine Stunde lang lagen die Baracken einmal nach Einbruch der Dunkelheit im Trommelfeuer faustgroßer Steine.
Trotzdem kann der Pater auch Positives berichten. Die paar hundert ständigen Kirchenbesucher, erzählt er, halten zusammen wie eine große Familie, helfen sich gegenseitig, wo es möglich und nötig ist. Und, eigenartig, die verwahrlosten Kinder aus der Umgebung, die meisten von ihnen deshalb verwahrlost, weil beide Elternteile in Arbeit stehen, kommen zur Kirche und zum Priester, ohne daß sie jemand eingeladen hat. Vor allem während der Ferien sind den ganzen Tag über Kinder und Jugendliche in der Nähe der Notkirche zu finden. Auf diese Kinder könnte man, meint Pater Scharf, in günstigem Sinn Einfluß nehmen. Natürlich müßte das recht behutsam geschehen. Ein wichtiger Bestandteil des modernen Kirchenkomplexes, der nun in absehbarer Zeit die Baracken ersetzen soll, wird darum ein Jugendheim sein.
Man kommt in Versuchung, nun als Erklärung für die Situation in der „Kreta“ — die durchaus kein Einzelfall ist — das verbrauchte Schlagwort vom „Dschungel der Großstadt“ zu gebrauchen.
Allerdings wäre dieses freilich recht kraß formulierte Wort gar nicht so falsch am Platz. Denn da ist diese irgendwie wieder urtümliche Landschaft, zu der Natur, Schrebergärten, Zinskasernen, Fabriken und „Mistgstätten“ in wenigen Jahrzehnten verwachsen und verschmolzen sind. Und da sind die Menschen in dieser Landschaft: ihre Großeltern wurden noch nach den Lehren der Kirche erzogen. Ihre Eltern waren Marxisten, sie selbst sind Heiden. Ziel ihres Strebens ist der höhere Lebensstandard, und ihre Kinder wachsen ohne Weltanschauung heran, bilden sich ihr Weltbild nach den Wertmaßstäben des Kinos.
Von ihren Fenstern sehen manche dieser Menschen den Stephansturm. Aber die Lehre Christi, die allein stärker ist als Marxismus und Materialismus, muß ihnen wieder neu verkündet werden, wie ihren Ahnen vor mehr als tausend Jahren, wie einem Eingeborenen im afrikanischen Busch.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!