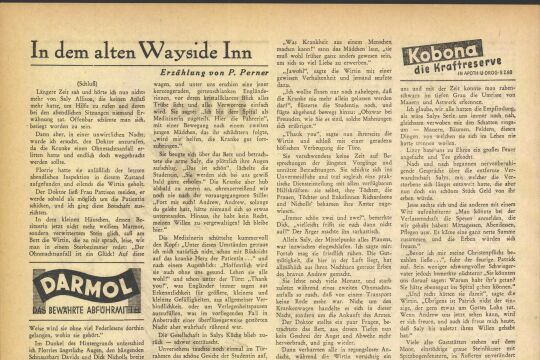Deutsch-tschechischer Schlagbaum bei Waidhaus-Rosvadov. Fünfzehn Minuten Grenzformalitäten bei den Tschechen, gut das Zweifache bei den besorgten Landsleuten. Die Fahrt verläuft ohne das kleinste Hindernis: von Pilsen immer südöstlich in Richtung Strakonice. Gute, aber leere Straßen, erstaunlicherweise noch immer von frommen Marterln, Brücken, erstaunlicherweise noch immer von den alten Nepomuk-Fi-guren bewacht.
Eine Klasse Zwölfjähriger wäscht im Kollektiv ihren am Dorfteich geparkten Schulbus; der Lehrer teilt die Schwämme dazu aus. Ein Acker: Soldaten helfen bei der Kartoffelernte. Ein Landarbeiter und seine Frau, mit denen ich bei kurzer Rast ins Plaudern zu kommen versuche, brechen beinahe in Tränen aus, als sie gewahr werden, daß sie sich mir nicht mitteilen können. In Pilsen funktionierte die Verständigung auf Deutsch noch spielend; hier, auf dem flachen Land, müssen eventuelle Gesprächspartner immer erst durch hilfsbereite Vermittler herangeschafft werden.
Kurz bevor die Kreisstadt Strakonice erreicht ist und der Kilometerzähler einen Zuwachs von 160 anzeigt, biegt rechter Hand die Bezirksstraße nach Radomischl ab. Aber ehe ich noch recht — auf meiner russischen Autokarte — das letzte Strek-kenstück vorm Ziel zu klären imstande bin, steht vor mir, unverkennbar und als ob es mir den Weg verstellen wollte, das Schloß. Schloß Osek. Gepflegt, in frisches Mattgelb getaucht, sorgfältig eingefriedet, mit akkurat gescheitelten Blumenbeeten im Park und säuberlich geharkten Kieswegen — der Kontrast zum verlotterten Äußeren des übrigen Dorfs ist auf den ersten Blick evident.
Das Tor steht offen, aber ich denke, ich sollte nichts überstürzen. Die Kette von Frustrationen, als die mir des Landvermessers K. Annäherung ans Schloß in Erinnerung ist, lähmt meinen Schritt. Nein, so einfach sollte ich es mir nicht machen. Ich widerstehe also der Versuchung meinem Ziel Hals über Kopf ins Haus zu fallen, und begebe mich zunächst ins Dorf. In das Dorf, aus dem die Kafkas kommen und von dem die Kafka-Forscher sagen, daß es dem Dichter das Modell für seinen Roman geliefert habe. Das Dorf, in dem Großvater Jakob seine Fleischhauerei betrieb, ehe er, der letzte Jude der Gegend, 1889 auf dem hebräischen Friedhof bestattet wurde; das Dorf, aus dem Vater Hermann im Alter von 14 Jahren als Wanderhändler auszog; das Dorf endlich, das auch der Prager Galanteriewarenhändlerssohn Franz von wiederholten Besuchen bei den Verwandten,.von seinen Schulferien und vom großväterlichen Begräbnis her kannte.
„Erinnerungen aus Kindheit und Jugend ... waren für Kafka immer Beispiele, Materialien, Beweise“, sagt sein Biograph Klaus Wagenbach, schränkte jedoch, in bezug auf die „Realitätsablagerungen“ in dem Roman „Das Schloß“, sogleich ein: „Es bleibt bei Einzelheiten, bei einem Grundmuster... Mehr Interferenz als Identität. Um so mehr einem Text gegenüber, der von Nichtheimat, von Unbürgerschaft handelt. Ein Vierzigjähriger versucht, eine Erinnerung zu vermessen. Freilich mit dem in den vorausgegangenen drei Jahrzehnten erworbenen Instrumentarium. Mit der Kenntnis eines verwaltenden und bürokratischen Apparats und seiner Hierarchie. Mit der Erfahrung der Heimatlosigkeit, ledig, an drei Verlobungen gescheitert, lungenkrank, ein pensionierter Beamter mit unklarer Nationalität. Die Vermessung mißlingt, der Roman ,Das Schloß' ist die Beschreibung dieses Mißlingens.“
Es war spätabends, als K. ankam ... Vom Schloßberg war nichts zu sehen. Nebel und Finsternis umgaben ihn, auch nicht der schwächste Lichtschein deutete das große Schloß an... Im Wirtshaus war man noch wach, der Wirt hatte zwar keine Zimmer zu vermieten, aber er wollte, von dem späten Gast äußerst überrascht und verwirrt, K. in der Wirtsstube auf einem Strohsack schlafen lassen. K. war damit einverstanden. Einige Bauern waren noch beim Bier, aber er wollte sich mit niemandem unterhalten, holte selbst den Strohsack vom Dachboden und legte sich in der Nähe des Ofens hin. Warm war es, die Bauern waren still, ein wenig prüfte er sie noch mit den müden Augen, dann schlief er ein.
Beim Dorfwirt herrschte Hochbetrieb. Das Strakonitzer Bier fließt in
Strömen. Wo der Schankbursche nicht nachkommt, zapfen sich die Gäste selber ihr „pivo“ ab. Es sind Landarbeiter in Drillichanzügen, manche jüngere auch — mit einem entfernten Anflug von Chic — in Perlonanoraks. Auf einem der Tische ein Transistorradio. Das Gastzimmer einheitlich in einem und demselben Grundmuster, doch — verzweifelte Koketterie — in von Wand zu Wand wechselnden Farben getüncht. Alles an diesem Wirtshaus ist so aufs ästhetische Minimum reduziert, daß auch sein Name folgerichtig weder „Zum Roten Ochsen“ noch „Zur Goldenen Kanne“, sondern schlicht und nüchtern „Bier und Limonade“ heißt.
Mir stellt man Bier und Schnaps und Brot auf den Tisch, später noch gefolgt von einer Schüssel dicklicher Leberknödelsuppe. Der penetrante Sagozusatz verrät ihre Herkunft aus der Dose. Dennoch: Für meinen leeren Magen an diesem kalten Spätnachmittag ein wahres Labsal.
Ich hole Blicke ein — es sind Blicke, die mir sagen: Hier ist nicht der Ort für literaturtopographische Recherchen. Hier ist nicht einmal der Ort für ein noch so bescheidenes Nachtlager. Tatsächlich erwidern mir auf diesbezügliche Erkundigungen alle mit einem Wort: Straconice.
Aber bis dahin ist noch genug Zeit. Ich zahle meine Zeche, schlage den Mantelkragen hoch und setze die Suche nach irgendeiner Menschenseele fort, der ich mich verständlich machen kann. Denn ich bin hier ein Fremder, ein ungebetener Gast — wie der Landvermesser K.
„Ihr wundert euch wahrscheinlich über die geringe Gastfreundlichkeit“, sagte der Mann, „aber Gastfreundlichkeit ist bei uns nicht Sitte, wir brauchen keine Gäste.“
Osek braucht keine Gäste. Und die Gäste brauchen kein Osek. Das wenige, was es zu sehen gibt, ist überall ansehnlicher als hier. Der Dorfteich: ein Brei aus Schmutz; die Dorfstraße: ein paar windschiefe Katen; die Synagoge: längst zur Eisenkammer, Schlachtküche und Scheune devastiert; der Judenfriedhof mit Großvater Kafkas Grabstätte: aufgelassen, selber unter Waldlaub und Unkraut begraben; das Kafka-Haus zu Füßen des Schloßhügels: aufgestockt und ausgebaut. Seine Bewohner? Einer der Nachbarn antwortet auf meine Frage mit geringschätzigem Achselzucken: „Kein Kafka, mein Herr. Ein Hajek.“ Schule und Kirche? Im Nachbarort Radomischl. Und dort auch der Bahnhof, wo einmal im Tag der Schnellzug aus Prag durchfährt. Was sonst noch? Knappe 200 Einwohner, aber eine eigene Fußballmannschaft — es scheint, als wenn dies das einzige Bemerkenswerte an dem trüben südböhmischen Nest Osek sein sollte. Es sei denn, sein Schloß...
Im Näherkommen enttäuschte ihn das Schloß, es war doch nur ein recht elendes Städtchen, aus Dorfhäusern zusammengetragen... Der Turm ... war ein einförmiger Rundbau, zum Teil gnädig von Efeu verdeckt, mit kleinen Fenstern, die jetzt in der Sonne aufstrahlten — etwas Irrsinniges hatte das —, und einem söllerartigen Abschluß, dessen Mauerzinnen unsicher, unregelmäßig, brüchig, wie von ängstlicher oder nachlässiger Kinderhand gezeichnet, sich in den blauen Himmel zackten. Es war, wie wenn ein trübseliger Hausbewohner, der gerechterweise im entlegensten Zimmer des Hauses sich hätte eingesperrt hatten sollen, das Dach durchbrochen und sich erhoben hätte, um sich der Welt zu zeigen.
Schloß Osek hatte für den normalen Sterblichen nichts von jener Unnahbarkeit eingebüßt, die Kafkas Landvermesser K. bis an den Rand der Verzweiflung zermürbte. Die diskret angebrachte Tafel am Pförtnerhaus verrät wenig Präzises über den heutigen Verwendungszweck der Anlage: „Ustav socialni pece“ —
„Institut für soziale Wohlfahrt“. Dafür aber gibt schon der erste flüchtige Blick über den Zaun darüber Aufschluß, um welche Art von Wohlfahrt es sich hier handelt und wem sie gilt: offene Münder, glasige Augen, Kinderlachen Erwachsener, Schloß Osek ist eine Bewahrungsanstalt für ent-wicklungsgestörte Jugendliche. An die 200 Debile dämmern hier dahin, durchweg Burschen. Bis sie die 25 erreicht haben, bleiben sie da; dann werden sie umgesiedelt. Die Leute im Dorf haben, soweit ich sie dazu befragen kann, eine untadelige Einstellung zu den neuen Schloßinsassen: „Sie sind ja völlig harmlos, die armen Teufel“, sagen sie. „No, wirklich.“ Und wenn einmal doch einer von ihnen gewalttäig wird wie neulich, als einer Nonne das Nasenbein zertrümmert wurde? „No, dann kommt er halt in die Zwangsjacke und wird abgeholt.“
Ja, die Nonnen. Man sagt, sie seien aus der Slowakei herübergekommen, ein dem heiligen Vinzenz geweihter Orden. Sie sorgen nicht nur für ihre hilflosem Schützlinge — auch das Dorf profitiert von ihnen: Wer einer ambulanten Behandlung, einer schmerzstillenden Injektion, eines Medikaments bedarf, geht zu den Schwestern ins Schloß, und zu den Schwestern ins Schloß geht auch, wer an der alten Übung festhält, sonntags einem Meßopfer beizuwohnen. Denn der Geistliche, der dem „Institut für soziale Wohlfahrt“ zugeteilt ist, liest regelmäßig in der Schloßkapelle drei Messen: die erste um halb sieben für die Nonnen, die um acht fürs Dorf, die letzte, um halb elf, für die Anstaltsinsassen.
Ich gehe das Schloßgelände ab, verifiziere Stein um Stein die Beschreibung, wie Kafka sie von ihm gibt, und bleibe schließlich betroffen an Vokabeln wie „irrsinnig“, „trübselig“ und „eingesperrt“ hängen. Dichterische Antizipation? Gewiß nicht. Und doch fällt es schwer, einfach darüber hinwegzulesen.
Vor dem Schloß hat unterdessen ein klappriger Pkw angehalten. Ein Ehepaar in den Fünfzigern bringt seinem verlorenen Sohn ein paar jahreszeitliche Gaben: Eingekochtes, Powidlkrapfen, Grammelschmalz.
Der Frau, die ein vorzügliches Deutsch spricht, gerät ein gerührter Ton in die Stimme, wenn man die Sprache auf die alte Zeit bringt. „Der Herr Baron, dem früher das Schloß gehört hat, was war er doch für ein lieber, guter Herr. Ja, jetzt sind halt wir die Großgrundbesitzer. Wir, das Volk. Aber schaun sie mich an: Sehen Großgrundbesitzer so aus?“ Sie sagt es ohne Bitternis, fast amüsiert. Sie haben sich abgefunden. Mit allem: mit den Parteilautsprechern drunten in den Dorfstraßen und auch mit den harmlosen Idioten droben im Tchloß. Noch immer, so denken sie vielleicht, besser das stumpfe Lallen und irre Kichern der Debilen als die unheimliche Stille der Diktatur.
„Ich möchte hier gerne übernachten“, sagte K. „Das ist leider unmöglich“, sagte der Wirt. „Sie scheinen es noch nicht zu wissen. Das
Haus ist ausschließlich für die Herren vom Schloß bestimmt.“
Nachtlager in Strakonice. Hier hat wiederholt der Prager Gymnasiast Franz Kafka bei einer Tante die .Sommerferien verbracht. Heute eine eher abweisende Industriestadt mit Motorradwerk und Fezfabrik, mit Burgmuseum und Kulturhaus. Das Hotel, in dem ich auf allgemeinen Rat absteige, hält nicht, was sein zauberhafter Name verspricht: „Svanda dudakü — „Schwanda, der Dudelsackpfeifer.“
Die einzige Überraschung weit und breit bietet eine Plakatwand am Re-volucni namesti, die ich aufmerksam studiere. Hier erfahre ich, daß der Bukarester Staatszirkus dagewesen ist, daß ein Theatergastspiel mit „Play Strindberg“ bevorsteht, daß der örtliche Filmovy Klub „Jagdszenen aus Niederbayern“ ankündigt. Und eine Woche darauf, erst auf den zweiten Blick entzifferbar, „Proces“ — nach dem Roman von France Kafky.
Fiebrig tastet mein Auge den Rest des Plakats ab: Ob nicht am Ende doch auch, wer weiß, „Das Schloß“, Noelte, Schell... ? Aber nichts dergleichen. Nun, ich sollte nicht unersättlich sein. Hatte ich denn schon so bald vergessen, was die Verkäuferin droben im Kafka-Haus im Prager Alchimistengäßchen zu mir gesagt hatte, als ich die Buchausgabe des Protokolls der Kafka-Konferenz von Liblice in Händen hielt?: „Ich tät's nehmen an Ihrer Stelle, mein Herr. Ein Restposten — nur, solange der Vorrat reicht. Sie können mir glauben: Kafka — da kommt so schnell nichts mehr nach.“