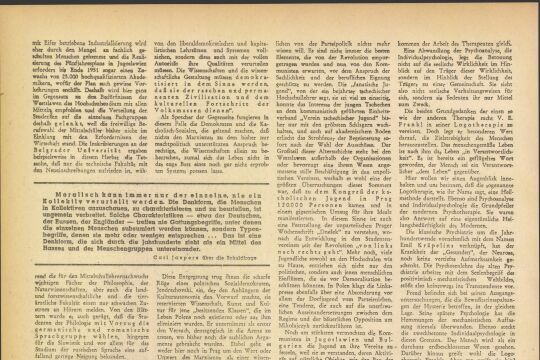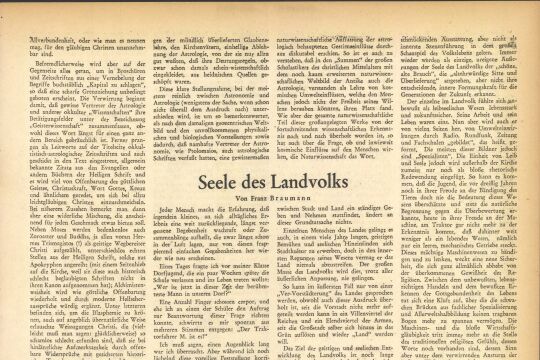Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
VOM UNSICHTBAREN KÖNIGREICH
Der Mensch soll von Zeit zu Zeit auferstehen, d. h. sich mit Bewußtsein erneuern. Das Leben, im Alltäglichen verlaufend, wird nur zu leicht Gewohnheit und Gewöhnlichkeit. Trott statt empfindender Bewegung.
Das verdumpft die Seele, stumpft den Geist ab und macht den Körper schwerfällig und lässig. Es liegt nur am Menschen, daß er, gleich der Natur, aus Welken und Absterben wieder zu sich selbst erwache und erblühe. Das geschieht aber nicht, indem man sich gehen läßt, sich abfindet und den Nacken unterm Joch senkt, sondern indem man sich, und sei's mit einem schmerzhaften Ruck, aufrichtet, Anspräche ans Leben erhebt und kräftiger ausschreitet. Das Altern ist vor allem eine Ge-n.ütskrankheit. Wer sich verdrossen abschließt, mürrisch einspinnt, der versauert. Nichts ermüdet so sehr wie die Trägheit, die körperliche und die moralische. Je ferner und je höher das Ziel, das sich einer setzt, um so reicher quillt ihm, dem Unternehmenden, das Selbstvertrauen.
Vor allem tut eines not, was, wie alles Lebendige, Lebenspendende, im Evangelium steht: Sorge dich nicht ängstlich um die Stillung deines armseligen Bedürfnisses, sondern hoffe auf den göttlichen Beistand! Das aber heißt, nach einem alten schönen Wort: Mensch, werde wesentlich!
Das Wesentliche in dir ist, was von Gott stammt. Dieses dein göttliches Erbe, die Seele, laß in dir auferstehen, „erwirb es, um es zu besitzen“.
Die Menschen von heute haben „keine Zeit“. Nicht aber deshalb, weil sie etwa mehr Zeit als andere sonst zu ihren Geschäften brauchten (es sind nicht Taten, was sie verrichten, sondern Geschäfte), vielmehr darum, weil sie die Zeit „vertreiben“ Wörtlich: Sie treiben sie vor sich her, hetzen sie und klagen dann, daß sie ihnen entgehe, entfliehe.
Das Leben ist kurz, aber die Zeit ist lang. Nur unsere Schuld ist's, daß sie nicht langt. Weil wir sie verkürzen. Unsere eigene Hast und Uniast ist es. die wir, sie überhastend, ihr versetzen. Wir fälschen sie, die Dauer ist, Weile, zur Frist, zum Augenblick.
Wozu die Eile in allem, was der M :nsch treibt? Wozu die Beschleunigung des Daseins, die Vorwegnahme der Zukunft? Als der Mensch noch wandernd die Welt durchstreifte oder zu Pferd und im Postwagen gemächlich sein Ziel erstrebte, war Wandern eine Lust, war Reiten und Fahren gelassene Umschau. Man. erlebte, was Weg und Umgebung boten. Und am Ziel gab es behagliches Rasren, Niederlassung und Aufenthalt. Heute rast, saust, staubt und fliegt man dahin, überwindet „Strecken“, und der Gewinn an Zeit ist Verlust am Leben. Ja, das Leben selbst steht dabei stets auf dem Spiel, dem sinnlosen Spiel der „Leistung“.
Der Dauer entspricht die Ferne. ;Ferne heißt Sehnsucht. Traum, Schönheit. Wir überraschen die&erttKucrrt.- zerstören den T^ur^yh*nden1ie.Sanönh£it_^äfei# Ernüchterung. Erfüllung - ist Enttäuschung.
Was ist das Ergebnis all dieser lärmenden Betriebsamkeit? Erschöpfung und Ekel. Genuß will erworben, nicht errafft sein. Erfolg ist Lohn, nicht Gewinn. Freude ist Befriedigung. Das Glück flüchtet im Taumel. Alles Unheil entsteht aus der Unruhe.
Unsere Zeit kennzeichnet der erbärmliche Kreislauf von Geschäft und Vergnügen. Geschäft, das ist nicht die dem gesunden Menschen unumgängliche Arbeit, die schaffensfrohe Betätigung des Tauglichen am Werk, das ihm als seine Berufung Beruf geworden ist, ihm als gediegene und ergiebige Leistung seine Tüchtigkeit bestätigt und ihn mit Genugtuung erfüllt, sondern ein ausschließlich auf Gewinn, womöglich raschen und mühelosen, gerichtetes, mehr oder minder zufälliges und meist überflüssiges, ja wohl gar schädliches Unternehmen, das Kniffigkeit, Aufdringlichkeit und Unverfrorenheit weit eher voraussetzt als Fähigkeit, Fleiß und Ausdauer, Unaufrichtigkeit eher als Ehrlichkeit, Schamlosigkeit eher als Selbstachtung. Die Befriedigung am Erfolg wertvoller Arbeit gewährt Sicherheit und Ansehen, der Arbeit eignet Würde und Schönheit; selbst die sogenannte knechtische muß den Menschen durchaus nicht erniedrigen. Geschäft aber als Aufgabe wendet sich an den gemeinsten aller Triebe, den Eigennutz, der vor der Übervorteilung anderer nicht zurückschreckt. Vor allem ist der Arbeit die Freude nicht fremd, nicht etwa ihr Gegensatz, sondern quillt geradezu aus ihr und weiht die wohlverdiente Muße, die nicht Flucht bedeutet aus lästiger, verhaßter Mühsal in die Trägheit, sondern erfrischendes Atemholen, erquickende Rast. Freude ist heilig. Sie kommt vom Herzen und geht zu Herzen. Freude ist rein und stark und voll. Vergnügen aber ist leer und hinfällig. Nur armselige Menschen gehen auf Vergnügen aus, das sie lockt und enttäuscht, schwächt und nur zu oft besudelt.
Geschmacklos ist alles, was gegen den guten Geschmack verstößt. Der gute Geschmack ist weder jedermanns Sache noch Geschmacksaohe, sondern das ungeschriebene Gesetz, das unter Menschen von Kultur, das ist übereingestimmter äußerer Bildung, das Verhalten beherrscht. Verhalten ist die Art, wie etwas Lebendiges mehr oder weniger bewußt einwirkt. Ein Stein hat kein Verhalten; auch hat man zu einem Stein kein Verhalten. Verhalten kann auch mit sich selbst allein sein; dann wirkt es auf den so Vereinzelten zurück.
Geschmack ist nicht (äußere) Regel, sondern (inneres) Gesetz. Er ist als Kraft unmittelbar wirksam, wird nicht als Vorschrift befolgt. Geschmack kann nicht erlernt, wohl aber erbildet werden. Wie Gehör.
Geschmack trifft, ohne zu zielen. Er ist richtig ohne „Richtung“. Er weiß ohne Aufwand. Er faßt, ohne zu tasten. Er ist unfehlbar, weil er, ohne sich überzeugen zu müssen, in seiner Sicherheit ruht. Er ist sozusagen blinder Zusammenhang.
Außerhalb der Menschenwelt hat Geschmack nichts zu schaffen. Sein Sinn erlischt mit der Vernunft. Das Wesen der Pflanzen und der Tiere ist reiner Zustand. Nur der Mensch vermag seinen Zustand durch Bewußtsein zu steigern. Er schafft Sitte.
Wo Sitte befiehlt, gehorcht die Natur, hat sie Schweigen und Reden gelernt (während sie bis dahin gesprochen hatte, wann und wie es sie dazu drängte).
Man ist bei uns seit geraumer Zeit des Gefühls für den guten schriftlichen Ausdruck verlustig geworden. Allzu massenhaftes Geschreibe hat es allmählich abgestumpft, und die Muster werden eben deshalb kaum mehr gelesen. Der Stand des Schreibstils ist insbesondere durch die nur zu oft von Unzuständigen bestrittene Zeitungsschreiberei herabgekommen. Aber auch die Schule legt leider längst nicht mehr gebührendes Gewicht auf die Heranbildung zulänglichen, geschweige denn trefflichen Gebrauchs der Schriftsprache. Immer wieder begegnet der an den Umgang mit Vollendetem Gewöhnte einer geradezu verblüffenden Begnügsamkeit des gemeinhin gültigen Urteils über Stilleistung. Man bewundert und preist Schriftsteller um ihres angeblichen Könnens willen, die dem empfindsamen Kenner auf den ersten Blick als stümpernde Macher, mühselige Stammler sich erweisen, ja, es werden als Meister .Schreiber hinaufgelobt und von der Lesermenge als solche gläubig hingenommen, die wegen unheilbarer Unfähigkeit, die Sprache zu behandeln, füglich als abschreckende und lächerliche Zerrbilder dem allgemeinen Spott auszuliefern wären.
Freilich: solches Verfahren setzte das eben voraus, was verlorengegangen, zerstört worden ist: jenes allgemeine oder wenigstens verbreitete Gefühl für das Gesetzmäßige, das eine literarische Kultur ausmacht. Der schlechte Autor hat es leicht: ein' ihm aus irgendeinem Grunde gewogenes Urteil Urteilsunfähiger läßt sich immer durchsetzen, es braucht nur mit einigem Lärm sich zu betätigen. Der Leser nimmt alles hin. Ja, es ist vielleicht das sicherste Kennzeichen der allgemeinen Verwahrlosung, daß nicht etwa, was einen Umschwung immerhin möglich machte, nur das Schlechte, sondern Schlechtes und Gutes nebeneinander sich zur Geltung bringen mögen. Wahllosigkeit ist schlimmer als ausgesprochenermaßen übler Geschmack. Wer z. B. eine der wimmelnden elenden Übarsetzungen fremdsprachiger Meisterwerke fühllos für das ihm dargebotene Unding zu genießen imstande ist — und Hunderttausende der sogenannten gebildeten Kreise sind es .imstande —. dessen literarischer Gaumen ist stumpf für die gediegene Wiedergabe fremder Sprachschöpfung; diese hat demnach keine Aussicht, sich gegenüber der unwürdigen zu bewähren: es merkt ja niemand, daß sie sich davon unterscheide.
Gut schreiben heißt stark und geschmeidig, richtig, klar und in dem eigentümlichen Rhythmus schreiben, der der Persönlichkeit des Schreibenden die sie kennzeichnende geistige Haltung — nicht so sehr Züge als Ausdruck — verleiht. Man schreibt nicht für das Auge, sondern für das Ohr. Es sind Gesetze des Maßes, genauer: des Zeitmaßes, die sich im Stil aussprechen. Man lese - P-tpji? des 'großen französischen Jahrhunderts, des 17., lind vev---gleiche damitsdeutsche Prosa derselben Zeit. Man vergleiche französische Prosa vom Ende des 18. Jahrhunderts mit iener wunderbaren, die mit dem Provinciales Pascals soeleich die Höhe erreicht hat. Wer nicht Gehör für derlei Entwicklungen und die Zwei- und Mehrstimmigkeit einer Zeit besitzt, dem ist nicht zu raten, der verdient das Lesefutter, das ihm verabreicht wird.
Aus dem I, Band der Gesammelte Werke in Auswahl, herausgegeben von Lotte von Schaukai, Amandus-Verlag, Wien-Köln
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!