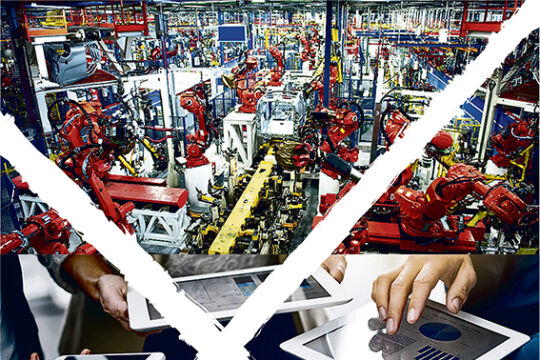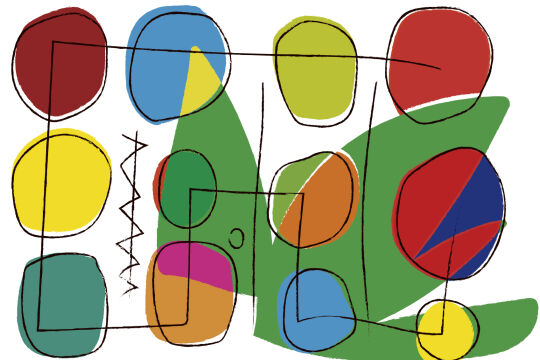Jeder weiß es: Information und Kommunikation erhalten einen neuen Platz in unser aller Leben. Auch die Universität kann in dem entstehenden Gefüge der Informationsgesellschaft nicht mehr die Rolle spielen, die sie bis zu deren Beginn innehatte. Brauchen wir sie überhaupt noch, wenn jedermann wohlfeil an jede Art von Information herankommen kann? Und wenn wir sie noch brauchen, was müßte dann ihre neue Bolle sein?
Wenn unsere Gesellschaft immer mehr Information produziert und diese immer schneller in Umlauf bringt, dann ist eigentlich ein Grundantrieb der Universität auf das Schönste erfüllt. Denn „Wissen" und „Information" sind zunächst einmal positive Begriffe, die von der Idee der Universität nicht zu trennen sind, stand doch die Suche nach „Wahrheit" , also die Produktion von Wissen, an ihrem Ursprung. Wissen soll frei machen von Ängsten und Abhängigkeiten. Seitdem die Menschheit den Erreger der Pest kennt, müssen wir uns nicht mehr davor fürchten, wie die Menschen im Mittelalter. Es werden nicht mehr ganze Städte und Landstriche entvölkert. Wissen ist gut, Wissen macht frei.
Bildung ist jedoch etwas anderes als Anhäufung von Wissen. So alt wie die Hochschätzung des Wissens, so alt ist auch das Mißtrauen dagegen. Schon von Heraklit stammt der poetisch ins Deutsche übersetzte Satz: „Vielwisse-rei Vernunfthaben nicht lehrt." Als Enzyklopädismus kritisiert wird seit Jahrhunderten ein Erziehungsideal, das auf Wissensanhäufung zielt. Die bloße Vermehrung von Information wird als hinderlich für die individuelle Bildung angesehen. Die Überhäufung mit Information ist ein Mittel der Desinformation.
Für Identität und Bildung ist nicht die Information an sich relevant, sondern die subjektiv bedeutsame Information. Und subjektiv bedeutsam werden für das Individuum nur solche Informationen, die mit Erfahrungen und Handlungen verbunden sind, mit Gefühlen und Wertempfinden. Worauf die Informationsgesellschaft stolz ist, sind allerdings Informationen ganz anderer Art. Nach dem Informatik-Professor Klaus Brunnstein ist „das, was über die Netze fließt, ... keine Information mehr. Es sind dekontextuali-sierte, des ursprünglichen Sinns beraubte, mehrfach manipulierte Informationen', die keine Autorenschaft und keinen Adressatenkreis mehr kennen".
Die Anhäufung solcher dekontex-tualisierter Informationen ist für Bildungsprozesse wertlos - deshalb die pädagogische Mißbilligung des Begriffeklopfens und Auswendiglernens. Wir tragen alle einen ganzen Rucksack solcher unverbundener Informationspartikel und leerer Sprach -hülsen mit uns herum und gelegentlich kann es geschehen, daß sich zum Beispiel plötzlich ein altes Sprichwort mit Sinn und subjektiver Bedeutung füllt.
Die dekontextualisierten Informationen in den Netzen werden zunehmend als die eigentlich wichtigen angesehen. „Mehr" und „schneller" wird als der wahre Fortschritt wahrgenommen. Die Vorstellung macht sich breit, der Zugriff auf unbegrenzte Informationsmengen plus die Fähigkeit des Zugreifens ergäben das moderne Korrelat von Bildung. In dieser Vorstellung verschwimmt der fundamentale Unterschied zwischen dekontextualisierter Information und individuell bedeutsamem Orientierungswissen.
Am störendsten für den Bildungsprozeß dürfte jedoch die Fiktion der objektiven Information sein, die dem gesamten Projekt der Informationsgesellschaft zugrundeliegt. Nach diesem Denkansatz ist es möglich, Informationen aus ihrem subjektiven und historischen Kontext herauszulösen, ohne sie selbst zu verändern. So als wäre die Entdeckung des Atoms noch dasselbe nach Hiroshima oder die Entschlüsselung des genetischen Codes noch dasselbe nach den ersten ingenieurmäßig desi-gnten Tieren. Es gibt keine Bedeutungen, die in anderen Kontexten konstant bleiben würden. Immer mehr Information, immer schnellere Übermittlung - das ist allerdings nicht nur für die Identität der Individuen ein Problem, sondern auch für den Diskurs der Gesellschaft. Die Verständigungsmöglichkeiten über einen gesellschaftlichen Minimalkonsens scheinen unter dem Ansturm des Wissenswachstums dahinzuschmel-zen. Denn unter den Bedingungen einer Informationsfülle, die jegliche Diskursmöglichkeiten übersteigt, läßt sich Wissen relativ unkontrolliert instrumentalisieren. Interessierte Gruppen wenden ohne gesellschaftliche Verständigung Informationen an und schaffen damit neue soziale Wirklichkeiten.
Warum veranstalten wir das Ganze? Woher kommt die Triebkraft dieser Entwicklung? Sie steht im Zusammenhang mit einem mächtigen ideologischen Komplex, der das zeitgenössische politische Handeln und Denken beherrscht: mit dem Mythos des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, in dem gegenwärtig die Informations- und Kommunikations-techniken eine Schlüsselrolle einnehmen. Der Mythos wird von einem Diskurs gefüttert, der Aussagen wie die folgenden dutzend- und hundertweis hervorbringt, in der Tageszeitung, in Ministerien, auf Bektoren-konferenzen, auf Gewerkschaftstagungen, wo immer: „Der technische Fortschritt zwingt uns, das und das zu tun." „Um den internationalen Wettbewerb zu bestehen, müssen wir ..." „Wir müssen uns rüsten für das dritte Jahrtausend." „Auf dem Weg zur Europareife müssen wir ..." „Das Informations-Zeitalter kommt, deshalb müssen wir..." „Wir müssen uns den Herausforderungen der Zukunft stellen."
Diese Aussagen geben sich, ganz genau wie der französische Philosoph Roland Barthes es für Mythen beschrieben hat, als Beschreibung von schicksalhaften Zwängen, von quasi naturgesetzlichen Prozessen aus. Wenn irgendeine Maßnahme mit einer dieser Aussagen begründet wird, ist folglich keine Diskussion mehr möglich. So kraftvoll ist dieser Mythos, daß es uns ganz natürlich erscheint, wenn wir den jungen Leuten sagen, daß sie eben mehrfach berufliche Identitäten aufbauen und wieder abwerfen müssen. Und so unausweichlich, daß die Betroffenen nicht protestieren, weil sie als Schicksal verinnerlichen, was menschengemacht ist.
Der Mythos vom wissenschaftlichtechnischen Fortschritt ist ein klassisches Exempel für einen sozialen Kontext, in den wissenschaftliche Ergebnisse hineingeraten. Dieser Kontext ist es, der die Ergebnisse so zur Wirkung bringt, daß sie das soziale Wohl gefährden. Und deshalb stellt er auch ein legitimes Forschungsthema dar. Wenn die universitäre Wissenschaft wirklich zur gedeihlichen Entwicklung der menschlichen Gesellschaft beitragen soll, dann wäre diese Anstrengung in der Tat relevanter, als neue Munition für den internationalen Wettbewerb zu produzieren. Nicht die Akkumulation von Wissen noch weiter über die Kapazitätsgrenzen der Menschen hinauszutreiben, sondern die Analyse der Kontexte und die Bewertung und Aneignung des Wissens durch die Gesellschaft zu unterstützen, das müßte die Aufgabe der Universität in der sich formierenden Informationsgesellschaft sein. Denn solche Mythen schaffen heute die Abhängigkeiten und das heißt Unfreiheiten, ge'gen die die Universität einst angetreten war. Wissen soll auch heute frei machen!
Wer, wenn nicht die Universität, sollte die notwendige Aufgabe übernehmen, die sozialen Diskurse gegen die Informationstechniken, die kontextuellen Bedeutungen gegen die dekontextualisierten Codierungen verteidigen? Von industriellen Forschungslabors werden wir dies nicht erwarten können. Wenn die Universität diese Aufgabe ernst nimmt, dann ist das allerdings nicht mit ein paar Retuschen an der Studien- und For schungsplänen ge tan. Denn die Uni versität hat die Infor mationsgesellschaft mit auf den Weg ge bracht und ist tief verstrickt in deren Denkweisen, Rituale und Mythen. Das System Universität ist durchsetzt mit jenen Werten und Prinzipien der Informationsgesellschaft, die zu überwinden sie jetzt helfen sollte:
Die Formen und Rjtuale des universitären Alltagsgeschäftes drehen sich um dekontextualisiertes Wissen. Der grundlegende Modus akademischer Wissensproduktion wird in der amerikanischen Debatte treffend, als archival writingbezeichnet. Das ist eigentlich eine klassische Form von Anhäufen von Information, die kaum noch in einem kommunikativen Zusammenhang steht und nicht Teil des Diskurses ist. Das riesige Archiv der Wissenschaften gleicht immer mehr einem Entsorgungspark der akademischen Überproduktion. Bald werden wir nun den Zugriff zu jeder einzelnen aus den Abermillionen Zeilen haben - zugänglicher Müll sozusagen. Eng verbunden ist dieses Phänomen mit den universitären Qualifikations-Ritualen. Jeder Hochschullehrer kennt das Durchzählen von Publikationslisten. Kann es ein treffenderes Bild für dekontextualisierte Information geben?
In dieser Situation gibt es nur einen Ausweg: Die Universität in der Informationsgesellschaft muß Menschen heranbilden, die Wissen bewerten und Wissenskontexte analysieren können. Diese Absolventen sorgen dann für Generalisierung auf einer anderen Ebene. Unter den Bedingungen der Informationsgesellschaft wird die Lehre wichtiger als die Forschung, wird die Funktion der universitären Bildung wichtiger denn je zuvor - wenn es eine Bildung ist, die Orientierungen vermittelt, und auch die Fähigkeit, Orientierung in einer informationellen Umwelt zu gewinnen und im sozialen Kontext auszuhandeln.
Wie kann die Universität ihre . Karrieremuster so ändern, daß wir vom prolific publishing, vom ins Kraut schießenden Publizieren, wegkommen, wie ist erreichbar, daß die Leistungen in der Lehre wichtiger werden als das Produzieren von Informationen? Wie kann das wissenschaftliche Ideal der Erweiterung nomothetischen (d k gesetzgebenden, Anm. d Red) Wissens ergänzt werden durch ein kontextuelles Wissenschaftsmodell, das zeitgebundenes Wissen produziert und trotzdem als vollgültige wissenschaftliche Tätigkeit gilt? Wie können die Parameter der Forschungsförderung so geändert werden, daß diejenigen, für die doch eigentlich geforscht wird, über die Forschung mitbestimmen können statt über ein feudalistisches System nur zur Kasse gebeten zu werden, während eine Expertokratie entscheidet? (Hier mag das Gedankenspiel hilfreich sein, wie das Wissenswachstum schrumpfen würde, wenn die Forscher für ihre Projekte sammeln müßten.)
Wenn sich die Universität Fragen wie diesen nicht ernsthaft stellt - und es hat den Anschein nicht - dann wird der Legitimationsdruck gegenüber einer vom Fortschrittsmythos getriebenen Gesellschaft immer stärker werden. Und die Beaktionen der Universität werden immer kürzer gegriffene Anpassungen an die vermeintlichen Erwartungen sein.
Der Autor ist
Dekan der kulturwissenschaßlichen Fakultät der Universität Klagenfurt.