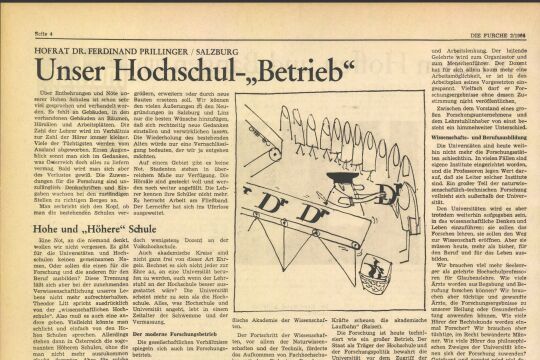Michael Hartmann, Soziologe und Elitenforscher an der TU Darmstadt,
über den "Mythos der Leistungseliten" und die Schwächen von Elite-Universitäten.
Die Furche: Was bedeutet für Sie "Elite"?
Michael Hartmann: Elite bedeutet für mich, dass es sich um Personen handelt, die in den wichtigen gesellschaftlichen Bereichen Machtpositionen besetzen. Auf Grund welcher Voraussetzung müsste man im Einzelnen betrachten. Und zweitens zeichnet sich Elite durch einen inneren Zusammenhalt aus.
Die Furche: "Elite" hat also für Sie nichts mit tatsächlicher Leistungsfähigkeit oder Kompetenz zu tun?
Hartmann: Nichts ist zu viel gesagt. In der Wissenschaft, wo "Elite" sich am schwersten definieren lässt, kann man natürlich sagen: Nobelpreisträger können auf Grund ihrer wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit Einfluss nehmen. Es gibt aber gleichzeitig viele Personen - etwa die Präsidenten der großen Forschungseinrichtungen oder der Hochschulen -, wo man sich darüber streiten kann, ob das etwas mit Leistung oder eher mit politischen Verbindungen zu tun hat. Wenn man in den Bereich der Politik geht, wird es noch schwieriger: Ist man "leistungsfähig", wenn man wiedergewählt wird? Oder wenn man das, was man den Wählern versprochen hat, auch einhält?
Die Furche: Sie haben 2002 mit der Studie "Der Mythos von den Leistungseliten" für Aufsehen gesorgt. Warum orten Sie hier einen Mythos?
Hartmann: Es ging in dieser Studie um die Besetzung von Spitzenpositionen. Einer der Anlässe war die Aussage vieler Spitzenmanager, ihre horrenden Gehaltssteigerungen hätten mit ihrer tollen Leistung zu tun. Das hat mich immer gestört, weil ich das Milieu gut kenne und weiß, dass diese Leute mit dem halben Gehalt auch nicht schlechter waren. Schließlich haben wir festgestellt, dass die soziale Herkunft ausschlaggebend dafür ist, warum diese Personen in ihre Positionen kommen. Über vier Fünftel kommen aus den oberen drei bis vier Prozent der Bevölkerung - gemessen an der beruflichen Stellung, am Jahreseinkommen und am akademischen Abschluss.
Die Furche: Der Eliten-und Exzellenzbegriff spielt gegenwärtig auch in der Universitätspolitik eine große Rolle: In Deutschland werden zehn "Elite-Universitäten" ausgewählt, und in Österreich wird ein "Exzellenz-Forschungszentrum", das AIAST (Austrian Institute for Advanced Science and Technology) etabliert. Was halten Sie von diesen Entwicklungen?
Hartmann: Es hat sich herausgestellt, dass das Erklärungsmuster "Elite bzw. Exzellenz ist gleich Spitzenleistung" genutzt worden ist, um bestimmte Dinge durchzusetzen. Auch wenn es an bestimmten Institutionen besonders leistungsfähige Leute geben mag: Aber zu behaupten, dass bestimmte Einrichtungen in ihrer Gesamtheit Elite darstellen, ist völlig unmöglich - außer man begreift Elite eben so, das diese Einrichtungen in einer Hierarchie von Hochschulen die mächtigsten sind. Und das gibt es natürlich.
Die Furche: Sie kritisieren, dass es bei der Einführung von "Elite-Hochschulen" zu einer Stärkung der Starken auf Kosten der Schwachen komme. Nun wird die Einführung solcher Institutionen gerade damit begründet, dass nicht mehr alle "nach dem Gießkannenprinzip" gefördert werden sollen ...
Hartmann: Ich halte diesen Zugang für falsch, weil man hier das US-amerikanische Modell zu kopieren versucht, das aber nicht zu kopieren ist. Die amerikanischen Spitzenuniversitäten kaufen über die Hälfte ihrer Spitzenwissenschafter weltweit ein. In manchen Bereichen sind es sogar 80, 90 Prozent. Harvard allein hat inzwischen einen Kapitalstock von 28 Milliarden Dollar und ein jährliches Budget - ohne Baumaßnahmen - von über 2,5 Milliarden Dollar. Von solchen Summen können wir nur träumen. (Das gesamte österreichische Hochschulbudget 2006 beträgt 2,481 Milliarden Euro, Anm. d. Red.) Man kann also nie auf Augenhöhe konkurrieren.
Die Furche:
Was wäre das Alternativmodell?
Hartmann: Das bisherige Alternativmodell hat gelautet: Hohe Qualität in der Breite. Das kann man auch beim jährlich erstellten Uni-Ranking der Shanghai University sehen. (Unter den zehn besten Universitäten sind acht aus den USA. Die Uni München liegt als beste deutsche Uni auf Platz 51, die Uni Wien als beste österreichische zwischen Platz 151 und 200, Anm. d. Red.) Wenn man hier den Blickwinkel etwas erweitert und nicht nur auf die ersten 50, sondern auf die ersten 500 Universitäten blickt, dann kann man feststellen, dass etwa Deutschland, bezogen auf die Bevölkerungszahl, genauso stark vertreten ist wie die USA. Außerdem hat ein Beobachter einmal sehr treffend gesagt: Die USA mögen 50 der besten Hochschulen der Welt haben, sie haben aber mit Sicherheit auch 500 der schlechtesten.
Die Furche: Es gibt also im US-Hochschulsystem eine getrennte Welt?
Hartmann: Ja, und das geht noch weiter. Im Undergraduate-Bereich bis zum Bachelor kommt es vor allem darauf an, wo man studiert - und nicht, was man studiert. Es gibt eine Reihe von Untersuchungen, die immer wieder über die schlechte Qualität der Lehrveranstaltungen klagen und feststellen, dass sich die Stars der Szene dort nie zeigen. Die wollen lieber forschen und im Master-bzw. Promotionsstudienbereich arbeiten. Die Studierenden kommen mit diesen Spitzenwissenschaftern also gar nicht in Berührung. Für sie ist das aber auch nicht entscheidend. Sie studieren dort, weil ihnen der Stempel von Harvard, Yale oder Princeton Zugang zu Führungsposition eröffnet - ob das nun in der Wirtschaft, in der Politik oder im Weißen Haus ist. Dass funktioniert so gut, weil auch jeder Ehemalige weiß, dass seine Karriere davon abhängt, dass das Image von Harvard gewahrt bleibt. Und durch die Begünstigung der Kinder von Ehemaligen sichert man auch, dass diese Institutionen weiter mit großzügigen Spenden ihrer Alumnis versorgt werden und dadurch ihren Elite-Status behaupten können. Wobei es hier zu ganz subtilen Formen sozialer Selektion kommt.
Die Furche: Inwiefern?
Hartmann: Es gibt ein Beispiel, das ich immer gerne aus den Bewerbungs-Protokollen zitiere: Eine Bewerberin zählt intellektuell zu den Besten ihres Jahrgangs, zeigt aber "Anzeichen von Schüchternheit" im Auswahl-Interview, woraufhin sie negativ bewertet wurde. Wenn man sich vorstellt, dass ein Arbeiterkind einer ganzen Kommission in Harvard gegenüber sitzt, dann ist es natürlich eingeschüchtert, egal wie brillant es ist. Wenn ein Bewerber hingegen einen Vater hat, der selbst in Harvard war und beruflich erfolgreich ist, dann sagt er sich: OK, wenn es nicht Harvard ist, ist es Yale oder eine andere Uni. Dementsprechend locker präsentiert er sich.
Die Furche: Diskriminierung orten Sie auch durch Studiengebühren. Wobei in Österreich argumentiert wurde, dass dadurch auch die Dropout-Raten schwinden würden ...
Hartmann: Wir sehen vor allem, dass die Leute schneller und schmalspuriger studieren. Das geht auf Kosten ihrer Bildung. Zweitens beobachten wir, dass eine Selektion stattfindet. Es gibt Leute, die wegen Studiengebühren von vornherein auf ein Studium verzichten. Auch in Österreich ist der anfängliche Einbruch nach Einführung der Studiengebühren zwar weitgehend ausgeglichen worden. Es bleibt aber immer noch ein Rückgang zwischen zwei und 3,5 Prozent, wobei die Frauen stärker betroffen sind. Die Gruppe, die es am stärksten betrifft, sind Frauen aus Arbeiterfamilien, weil diese bisher Studiengänge bevorzugt haben wie Pädagogik, die nur ungewisse Berufsaussichten eröffnen. Die Frage "Studiere ich so etwas und habe dann Schulden" führt deshalb oft zur Entscheidung: "Da mache ich gleich etwas anderes ..."
Die Furche: Teilen Sie auch die Meinung, dass die Geisteswissenschaften ins Hintertreffen geraten?
Hartmann: Ja. Das sieht man nicht nur an den Universitäten, sondern besonders bei der deutschen "Exzellenz-Initiative": Neben zehn Elite-Universitäten, von denen jede zusätzlich 21 Millionen Euro jährlich über fünf Jahre erhält, werden auch noch "Exzellenz-Cluster" etabliert. Von den 157 ursprünglichen Cluster-Anträgen war noch ein Viertel aus dem geistes-oder sozialwissenschaftlichen Bereich. Bei den 40, die durch die erste Prüfungsrunde gekommen sind, waren es nur noch vier. Die Medizin hat aber 14 Cluster durchgebracht. Entweder sind die Mediziner dreimal so gut wie alle Geistes-und Sozialwissenschafter zusammen - oder aber die Kriterien waren so angelegt, dass Fächer wie Germanistik oder Philosophie, die weniger Großprojekte kennen und auch auf Grund der Sprache nicht so stark internationalisiert sind, von vornherein weniger Chancen hatten. Ich halte Letzteres für zutreffend.
Die Furche: Was braucht es Ihrer Ansicht nach, um die Qualität an den Universitäten ingesamt zu heben?
Hartmann: Zunächst muss man sagen, dass schon seit langer Zeit Geld fehlt. Man hat sehr lange versucht, mit sehr wenig Ressourcen und steigenden Studierendenzahlen das Niveau zu halten. Aber irgendwann ist Schluss. Als Grundvoraussetzung muss man also mehr Geld investieren. Es gibt aber noch eine Reihe anderer Möglichkeiten: Bei uns an der Universität Darmstadt gibt es etwa ein einjähriges Lehrforschungsprojekt, bei dem Studierende während des Hauptstudiums an die Forschung herangeführt werden sollen. Solche Initiativen könnte man problemlos institutionalisieren und damit die Wissbegierde derjenigen, die wirklich in die Wissenschaft wollen, reizen - und den anderen einen noch breiteren Horizont verschaffen. Man könnte auch versuchen, ein "Studium generale" in den ersten zwei Semestern zu institutionalisieren, um zumindest kurzfristig den Blick dafür zu schärfen, dass es links und rechts auch noch etwas gibt. Im Augenblick erleben wir das Gegenteil. Da sagen die Juristen: Wir brauchen keine Soziologie oder keine Rechtsphilosophie mehr. Und die Wissenschaftsminister, die in ihren Sonntagsreden den Wert der humanistischen Bildung verteidigen, sorgen an den Hochschulen durch die Bachelorisierung dafür, dass genau diese Bildung verloren geht.
Das Gespräch führte Doris Helmberger.