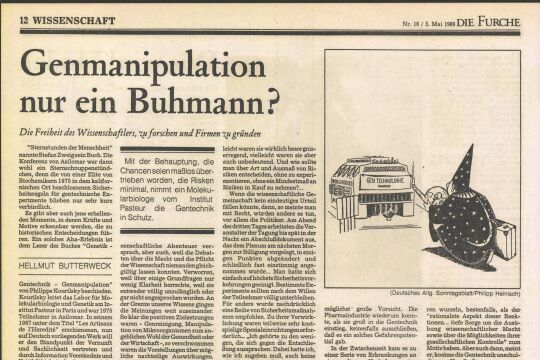Er ist gebürtiger Österreicher, beklagt als Präsident des Schweizerischen Wissenschafts- und Technologierates die Reglementierungswut der EU und warnt vor Denkverboten in der Embryonenforschung: Gottfried Schatz, jüngst zu Gast bei den Alpbacher Technologiegesprächen, im Furche-Interview.
Die Furche: Ihnen liegt die Förderung junger Forscher besonders am Herzen. Wie ist es um sie in Österreich bestellt?
Gottfried Schatz: Leider so wie in den meisten europäischen Ländern: Man kümmert sich zu wenig darum, obwohl die Situation schlecht bis katastrophal ist. Die meisten Wissenschaftspolitiker beschäftigen sich mit der Struktur der Universitäten, woher die Gelder kommen oder wie die Hierarchien aufgebaut sind. Doch sie befassen sich fast nie mit denen, die die Wissenschaft betreiben. Und die sind meist jung.
Die Furche: Kann das neue österreichische Universitätsgesetz jungen Forschern bessere Perspektiven bieten?
Schatz: Vieles an diesem Gesetz beeindruckt mich sehr. Es ist visionär und besser als das vieler anderer Staaten. Eigenartigerweise hat man aber vergessen, die Karrierestruktur für akademische Forschende zu berücksichtigen. Ich finde das fatal. Die meisten Universitätsleitungen geben diesem Problem eine ganz geringe Priorität. Aber gute Forschung kommt nur von guten Forschern. Und auch die besten Strukturen werden keine Innovationen schaffen, wenn die jungen Forschenden nicht ihre Ideen verwirklichen können.
Die Furche: Sie favorisieren das amerikanische Tenure-Track-Modell. Was kann dieses Karrieremodell in Richtung permanenter Anstellung leisten, was das heimische Dienstrecht nicht kann?
Schatz: Erstens ist es gleichzeitig selektiv und fair. Junge Forschende werden über eine internationale Ausschreibung ausgesucht und mit Hilfe internationaler Expertisen ausgewählt. Wer genommen wurde, bekommt eine Assistenzprofessur und kann unabhängig sechs oder sieben Jahre lang forschen. Nach fünf Jahren wird er oder sie wieder von außen evaluiert und bekommt erst bei entsprechender Leistung in Forschung und Lehre eine Professur. Der Vorteil gegenüber dem jetzigen System ist, dass Forschende nicht einfach in die Universität einsickern können. Heute kann ein Professor Assistenten nach eigenem Gutdünken auswählen und ihnen eine Habilitation in Aussicht stellen. Dann ist der Professor Schutzherr der Habilitation und versteht deren Erfolg als Teil des eigenen Prestiges. Das führt natürlich zu einer persönlichen Abhängigkeit, die meist auch zu einer intellektuellen wird. Die Auswahl unserer Dozenten entspricht heute in keiner Weise internationalen Qualitätsstandards.
Die Furche: In Österreich ist ein Streit über die Forschungsförderung entbrannt. Um den "Förderdschungel" zu durchforsten, will Infrastrukturminister Mathias Reichhold sämtliche Fördertöpfe in einer Gesellschaft unter seinem Dach fusionieren. Dabei befürchten viele die Zerschlagung des Grundlagenforschungsfonds FWF, der bisher von Wissenschaftern selbst verwaltet wurde. Wie könnte Ihrer Meinung nach die Forschungsförderung effizienter werden?
Schatz: Je einfacher Strukturen sind, desto besser funktionieren sie im Allgemeinen. Es hat sich aber gezeigt, dass es sinnvoll ist, zwei getrennte Förderorganisationen zu haben - eine für Grundlagenforschung, eben den FWF, und eine für industrienahe Forschung, den FFF, weil die Mechanismen der Verteilung verschieden sind. Die große Gefahr, die jetzt in Österreich besteht, ist, dass Ministerien oder auch der Wissenschaftsrat direkt Gelder vergeben. Die entsprechenden Programme lassen sich sehr gut übers Fernsehen "verkaufen", sind aber meist eine Verschwendung von Steuergeldern; die Gelder werden nämlich meist nicht sehr professionell zugesprochen und gehen oft nicht an die besten, sondern an die politisch schlauesten Forschenden.
Die Furche: Sie sind also gegenüber zusammengelegter Fonds skeptisch?
Schatz: Ich lehne das völlig ab und hoffe, dass beide Fonds bei der Zusprache von Geldern wissenschaftlich unabhängig bleiben.
Die Furche: Noch immer gilt hierzulande in Forschungsfragen die Schweiz als Vorbild. So werden dort 2,7 Prozent des BIP für Forschung aufgewendet, in Österreich dagegen nur 1,9 Prozent. Dennoch betonen Sie, dass die Schweiz im Forschungsbereich stagniert. Was ist passiert?
Schatz: Mehreres. Zunächst die Finanzkrise des letzten Jahrzehnts, in der die Schweiz konsequenter als viele andere Länder gespart hat. Dadurch hat sie zwar finanzielle Schulden vermieden, aber dafür intellektuelle Schulden gemacht. Zweitens ist ein Gleichbleiben in der Forschung immer ein Zurückfallen. Es braucht heute mehr Können und bessere Strukturen, um an der Spitze dabeizusein. Und schließlich sind viele andere Akteure auf den Plan getreten: Finnland, Irland oder Taiwan haben ihre Forschungsaufwendungen gewaltig erhöht und stoßen an die Spitze vor. Die Schweiz hat sich dagegen auf ihren Lorbeeren ausgeruht. Und sie hat, wahrscheinlich durch das Vorbild der EU-Forschungsprogramme, auf politische Steuerung der Forschung gesetzt.
Die Furche: Im sechsten EU-Rahmenprogramm für Forschung, das bis 2006 laufen wird, hat man die Fördergelder auf 17,5 Milliarden Euro erhöht. Ist damit der Rückstand Europas gegenüber den USA aufzuholen?
Schatz: Ganz sicher nicht, denn dazu fehlen zu viele Rahmenbedingungen. Die EU-Programme sind zu forschungsfremd. Sie meinen, konstruierte Netzwerke mit politischen Vorgaben könnten Innovation schaffen. Was es aber bräuchte, wäre ein echter europäischer Forschungsraum, in dem sich Forschende, und dabei vor allem junge Forschende, frei bewegen können.
Die Furche: Österreich hat als einziges Land das sechste EU-Rahmenprogramm wegen der dort vorgesehenen Förderung embryonaler Stammzellforschung abgelehnt. Nun hat die EU eingelenkt und bis Ende 2003 ein Moratorium in diesem Bereich beschlossen. Was halten Sie von einem solchen Aussetzen der Forschungsförderung?
Schatz: Grundsätzlich befürworte ich, dass eine Gesellschaft entscheiden muss, ob und wie neue Forschungsresultate, die unser ethisches Empfinden berühren, angewendet werden sollen und dürfen. Dennoch ist es sehr wichtig, dass Regeln nicht fundamentalistisch erstellt werden. Die Techniken, um die es hier geht, ändern und verbessern sich fast jedes Jahr. Wir wissen nicht, ob wir vielleicht schon in wenigen Jahren auf embryonale Stammzellen völlig verzichten und statt ihnen Körperstammzellen verwenden können. Die Gefahr derartiger Moratorien ist auch, dass sie leicht zu Denkverboten werden. Es ist wichtig, dass wir unterscheiden zwischen Moratorien der Anwendung, die immer vernünftig sind, wenn sie vom Konsens getragen werden, und Moratorien der Forschung, die meist auch Denkmoratorien sind. Diese sollten wir grundsätzlich ablehnen, weil sie weltweit nicht durchsetzbar und letztlich auch gegen die Natur des Menschen sind.
Die Furche: Aber kommt es in der Embryonenforschung nicht zwangsweise zur Anwendung und dabei zur Tötung von Embryonen?
Schatz: Ja. Deswegen hat die Forschergemeinschaft auch ohne Widerspruch akzeptiert, dass der Begriff "menschliches Leben" pragmatisch ab einer bestimmten Größe des Embryos gilt. Das ist wie jeder Kompromiss unbefriedigend, aber das Beste, was wir tun können.
Die Furche: In der Bioethik-Debatte war oft vom "Unantastbaren" die Rede. Was ist für Sie unantastbar?
Schatz: Die Würde eines denkenden und fühlenden Menschen. Dass es eine Grenze geben muss, ist unbestritten, doch sollten diese Grenzen von jeder Generation demokratisch festgelegt werden. Auch bei der Todesstrafe hat jede Generation eine eigene Entscheidung gefällt, unter welchen Bedingungen ein Mensch getötet werden darf. Wir wissen nicht, wie sich unsere Gesellschaft entwickeln wird. Heute ist es verboten, die Keimbahn des Menschen genetisch zu verändern. Das ist aus heutiger Sicht richtig, doch wir werden diese Regel ändern, sobald wir mit gentechnischen Methoden tödliche Erbkrankheiten sicher und effizient ausrotten können. Dann werden wir wieder neue Grenzen setzen, die hoffentlich wiederum flexibel sind.
Die Furche: Zur Bestimmung dieser Grenzen wurden in den meisten Ländern Bioethik-Kommissionen eingesetzt. Wie hilfreich sind solche Gremien?
Schatz: Sehr hilfreich. Wir dürfen auf sie nicht verzichten. Es muss eine Instanz geben, die offiziell die Grenzen definiert, von einem demokratischen Konsens getragen wird, richtig zusammengesetzt ist, pragmatisch und auch verantwortungsvoll urteilt - und deren Urteil Gewicht hat. Die Gefahr besteht nur, dass es zu viele Ethikkommissionen gibt. Dann kommt es zu einem Gestrüpp, das wirklich Missbrauch erleichtert.
Das Gespräch führte Doris Helmberger.
Grazer Herzblut für junge Forscher
Seine Karriere führte ihn in die USA und dann in die Schweiz. Ihren Ausgang nahm sie jedoch in Österreich: 1936 geboren, studierte Gottfried Schatz von 1954 bis 1961 an der Universität Graz Chemie und Biochemie. Bis 1968 war er Assistenzprofessor am Institut für Biochemie an der Universität Wien, wo er seine Forschungen an der Biogenese der Mitochendrien - der so genannten "Kraftwerke" der Zellen - begann und seine Entdeckung der mitochondrialen DNA für Aufsehen sorgte. Zwischen 1964 und 1966 arbeitete er am Forschungsinstitut für Public Health in New York. Nach einem kurzen Zwischenspiel in Wien ging Schatz 1968 neuerlich in die USA und forschte am Institut für Biochemie an der Cornell Universität in Ithaca, New York. Sechs Jahre später kehrte er jedoch nach Europa zurück und wurde Professor am neu gegründeten Biozentrum der Universität Basel, wo er und seine Arbeitsgruppe die Mechanismen des Protein-Transports in die Mitochondrien erforschten. Schatz ist Träger zahlreicher Auszeichnungen, unter anderem des Österreichischen Ehrenzeichens für Wissenschaft und Kunst. Zudem ist er Mitglied der National Academy of Sciences Washington, der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften und seit 1993 der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Im Jahr 2000 emeritierte er als Professor an der Uni Basel und ist seitdem Präsident des Schweizerischen Wissenschafts- und Technologierates. Gottfried Schatz ist mit einer Dänin verheiratet und Vater dreier Kinder.